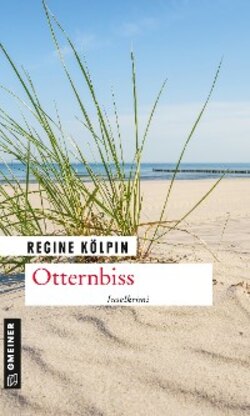Читать книгу Otternbiss - Regine Kölpin - Страница 8
Seelenpfad 2
ОглавлениеReisen
… Ach, vergeblich das Fahren!
Spät erst erfahren Sie sich …
Gottfried Benn (1886–1956)
Maria schälte sich aus dem Bett. Sie hatte keine große Lust aufzustehen, aber der Nachbarin versprochen, ihr beim Fensterputzen zu helfen. Sie konnte es nicht lassen, glaubte sich immer und überall kümmern zu müssen. Wer sie bat, ihm unter die Arme zu greifen, dem schlug sie nichts ab.
Sie jobbte ein paar Stunden in der Woche im Buchladen von Carolinensiel. Sie liebte das tägliche Schmökern, das Abtauchen in fremde Welten, die sie von ihrer eigenen Realität entfernten. Lektüre, die sie später den Leuten guten Gewissens zum Kauf anbieten konnte. Wobei sie eher scheu war. Menschen anzusprechen, auf sie zuzugehen, war nicht ihre Stärke. Sie war auch nicht in der Lage, einem wirklich geregelten Alltag nachzugehen, füllten ihre Grübeleien doch einen beträchtlichen Teil ihres Lebens aus.
Im letzten Jahr hatte sie beschlossen, den kleinen Fischerort zu verlassen, und eine längere Reise gebucht. Sie hatte eine größere Summe geerbt, weil ihr Vater, den sie gar nicht kannte, gestorben und sie Alleinerbin war. Sie solle verreisen, die Welt kennenlernen und darüber gesund werden, hatte Onkel Karl gesagt. Überall war Maria gewesen. In Habana, Zürich, Paris. Alle großen Städte dieser Welt hatte sie gesehen, um festzustellen, dass es besser war, sie blieb für den Rest ihres Lebens in Carolinensiel. Sie konnte nicht vor sich selbst davonlaufen. Die Vergangenheit wurde sie auch nicht los, wenn sie vor ihr floh. Verreisen war nur für die Menschen gut, die sich erholen wollten. Es taugte nichts für Leute, die schwer bepackt durch ihr Leben stolperten.
Nur wenige wussten allerdings von ihrem Trauma, von dem Tag vor zehn Jahren, der ihr Dasein so drastisch verändert hatte, dass sie ihr Leben nicht so führen konnte, wie andere es taten. Daniel gehörte zu diesen wenigen.
Die Schuld lastete schwer auf ihren Schultern. Sie hatte sich einen leicht gebeugten Gang angewöhnt. Maria war es wichtig, nicht aufzufallen, leise zu existieren. War sie schon zuvor ein eher stiller und zurückhaltender Mensch gewesen, so steigerte sie sich mittlerweile dermaßen in ihren Rückzug hinein, dass sie kaum engere Bekanntschaften oder Freunde an ihrer Seite duldete. Maria glaubte, dass alle Lebewesen, die zu dicht an sie herankamen, dazu verurteilt waren, Schlimmes zu erfahren. Sie verstieg sich in schlechten Phasen so weit, sich selbst als Überbringerin des Bösen schlechthin zu sehen.
Sie duldete nur wenige Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Daniel eben, ihren Sandkastenfreund. Und Onkel Karl, den Bruder ihrer Mutter. Da Onkel Karl alleinstehend war, hatte ihre Mutter ihm irgendwann angeboten, bei ihnen einzuziehen. So lebte er, seit sie denken konnte, bei ihnen und spielte seitdem eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Einen Vater kannte Maria ohnehin nicht.
Er war ein stiller Zeitgenosse, passte mit seiner Art zu Maria, weshalb sie sich in seiner Nähe auch unglaublich wohlfühlte. Weil ihre Mutter sich nur wenig um sie gekümmert hatte, war er es, der mit ihr zum Schwimmen gegangen war, war er es, der sie in jenem Sommer zum Anleger gebracht hatte. Und dort in Empfang genommen hatte, als sie zurückgekommen war. Schwer bepackt mit einer Schuld, die eine Fünfzehnjährige genauso wenig tragen konnte wie eine heute Fünfundzwanzigjährige.
Ihr Onkel versuchte immer wieder, sie mit Gleichaltrigen bekannt zu machen, motivierte sie, dem Sportverein beizutreten. Doch ab dem Augenblick, in dem sich jemand mit ihr verabreden wollte, tauchte Maria nicht mehr auf. Sie hatte kein Interesse an einer Freundschaft, konnte die Nähe anderer Menschen nicht ertragen.
Jede Nacht schreckte sie hoch. Träumte den immer gleichen Traum.
Sie ist gefangen im Nebel, sucht Achim. Sie riecht seine Haut, spürt die kleine Hand in ihrer. Manchmal haucht er sie mit seinem Atem an, fragt, wo sie sei, warum sie nicht käme. Ihm sei so kalt. Maria kämpft sich zu ihm durch, kann aber immer nur sein blaues T-Shirt sehen. Es ist leer. Kein Achim steckt darin. Nur seine Stimme ist zu hören, bis auch sie sich weit entfernt.
Wenn sie erwachte, war die Last oft so schwer, dass sie kaum aus dem Bett kam. Sie hatte Achim damals im Stich gelassen. Ihn allein in sein Verderben geschickt, wo er von einer Macht aufgefressen wurde, die sie nicht hatte beeinflussen können.
Keiner hatte ihr dafür die Schuld gegeben. Alle hatten sie getröstet. Der Seenebel sei schon oft eine tödliche Gefahr gewesen. Er komme und verschlucke die Welt. So auch Achim. Er war nie wieder aufgetaucht, seine Leiche hatte man nie gefunden. Er war vom Meer und diesem grauenhaften Nebel einverleibt worden.
Die Feuerwehr hatte die Suche nach einiger Zeit eingestellt, behauptet, Achim sei wahrscheinlich in Panik geraten, hatte die Orientierung verloren. Dabei sei er ins Meer hineingestolpert, in der Senke verschwunden und später mit der Ebbe in die Nordsee hinaus gespült worden.
All das konnte Maria nie beruhigen, ihr nie die Last von der Seele nehmen, dass sie schuld war an seinem Verschwinden. Hätte sie ihn damals nicht laufen lassen, wäre ihm nichts passiert.
Sie stolperte mit halb geschlossenen Augen in die Küche, stellte den Wasserkocher an, um sich einen Tee aufzubrühen. Die meisten ihrer Bekannten hatten mittlerweile diese neumodischen Kaffeevollautomaten und tranken mit Vorliebe Latte Macchiato oder Cappuccino. Sie selbst war noch immer ein eingefleischter Teetrinker, der an dem alten Zeremoniell festhielt, sich die Mühe machte, die richtige Zeit des Ziehens abzuwarten und beim Trinken kleine Tassen zu verwenden. Bei jedem Einschenken musste der obligatorische Kluntje knacken, sonst war es nicht gut. Dieses »gut« war unglaublich wichtig in Marias Dasein. Wenn nichts in Ordnung war, so sollte es doch wenigstens dieser winzige Bestandteil ihres Lebens sein.
Egal, was noch kommen mochte, sie, Maria, war Teetrinkerin. Es war, als sei dieses Ritual so etwas wie ein Halt, der sie begleitete, der ihr vermittelte, alles sei so, wie es sein müsse.
Während das Wasser kochte, schleppte sie sich zum Briefkasten und entnahm ihm die Tageszeitung.
*
Daniel stand am Fenster und wartete wie jeden Morgen darauf, dass Maria loszog. Gestern Abend hatte sie das Licht in ihrem Zimmer erst spät ausgemacht. Daniel wusste immer sehr genau, was sie tat. Er liebte es, sie beim Fensterputzen oder Rasenmähen zu beobachten, mochte ihren Gang, der so anrührend schleppend war. Ihre leicht gebeugten Schultern weckten in ihm den Beschützerinstinkt. Wie gern würde er seine Arme darum legen, sie auffangen und nach und nach aufrichten.
Er sah, dass Maria die Tür öffnete und sich auf den Weg zum Bäcker machte. Drei Brötchen kaufte sie dort jeden Morgen. Ein »Weltmeister«, das sie jedoch erst am Mittag zu sich nahm, ein »Mohn«, dessen Hälften sie dick mit Erdbeermarmelade beschmierte und ein »Normales«. Das aß sie immer mit viel Remoulade und Käse.
Daniel wusste alles über Maria. Wusste, dass sie darunter litt, ein paar Kilos zu viel auf die Waage zu bringen, wusste, dass sie es aber verabscheute, sich übermäßig zu bewegen. Hin und wieder hatte er versucht, sie zu überreden, ihn zum Joggen zu begleiten, aber das hatte Maria vehement abgelehnt. Sie hasste es zu schwitzen.
Sie würde in circa fünf Minuten zurück sein, die Tageszeitung unter den Arm geklemmt, die Brötchentüte in der Hand, den Schlüssel bereits vorgestreckt in der anderen. Sie hatte es immer unglaublich eilig, rasch in ihrem Haus zu verschwinden. Dort war der einzige Ort, an dem sie sich sicher fühlte. Maria lebte wie eine Einsiedlerin mit ihrem verschrobenen Onkel.
Daniel hätte so gern mehr Kontakt zu ihr, würde ihre Mauern gern Schicht für Schicht abtragen. Sie ließ ihn nicht.
Also blieb ihm nur, sie weiter zu beobachten, alles in sich aufzusaugen, zu speichern. Bis sie ihn erhörte. Jedes Opfer würde er dafür bringen. Er brauchte Maria wie keinen Menschen auf der Welt. Sie war die Einzige, die ihn erretten konnte.
*
Rothko sah sich in seiner Dienstwohnung um. Die karge Einrichtung kam ihm eigentlich entgegen, wenngleich er das Sofa gern gegen ein anderes ausgetauscht hätte. Er ging in die Küchenecke, füllte etwas Kaffeepulver ein, er hatte die Nase von dem Pulvergesöff so was von voll. Er wollte einen zweiten Versuch mit der Maschine wagen. Er war eigentlich nicht pingelig, aber das Weiß des Kalkes war auch ihm aufgefallen.
Der Kaffee hatte fast keinen Geruch, das Pulver wirkte blass. Angeekelt schubste er den ausgefahrenen Filter zurück und stellte die Taste an. Wider Erwarten konnte er den Geruch von Kaffee tatsächlich erahnen. Das Wasser rülpste sich durch die Maschine. Er nahm die Kanne und goss sich die fast schwarze Brühe ein. Schon der erste Schluck war eine Beleidigung für seinen Gaumen. Er goss den gesamten Kaffee in den Ausguss.
Wie sollte er unter diesen Umständen einen vernünftigen Gedanken fassen? Er war hierher gekommen, um Abstand zu gewinnen und als ersten Akt fand er sogleich eine Leiche. Und dann noch die eines Kindes.
Die Spurensicherung aus Wilhelmshaven war mit dem letzten Schiff schon aufs Festland zurückgekehrt. Viel hatten sie nicht sichern können. Spuren waren unmöglich zu finden, bei der Bewegung, mit der der Sand sich immer wieder umschichtete.
Kraulke war auch mit von der Partie gewesen. Wichtig hatte er sich aufgeplustert, etwas davon gefaselt, man könne eventuell mit extremer Kriminaltechnik auch die Fingerabdrücke auf der Haut nachweisen. Weil DNA-Spuren bleiben. Der Pathologe hatte unwirsch abgewinkt. Es zwar nicht negiert, aber doch gemeint, es sei überaus schwierig und in den meisten Fällen nicht von Erfolg gekrönt. Oft fehle die Masse an Zellen. An Rothko gewandt, hatte er mit vorgehaltener Hand geflüstert, dass der Kollege Kraulke sich doch besser mit seinem eigenen Dunstkreis beschäftigen solle.
Hier würde nun ein weiterer Polizist einziehen. In ein paar Tagen kam auch der Dienststellenleiter der Insel zurück, so dass sie bald zu dritt wären. In einem Mordfall müssten sie sich sofort verstärken, war die Anweisung von oben.
Rothko wusste nicht, ob das eher positiv oder negativ war. Einerseits war er nicht erfreut darüber, sich Küche und Bad zukünftig teilen zu müssen. Andererseits hatte er nur wenig Motivation, sich hier voll und ganz auf diesen Mordfall einzulassen. Er wollte das eigentlich nicht mehr. Hatte doch die Nase voll von all dem Elend, Sumpf und Dreck. Nun holte ihn all das ein, wie eine losgetretene Lawine.
Er hatte schlecht geschlafen in der Nacht.
Er bekam den Anblick nicht aus dem Kopf. Wer zum Teufel erwürgte einen kleinen Jungen? Einfach so? Es gab keine Spuren sexueller Gewalt, nichts.
Die Mutter war völlig zusammengebrochen. Als er vom Strand zurückgekommen war, hatte sie wie ein Häufchen Elend vor der Tür des Polizeireviers gesessen, das Handy in der Hand, nur die ersten Ziffern der an der Tür angegebenen Nummer eingegeben. Sie war nicht einmal mehr in der Lage gewesen, sie vollständig einzutippen.
Die Frau musste mindestens fünfunddreißig sein, aber sie wirkte gute zehn Jahre jünger auf Rothko, trotz des blassen Gesichtes, in dem die furchtbare Ahnung bereits zu erkennen gewesen war. Sie hatte nicht viel sagen müssen. Er hatte auf Anhieb gewusst, warum sie hier war. Schon beim Aufschließen der Tür war ihm ein leiser Fluch über die Lippen geglitten.
Die Frau war ihm ins Dienstzimmer gefolgt. Der Name Lukas war aus ihr mit einer Verzweiflung herausgebrochen, die ihm Gänsehaut verursacht hatte. An dem Glas Wasser, das er ihr recht unbeholfen reichte, waren ihre Lippen abgerutscht, als habe er den Rand mit Vaseline eingefettet. Sie war nicht in der Lage, einen vernünftigen Satz zu sagen. Immer nur »Lukas. Lukas. Lukas.«
Rothko hatte zunächst den PC hochgefahren. Er brauchte irgendetwas, womit er beginnen konnte. Natürlich würde jeder Satz so verkehrt sein wie nur was. Für diese Situationen gab es keinen guten Einstieg, nichts, was die Sache auch nur im Geringsten entschärfte. Er begann folgerichtig völlig falsch. Die Frage, wie denn ihr Sohn aussehe, hatte die Frau vollends in sich zusammenbrechen lassen. Ihre Finger hatten sich ineinander verschränkt und ihre ohnehin bleiche Haut erschien noch weißer. Blond sei er, hallten ihre abgehackten Worte noch im Ohr. Blond und sommersprossig. Eher dünn. Vor allem die Arme und Beine schlackerten noch so wie nicht dazugehörig. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie weitersprechen konnte, oder besser, bis Rothko ihre Worte wieder verstand.
Sie sei extra noch einmal in die Wohnung zurückgegangen, weil sie gehofft hatte, er liege doch in seinem Bett und lache sie aus, weil sie sich Sorge mache. Er sei aber nicht dagewesen. Einfach nicht dagewesen. Den Satz wiederholte sie noch etliche Male. Es klang wie ein Echo und schraubte sich unwiderruflich in Rothkos Gehörgang.
Irgendwann hatte Angelika Mans den Mut gefasst, dem Kommissar ins Auge zu sehen. Ihr Kinn zitterte, während sie sagte: »Er ist tot, nicht wahr?«
Rothko senkte den Blick. Er folgte einer Spur, die sich längs über den Tisch zog. Er hatte die Lippen fest zusammengekniffen, hob die Augen wieder, als die Frau ihm ein Bild über den Schreibtisch schob. Ein Foto von dem Jungen, wie er weißgepudert am Strand stand. Weiß gepudert war der Kleine jetzt auch. Sein Gesicht sah nur anders aus. Ihm fehlte das Leuchten, das Rothko von dem Foto entgegenstrahlte. Er nickte vorsichtig, mochte den Kopf nicht zu stark bewegen. Das wäre ihm in dem sensiblen Augenblick zu hart, zu brutal vorgekommen.
Ihr bestätigendes Nicken war ihm durch Mark und Bein gegangen. Auch ihr Satz: »Wir wollten eine schöne Reise machen. Nur wir beide«, war wie eine Anklage an das Leben.
Er hatte Schwierigkeiten gehabt, selbst den Würgereiz zu unterbinden. Diese Frau, mit all ihrer Tragik und dem Schmerz, der ihr so tief ins Gesicht geschnitten war, rührte ihn, wie ihn noch nie einer seiner Klienten gerührt hatte. Er teilte ihr Leid, fühlte wie sie das Bohren tief im Bauch. Dieses Messer, das sich mit scharfen Schnitten durch die Eingeweide wühlte.
Das war nicht mehr sein Job. Es war gut, dass er Unterstützung bekam. Er wollte das alles nicht mehr. Nie mehr. Was sehnte er sich nach Ruhe und Abstand! Er verfluchte seinen Chef, der ihn hier auf die vermaledeite Insel statt zur Kur geschickt hatte.
Es hatte eine Weile gedauert, bis sich Frau Mans und auch er gefangen hatten. Rothko war sich unglaublich unprofessionell vorgekommen. Schon ihre Frage, ob sie ihren Sohn sehen könnte, hatte ihn hoffnungslos überfordert.
Der Kommissar wusste, dass die Feuerwehr den Kleinen mitgenommen hatte. Die Frau würde ein Beerdigungsinstitut nennen müssen, mit dem der Junge von der Insel gebracht werden musste. Sie war dazu aber nicht mehr in der Lage gewesen. Mit jeder Information, die zu ihr durchdrang, wich ein Stück Leben mehr aus ihrem Gesicht, bis sie völlig erstarrt dasaß. Rothko hatte noch eine Weile versucht, sie anzusprechen, aber letztendlich den ansässigen Inselarzt gerufen, der sich der Frau angenommen hatte.
Verdammt, war Rothko jetzt nach einem Cappuccino! Er würde in ein Café gehen und sich dort in aller Ruhe seine gewohnte, qualitativ hochwertige Kaffeedröhnung zu Gemüte führen. Nach einem solchen Tag konnte er einfach nicht mit Pulverkaffee existieren.
Er schlüpfte in seine blaue Windjacke, die er sich eigens für Wangerooge gekauft hatte, und trat hinaus in die Charlottenstraße. Noch war nicht viel los, aber schon bald würden sich wahre Urlauberströme auf die Insel ergießen. Rothko schlug den Kragen hoch, zupfte den Schal am Hals zurecht und schlenderte in Richtung Zedeliusstraße. Er brauchte die unbeschwerten Menschen um sich herum, wollte für einen Augenblick so tun, als sei er rein zufällig hier und nichts auf der Welt könne ihn aus der Ruhe bringen.
Er steuerte auf das Hotel Hanken zu. Die verglaste Terrasse lud ihn geradezu ein, sich genau hier niederzulassen. Er setzte sich ans Fenster, bestellte aber einen Latte Macchiato, keinen Cappuccino. Das größere Glas würde ihm eine gewisse Genugtuung verschaffen.
Gegenüber vom Hotel befand sich die kleine Inselbuchhandlung. Rothko überfiel das Gefühl, er müsse sich dringend mal wieder ein Buch zulegen. Lesen, ja lesen wäre eine Beschäftigung, die ihn von dieser grausamen Welt ablenken würde. Er sah sich in seiner Dienstwohnung sitzen, einen Schmöker in den Händen, entrückt in eine andere Welt, die nichts, aber auch gar nichts mit seiner Wirklichkeit hier zu tun hatte. Hauptsache abgelenkt.
Gleichzeitig aber tanzte sofort das bleiche Gesicht des Jungen vor seinem Auge. Es würde nichts nützen. Nichts in dieser Welt befreite ihn von den grausamen Bildern. Jede Flucht war umsonst. Er war ein Sklave seiner Gedanken, ein Opfer seines eigenen Berufes, den er vor langer Zeit einmal als Berufung gesehen hatte. Gerechtigkeit war sein Stichwort. Er war ein Fanatiker. Wollte, dass es in dieser Welt fair zuging. Er lachte auf, dass die Leute vom Nebentisch verwundert herüberschauten. Er nahm einen Schluck von seinem Latte Macchiato. Der war noch heiß. Was aber war schon gerecht? Rothko war rasch klar geworden, wie schwammig der Begriff der Gerechtigkeit war und viele Facetten das Leben für alle Situationen bereithielt.
Er war nur ein winziges Rad in diesem großen System, konnte nur winzige Räder in Bewegung setzen. Aber genau diese Räder waren wichtig für die Funktion des ganz großen Rades, in das sie alle auf irgendeine Weise involviert waren. Jeder hier hatte seine Aufgabe. Rothko kam sich für den Moment unglaublich philosophisch vor.
Er trank den Latte Macchiato in einem Zug aus und winkte der Bedienung. Sein Trinkgeld fiel recht großzügig aus. Sein Gedankenparcours hatte ihm gezeigt, welchen Weg er gehen musste. Er hatte keine Chance, würde sein ganzes Leben von den Eindrücken geprägt sein. So gab es nur eines: Rothko stand so schwungvoll auf, dass der Korbstuhl hintenüber kippte. Das Personal war sofort zur Stelle und hob ihn auf. Kein böser Blick streifte ihn.
Gerade als er den Türgriff schon in der Hand hielt, trat der Chef des Hauses auf die Terrasse und brachte der älteren Dame in der Ecke zu ihrem neunzigsten Geburtstag ein Ständchen mit der Drehorgel. Rothko nickte stumm. Das genau war es. Genau deshalb machte er diesen Job. Um solch harmlosen und netten Menschen wie in diesem Hotel ihr sicheres Leben so weit wie möglich zu erhalten. Sie sollten weiterhin unbeschwert Musik hören und Geburtstagslieder singen können. Sie sollten das Lachen in ihren Augen nicht verlieren. Es war seine Aufgabe, ihnen Schutz zu gewähren. Dafür musste er alles tun, was in seiner Macht stand. Rothko merkte, dass er seinen Oberkörper aufrichtete.
Auf dieser Insel hatte sich ein Mensch herumgetrieben, der ein kleines Kind auf dem Gewissen hatte. Und er, er würde diesen Menschen finden!
*
Maria wartete, bis der Tee auf die Minute richtig gezogen hatte. Sie hatte noch den Kaffeeduft der Bäckerei in der Nase, der sich mit dem Duft des frischen Brotes vermischt hatte. Wie jeden Morgen war sie versucht, vielleicht doch einmal eine Tasse zu probieren. Aber das ließ sie nicht zu. Ihr Leben konnte nur weiter funktionieren, wenn sie funktionierte. Und zwar in festen und geordneten Bahnen. Keine Abweichung von der Norm. Sie musste Tee trinken, egal wonach ihr der Sinn stand. Sie ließ sich auf den nächstbesten Stuhl fallen, griff nach der Zeitung und schlug sie auf.
Toter Junge in den Dünen sprang ihr als Schlagzeile entgegen. Sie quälte sich durch jedes Wort, wollte eigentlich nicht weiterlesen. Zu schmerzhaft waren die Erinnerungen, die sich aus ihrer Tiefe mehr und mehr nach oben schoben. Das alles erinnerte sie an Achim. Vielleicht war er es? Sie schüttelte den Kopf. Achim war seit zehn Jahren verschollen, wie sollte er jetzt plötzlich als Leiche in den Dünen auftauchen? Das ergab keinen Sinn. Sie las Wort für Wort, kämpfte sich durch den Inhalt. Erwürgt worden war der Kleine. Er war in etwa so alt, wie Achim es damals gewesen war.
Marias Hände zitterten. Sie betrachtete ihre Finger. Wie konnte ein Mensch damit einen anderen auslöschen? Sie tastete über ihren Hals, erspürte die Oberfläche. Haut an Haut. Dicht dran. Man fühlte die Wärme des Körpers. Oder hatte der Täter ein Seil, ein Tuch oder Ähnliches benutzt? Sie blätterte weiter. Auf der dritten Seite blickte sie das Foto des Jungen an. Er sah fast aus wie Achims Reinkarnation. Blond, sommersprossig, in alle Richtungen abstehendes Haar. Dazu die lustigen und gleichzeitig so unendlich traurigen Augen. Eine Mischung, die Tragik suggerierte. Das Gesicht tanzte vor ihr herum. Obwohl es erheblich breiter als Achims war, nahm es nach und nach dieselbe Form und den gleichen Ausdruck an, verschmolz immer stärker zu einer Einheit mit ihrer Erinnerung.
Maria musste mit ansehen, wie grobe Hände den schmalen Hals umfassten, wie Achims Augen größer und größer wurden. »Nein!«, entfuhr es ihr. Sie sprang auf, schleuderte die Zeitung in die Ecke. »Achim habe ich im Nebel verloren.« Sie ließ sich auf den Stuhl fallen. Ihr Kopf sank auf die Tischplatte, riss dabei die Tasse um. Ihr Haar badete in lauwarmem Teewasser. Maria merkte es nicht. Sie spürte auch nicht, dass sich die Pfütze ihren Weg bahnte und ihre nackten Füße benetzte.
Sie wurde die Bilder nicht los. Sie hämmerten durch ihren Kopf, schlugen Schneisen in ihren kleinen Schutzwald, der nie richtig wachsen durfte. Zu oft gab es Gelegenheiten, ihn niederzumetzeln. Maria hatte kein Mittel dagegen gefunden, sie wusste nicht einmal, ob sie eines finden wollte.
Als ihr Herz ruhiger schlug, das Zittern in ein monotones Beben übergegangen war, schoss es ihr wie ein Blitz durch den Kopf. ›Wangerooge‹, dachte sie. ›Ich muss nach Wangerooge. Nach all den Jahren gibt es für mich jetzt nur einen Weg. Ich muss mich der Sache von damals stellen.‹
Sie stürzte in ihr Zimmer, riss die Reisetasche vom Schrank. Ein Nebel aus Staub umhüllte sie. Maria musste husten. Sie hatte die Tasche seit ihrer langen Reise nicht benutzt. Maria wischte sie notdürftig sauber, warf eine Jeans, ein paar Socken, Pullis und Shirts hinein. Sie achtete nicht darauf, ob es farblich zusammenpasste, geschweige denn, wie sie darin aussehen würde. Als sie den Reißverschluss zuzog, glaubte sie, hinter sich ein Geräusch zu hören. Sie schnellte herum. Im Türrahmen stand Onkel Karl. Das Sonnenlicht brach sich in seinem angegrauten langen Haar, das sich ohne Übergang mit einem dichten Rauschebart vermischte. Der überdimensionale Bauch versteckte sich unter seinem karierten Hemd, über dem er stets eine beigefarbene Fellweste trug. Die Arme lagen jetzt verschränkt vor seiner Brust.
»Was hast du vor?«, fragte er mit seiner leisen Stimme, die zwar jederzeit zu Maria fand, ihn aber außerhalb des Hauses ebenso abgrenzte wie sie selbst. Onkel Karl wurde nur dort ernst genommen, wo man ihn kannte. Wo er schon hatte beweisen können, was sich hinter der Maske aus Bart und Stimme verbarg. Für die Insulaner war er ein solcher Mann. Obwohl er längst in Rente war, hatten es sich die Bewohner von Wangerooge noch nicht abgewöhnt, ihn, wie seit jeher, für alle möglichen Reparaturarbeiten anzurufen. Ruhig, wie er war, genoss er dort die uneingeschränkte Akzeptanz, die ihm auf dem Festland versagt blieb. Auch wenn er keiner von ihnen war. Aber er entsprach dem Bild des wortkargen Friesen in so einem Ausmaß, dass sie es augenscheinlich einfach vergaßen.
Für andere war er einfach ein Niemand. Vielleicht klebten Maria und er aus diesem Grund so aneinander. Ihre Symbiose hatte beinah pathologische Züge, war von einer gewissen Abhängigkeit geprägt. Maria und Karl redeten nicht darüber. Sie wussten beide darum, fanden es aber nicht der Rede wert. Wichtig war ihnen nur, dass sie selbst damit umgehen konnten.
»Was hast du nun vor?«, fragte Karl ein zweites Mal, nachdem Maria ihm die Antwort schuldig geblieben war.
»Ich fahre nach Wangerooge«, sagte sie und wunderte sich, wie selbstverständlich ihr die Auskunft über die Lippen kam.
»Nach Wangerooge«, wiederholte Karl.
Maria sah, dass er es nicht glauben wollte.
»Du warst seit zehn Jahren nicht mehr drüben. – Warum jetzt?«
Sie deutete mit einer Handbewegung in die Küche. Karl trat in den Flur, blickte zum Küchentisch, auf dem die Zeitung noch aufgeschlagen lag. Maria folgte ihm. Der braune See hatte sich auf dem geblümten Wachstischtuch ausgebreitet und trocknete an den Rändern bereits an. Die Teetasse lag seitlich gekippt, der Kluntje darin hatte sich noch nicht vollends aufgelöst. Die Zeitung war vom Tisch gefallen, ihre Seiten hatten sich auf dem Boden schon mit dem ausgelaufenen Tee vollgesogen.
Karl begriff wie immer sofort. Er hob das Tageblatt auf. Seine Augen klebten an dem Bild des toten Jungen. Wortlos legte er die Zeitung zurück. Maria stand ebenfalls stumm daneben. Karl nahm ein Tuch, wischte den Tisch sauber, stellte die Tasse wieder hin. Er rückte den Stuhl zurecht.
»Es ist keine gute Idee«, sagte er schließlich. »Es wird dir nicht guttun.«
»Warum hast du nichts gesagt?«, flüsterte Maria »Du musst doch gestern etwas mitbekommen haben, als du drüben warst.«
Karl sog die Luft scharf ein. »Ich dachte, es sei besser, du weißt es nicht.« Er wollte ihr über das Haar streichen, verharrte aber ein paar Zentimeter darüber. Karl mochte keine Berührungen. »Die Sache«, er räusperte sich, »muss doch mal zur Ruhe kommen.«
Maria drehte sich um und holte die gepackte Tasche. »Ich nehme das nächste Schiff. Ich kann bei Tant’ Mimi schlafen.«
Mimi war die Cousine von Karl, bei der er stets Unterschlupf fand, wenn er die Insel aufsuchte. Karl zuckte mit den Schultern. Er war noch nicht so recht überzeugt, das sah Maria.
»Ich muss dorthin, Karl.« Sie senkte die Augen. Eine Träne bahnte sich ihren Weg.
»Aber was soll das bringen? Achim ist doch nicht umgebracht worden. Was willst du erreichen?« Karl schüttelte den Kopf.
Maria zuckte mit den Schultern, war aber schon auf dem Weg zur Tür. »Ich glaube, es wird mir helfen. Da war jemand an dem Morgen. Ich bin mir ganz sicher. Achim ist nicht vom Nebel verschluckt worden, Karl. Achim und dieser Junge: Sie verbindet etwas. Ich spüre das ganz genau.«
Sie sah, dass Karls Hand zitterte, als er ihr hinterher winkte.