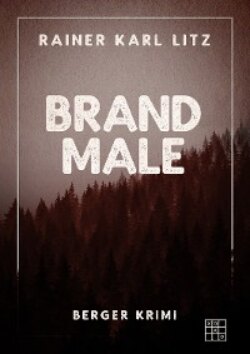Читать книгу Brandmale - Reiner Karl Litz - Страница 6
Оглавление2
»Zahlen!«
Er winkte der Bedienung des Eiscafés zu. Sie lächelte ihn etwas hektisch an und gab ihm mit einem Fingerzeig zu verstehen, dass sie nach der nächsten Bestellung zu ihm käme. Er nickte, zwinkerte ihr mit dem Auge zu und trank seinen Eiskaffee aus.
Er war stinksauer. Das hatte er wirklich nicht nötig. Keine Frau versetzte ihn, ohne die Konsequenzen zu spüren. Da bliebe er sich treu. Egal wie sie hieße, aussah und welche Zuneigung er zu ihr verspürte. So etwas ließe er sich einfach nicht bieten!
Das Dolomiti war das beste Eiscafé in der Neuwieder Innenstadt. Ein Sehen-Und-Gesehen-Werden-Eiscafé mit entsprechend großem Außenbereich auf dem Luisenplatz, der Neuwieder Flaniermeile. Seine Verabredung war nicht erschienen. Bisher hatte er sie als äußerst zuverlässig eingeschätzt. Das hier war außergewöhnlich. Seit den fünfundzwanzig Minuten, in denen er hier draußen an einem der kleinen runden Tische auf sie wartete, war er von mindestens fünfzehn Mädels und zwanzig Jungs gegrüßt worden. Alles Fans, die ihn vom Eishockey kannten. Als einer der Center der Neuwieder Bären, ursprünglich aus Füssen kommend, spielte er hier in der zweiten Saison. Mit seinen vierundzwanzig Jahren müsste er zwar höherklassiger spielen, um sich eine sportliche Karriere zu sichern, aber er war ganz zufrieden in der Deichstadt. Hier war er ein Star und erhielt eine Prämie für jedes geschossene Tor. Zudem hatte er einen Studienplatz an der Uni Koblenz ergattert: Sport und Englisch auf Lehramt. Die Wohnung hatte ihm der Vorstand besorgt und wurde vom Verein bezahlt. So kam er ganz gut über die Runden.
Er sah auf die Uhr und ärgerte sich erneut. Alleine von diesen fünfzehn Mädels, die ihn in den letzten fünfundzwanzig Minuten angelächelt hatten, wären mindestens acht sofort mit ihm nach Hause gegangen. Und das waren nur die, die er ohnehin ganz akzeptabel fand und insofern infrage kämen. So aber saß er hier wie ein Dämel rum. Das wäre das letzte Mal, da konnte sie Ausreden haben, wie sie wollte. Nicht mit ihm. Nicht mit Gregor Hartmann!
Er wusste, dass er sie nicht ganz für sich alleine haben konnte. Sie war unglaublich. Klipp und klar hatte sie ihm beim Kennenlernen bereits gesagt, was sie von ihm wollte: Sex.
Es war nach dem Spiel Ende Januar, gegen Iserlohn, gewesen, in der Pistenbar. Er hatte vier Tore zum 7:3 beigesteuert und war gut drauf gewesen. Und sie hatte ihm unglaublich imponiert. Was sollte er sich auch beschweren? Da kommt so ein Traummädel, Top Figur, unglaublich hübsch und tatsächlich noch intelligent dazu und fragt ihn, ob er hin und wieder mal Sex mit ihr haben wolle. Wer würde da schon nein sagen?
Seitdem trafen sie sich so ungefähr einmal in der Woche. Das war super! Er wusste, dass sie einen großen Freundeskreis hatte. Im Grunde genommen wusste er auch, dass andere ebenso scharf auf sie waren. Wahrscheinlich auch andere Sportler. Fußballer vom Rheinlandligisten FV Engers 07 zum Beispiel. Ja, da war doch dieser Basti. Sebastian Steinebach, wie er richtig hieß. Ein zugegebenermaßen attraktiver Kerl. Gut, sicherlich nicht so attraktiv, wie er selbst, aber doch gutaussehend. Der hatte schon lange ein Auge auf sie geworfen, das hatte er gemerkt. Und dem traute er auch zu, dass der ihm in die Suppe spucken und sie ihm abspenstig machen wollte. Vielleicht hatte der sie dazu gebracht, ihn zu versetzen? Na, das würde er ja rausbekommen und dann würde er sich das Bürschchen vorknöpfen und ihm ein paar Kopfnüsse verpassen.
Es war ihm lange egal gewesen, aber irgendwie hatte er sich dann doch irgendwann an sie gewöhnt. Nein, das war das falsche Wort. Er hatte sie … ja, so könnte man es nennen: er hatte sie regelrecht liebgewonnen. Wenn er ehrlich war, sogar mehr als das.
Die Bedienung kam, lächelte ihn an und riss ihn damit aus seinen Gedanken.
»Na, wann geht´s wieder los mit dem Eishockey?«
»Wir werden nächste Woche mit dem Training beginnen«, meinte er mit einigem Stolz in der kernigen und mit einem bayrischen Akzent gefärbten Stimme, lächelte zurück und schob sich seine schulterlangen goldblonden Haare hinter das Ohr.
»Ist das nicht ein bisschen zu warm für Eishockey?« Sie legte den Kopf auf die Seite.
»Auf´s Eis gehen wir erst in vier Wochen, aber vorher sind wir dann schon im Konditionstraining. Wir müssen uns früh genug quälen, sonst wird das nix mit der Meisterschaft.« Er lachte und bezahlte seinen Eiskaffee.
Anrufen würde er Kathi nicht. Keinesfalls! Nachher bildet sie sich noch was drauf ein. Nein, irgendwann würde sie sich schon von selbst melden. Und vielleicht hatte sie ja wirklich einen nachvollziehbaren Grund gehabt, ihn zu versetzen.
-
Niko Sorokin hatte Berger kurz informiert. Die Mutter des vermissten Mädchens hieß Angelika Seifert-Möbus und war praktische Ärztin. Sie hatte heute angerufen und ihre Tochter als vermisst gemeldet. Die Familie wohnte in Melsbach.
Da es sich bei dieser Vermisstenmeldung um die einzige in ihrem Zuständigkeitsbereich handelte, legte sich Berger bereits weit aus dem Fenster und glaubte einigermaßen sicher sein zu können, dass es sich bei der Brandleiche um ebendieses vermisste Mädchen handelte. Von den Eltern erhoffte er sich bedeutsame Informationen, weshalb er umgehend ein Gespräch vor Ort vereinbart hatte. Zusammen mit Sorokin fuhr er die K 106 vom Neuwieder Ortsteil Niederbieber nach Melsbach. Ein Katzensprung, besonders, wenn man wie Berger fuhr.
»Also, Frau Seifert-Möbus, beziehungsweise Frau Doktor Seifert-Möbus, ist Ärztin mit Praxis in Bendorf. Sie ist verheiratet mit Martin Seifert, der …«
»Der Direktor der KWK?« Berger machte große Augen.
»Richtig! Martin Seifert ist der Direktor der Kraft-Werke-Koblenz. Die Tochter, das einzige Kind übrigens, heißt Katharina Seifert, ist neunzehn Jahre alt und hat dieses Jahr Abitur gemacht. Erst vor wenigen Wochen«, meinte Sorokin und hielt sich dabei verkrampft am Haltegriff der Beifahrerseite fest. Bergers Fahrstil hätte man vorsichtig ausgedrückt unkonventionell bis eigen nennen können. Vielleicht sah er aber auch ganz einfach nicht mehr gut. Sorokin war froh, als der Dienstwagen am Ende einer mit luxuriösen Villengrundstücken gesäumten Wohnstraße ausrollte.
Das Seifertsche Haus lag am Ende der Straße an einem Wendehammer in südwestlich ausgerichteter Hanglage. Sie klingelten am schmiedeeisernen Gartentor, das offensichtlich nur vom Haus aus zu entriegeln war. Da nicht sofort geöffnet wurde, hielt Sorokin es für angemessen, nochmals auf seine Bedenken, Bergers eigenmächtiges Vorgehen betreffend, hinzuweisen: »Ich hoffe nicht, dass Kleinschmidt und Monreal uns dafür grillen. Die Vernehmung wird das Erste sein, was sie durchführen wollen, wenn das Mädchen als Opfer identifiziert ist. Ich meine, es wäre vielleicht besser gewesen, wir hätten gewartet, bis …«
»Lass das mal meine Sorge sein, Niko. Außerdem: Bis die in Koblenz ausgeschissen haben, sind die möglichen Hinweise nur noch die Hälfte wert.« Er wies mit einem Kopfnicken auf das vor ihnen liegende Gebäude und legte ein zweites Mal die Hand auf den Klingelknopf. »Man scheint gut zu verdienen, bei unseren kommunalen Energieversorgern«, meinte er mit einem unbekümmerten Gesichtsausdruck und schaute auf seine Armbanduhr. Zwei Minuten vor halb fünf.
Das Tor fuhr mit einem leisen Surren auf und sie betraten das repräsentative Anwesen. Einem geschwungenen Fußweg aus Bruchsteinen folgend durchschritten sie gepflegte Rabatten, sorgsam gehegte Sträucher blühender Rosen und geschmackvoll arrangierte sattgrüne Rasenflächen, bis sie vor dem modernen, in weißem Marmor gehaltenen, Eingangsbereich standen. Die Haustüre ging sogleich auf und eine attraktive, etwa Mitte vierzigjährige Frau mit adretter blonder Kurzhaarfrisur bat sie freundlich herein. Sie trug eine fliederfarbene Bluse, einen fast knielangen schwarzen Faltenrock und dunkle, glänzende Dianetten mit leicht erhöhtem Absatz. Trotz ihrer äußerst sympathischen und zuvorkommenden Art merkte man ihr eine tiefe Besorgnis an.
Die beiden stellten sich vor und die Frau des Hauses ging voraus ins Wohnzimmer, aus dessen ausladendem Panoramafenster man einen beeindruckenden Blick über den Rhein bis weit hinein in die Eifel hatte.
»Bitte verzeihen sie, dass ich sie habe warten lassen«, sie breitete entschuldigend die Arme aus, »aber ich hatte mit meinen Eltern telefoniert, wegen unserer Tochter. Bitte, nehmen sie doch Platz.« Sie wies mit einer einladenden Geste auf die Sitzgruppe, die einen Couchtisch, ebenfalls aus weißem Marmor, umrahmte. »Darf ich ihnen etwas anbieten?«
Beide lehnten dankend ab und setzten sich jeweils auf einen der beiden weißen Ledersessel. Frau Doktor Seifert Möbus setzte sich auf einen Zweisitzer gegenüber.
»Einen Kaffee, vielleicht?« Aufgeregt sprang sie wieder auf, fast schon im Begriff in die Küche zu eilen, aber Berger bremste sie mit erhobener Hand.
»Nein, danke! Wir wollen sie nicht lange aufhalten, Frau Doktor Seifert-Möbus.«
Die Hausherrin setzte sich wieder. Erkennbar nervös prüfte sie den Sitz ihrer ohnehin wenig korrigierbedürftigen Kurzhaarfrisur.
»Ihr Mann ist …«, begann Berger das Gespräch.
»Er ist noch auf der Arbeit«, unterbrach ihn Seifert-Möbus. »Er kommt selten vor acht Uhr abends nach Hause. Ich bin auch nur deshalb schon hier, weil …« Sie senkte den Kopf und nestelte an ihren Fingernägeln. »Na ja, es ist noch niemals vorgekommen, dass Kathi, also unsere Tochter, nicht vorher Bescheid gegeben hat, wenn sie woanders schläft oder länger ausbleibt. Ich bin sehr beunruhigt, weswegen ich auch heute Mittag sofort angerufen habe. Normalerweise hätte ich heute Nachmittag in meiner Praxis sein müssen.«
»Frau Doktor Seifert-Möbus, hat ihre Tochter gesagt, wo sie gestern hinwollte?«
Ein deprimiertes Kopfschütteln beantworte Bergers Frage.
»Und haben sie irgendeine Idee, warum ihre Tochter nicht nach Hause gekommen sein könnte?« Berger versuchte so entspannt wie möglich zu wirken, um sein Gegenüber nicht zu verängstigen. Die grausame Wahrheit kommt noch früh genug ans Tageslicht, dachte er und kam sich dabei, seinen Verdacht nicht sofort zu nennen, durchaus schäbig vor.
»Nein, wie gesagt: Sie ist noch nie … Sie ruft an, wenn sie sich verspäten sollte oder woanders schläft.«
»Wo schläft sie denn sonst schon mal?«
»Bei ihrer Freundin … Janine, Janine Muscheid, zum Beispiel. Sie haben auch zusammen Abitur gemacht. Gerade erst, vor ein paar Wochen. Sie ist Kathis beste Freundin. Aber ich habe schon mit ihr gesprochen. Sie haben sich gestern nicht gesehen.«
»Und sonst … schläft sie sonst auch schon mal woanders?«, fragte Sorokin.
Mutter Seifert räusperte sich und blickte Berger und Sorokin abwechselnd an. »Nun, sie ist neunzehn Jahre alt. Die Mädchen von heute sind sehr …« Sie wiegte den Kopf von einer Seite zur anderen, hob die Hände und sah dann kopfschüttelnd zur Decke. »… sehr frei in ihrem Tun. Sie sind sehr selbstsicher, ich meine selbstständig und sehr bewusst in ihrem Handeln.«
»Was meinen sie? Dass sie Männerbekanntschaften hat?«, fragte Berger forsch.
»Nun ja, sie können sich denken, dass ein neunzehnjähriges Mädchen, das heißt, eine junge Frau, schon auch männliche Freunde hat.« Mit einem selbstbewussten Blick schlug sie die Beine übereinander, wobei Berger ihre wohlgeformten Waden und eine makellose, seidige und dunkelcurryfarben gebräunte Haut auffielen.
»Um welche Art von Freunden handelt es sich dabei?«, setzte Sorokin nach.
»Schulfreunde, Bekannte vom Sport, aus der Clique und so weiter …« Sie wedelte mit ihren Händen und sah dabei die Wände an, als suche sie weitere harmlose Begriffe.
»Sind ihnen sexuelle Kontakte zu Männern bekannt … oder Frauen?«, konkretisierte Berger ihre Frage nach der Art der Beziehungen, die Katharina Seifert insbesondere zu männlichen Bekannten gepflegt hatte.
Angelika Seifert-Möbius warf Berger einen verärgerten Blick zu. Wieso fragte dieser Polizist derart intime Fragen? Was sollte das bedeuten und wie das Verschwinden ihrer Tochter klären helfen? Nach einigen Augenaufschlägen verstetigte sich aber ihr freundlicher Blick wieder, nachdem sie realisiert hatte, dass die beiden Beamten doch offensichtlich nur ihre Arbeit machten und ihr helfen wollten.
»Ja … wie ich schon sagte, hat sie natürlich auch männliche Freunde. Und mit neunzehn … nun, da hat man natürlich auch Sex. Was sonst? Mit Freundinnen hat sie keine derartigen Beziehungen, wenn sie auf eine gleichgeschlechtliche Beziehung anspielen.« Sie sah Berger auffordernd an, um ihm zu verstehen zu geben, dass seine Frage im Grunde genommen überflüssig gewesen war. »Wissen sie, Kathi ist ein sehr attraktives Mädchen … also eine attraktive junge Frau. Was ich meine ist, sie war bereits in jungen Jahren sehr entwickelt. Körperlich wie geistig.« Sie sah zu einer Anrichte links von sich an der Wand, auf der ein Foto ihrer Tochter in einem silbernen Rahmen stand. »Das ist sie.« Sie wies mit der Hand auf das Foto, stand auf und nahm es, um es Berger zu geben.
Berger betrachtete das etwa postkartengroße Porträtfoto eines außergewöhnlich hübschen Mädchens, das seine Mutter nicht verleugnen konnte. Katharina Seifert hatte lange blonde Haare, volle Lippen und makellose Gesichtszüge, die dem Idealbild einer klassischen Schönheit entsprachen. Ihre ausdrucksstarken strahlend blauen Augen verrieten dazu einen wachen Intellekt. Man hätte zudem mit Fug und Recht behaupten können, dass sie mit ihren Neunzehn durchaus schon das Gewisse Etwas hatte.
Berger stellte den Klapprahmen vor sich auf dem Marmortisch und sprach Frau Doktor Seifert-Möbius an, die sich wieder ihnen gegenüber gesetzt hatte. »Was uns interessiert: Hat sie eine feste oder hat sie mehrere solcher sexuellen Beziehungen?«
»Sie hat keinen festen Freund, wenn sie das meinen. Aber ich glaube schon, dass sie sich mit einigen der Jungs aus der Clique trifft.«
»Sie meinen, dass sie mit denen Sex hat?«, fragte Berger und fuhr fort ohne auf die Antwort zu warten. »Kennen sie die? Oder kennen sie einige von denen?«
»Den einen oder anderen, ja.«
»Können sie uns Namen und Anschriften von denen geben … und von der Freundin auch?«
Sie bejahte und nannte einige Namen und Adressen, die ihr dazu einfielen und die Sorokin sich notierte.
»Ohne sie beunruhigen zu wollen … ihre Tochter hat doch sicherlich einen Computer, oder so etwas. Könnten sie uns den vielleicht auch mitgeben?«
»Ja, natürlich.« Sie nickte Berger zu, stand auf und ging nach oben, um kurz darauf mit einem Klapprechner zurückzukommen. Sie stellte ihn auf den Wohnzimmertisch.
»Hatte sie mit irgendjemandem Streit in letzter Zeit?«
»Streit? Ist das wichtig für … warum soll es wichtig sein, ob sie sich gestritten hat, wenn sie sich nicht meldet?« Natürlich mussten sie die Fragen nun zusätzlich verunsichern.
»Wir fragen das nur, um alles Mögliche auszuschließen. Wir haben da unsere Erfahrungen, wissen sie? Alles kann wichtig sein.« Bergers Worte schienen sie nicht wirklich zu beruhigen.
Ihre Hände begannen zu zittern. »Nein, von einem Streit weiß ich nichts.«
»War sie gestern oder die Tage zuvor irgendwie anders als sonst? Ist ihnen irgendetwas an ihrer Tochter aufgefallen, was sie sonst nicht bemerkt haben?«
Frau Doktor Seifert-Möbus hatte die Hände gefaltet um das Zittern zu kaschieren. Ihr Blick fiel nach unten. »Nein. Ich wüsste wirklich nicht …«
»Wie ist sie denn unterwegs? Ich meine, hat sie ein eigenes Fahrzeug?«
»Ja, einen Opel Tigra … blau«
»Und damit ist sie gestern auch weggefahren?«
Frau Dr. Möbus nickte wie abwesend. Auf Bergers Frage nannte sie Kennzeichen und weitere Merkmale des Fahrzeugs. Sorokin machte sich wieder Notizen.
»Zuletzt eine Information«, begann Berger mit durchaus sensibel leiser Stimme. »Eine Information, die uns zwar wichtig ist, die sie aber nicht zwingend verängstigen muss.« Berger, der ihr diese letzte Information nicht ersparen konnte, beobachtete, wie sie unwillkürlich die Hände vor ihre Brust zog und aufgeregt schluckte.
»Was meinen sie? Haben sie Hinweise auf …?« Ihr hektischer Blick wechselte zwischen Berger und Sorokin.
»Wir haben heute Morgen eine tote Person im Engerser Feld gefunden. Genauer gesagt, am Silbersee. Die Person ist einem Brand zum Opfer gefallen«, sagte Berger, für seine Verhältnisse ungewöhnlich zaghaft.
Mit einem erstickten Laut ließ sie sich in das Polster zurückfallen und starrte Berger an.
»Wie gesagt, Frau Doktor Seifert-Möbius, wir wissen noch gar nichts. Es kann reiner Zufall sein, dass am Silbersee jemand starb und ihre Tochter vielleicht bei einer Bekannten ist und sich später meldet.«
Obwohl Berger versuchte, so beruhigend wie möglich zu wirken, konnte er nicht verhindern, dass sein Gegenüber in ein leises Schluchzen ausbrach.
»Frau Doktor Seifert …«
»Wir werden alles tun um die Sache aufzuklären und geben ihnen so schnell wie möglich Bescheid, wenn wir etwas Neues erfahren«, beeilte sich Sorokin beschwichtigend, der seinem Chef eine wie auch immer geartete Unsicherheit anmerkte. Er war einfach nicht der Alte, hatte nicht mehr diese zupackende Art. Jedenfalls nicht mehr ständig, so wie früher. Und da Berger sich in einem energetisch nicht gut versorgten Zustand zu befinden schien, fuhr er fort: »Dürften wir das Foto vielleicht mitnehmen?« Er zeigte auf den Klapprahmen auf dem Couchtisch. »Sie bekommen es zurück. Und … es klingt für sie vielleicht ungewöhnlich: Wir benötigen die Zahnbürste und einen Kamm oder besser noch die Haarbürste ihrer Tochter. Für alle Fälle …«
Sie schluckte, seufzte laut und strich sich mit zittrigen Fingern durch die Haare. Dann nickte sie. »Ja!«
Nachdem sie die beiden Gegenstände besorgt hatte, setzte sie sich müde und abgespannt wirkend zurück auf das Sofa. Sie faltete die Hände im Schoß, ließ den Kopf sinken und sprach leise: »Und … nein, sie hatte keinen Streit. Sie ist ein sehr ausgeglichener und kommunikativer Mensch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit irgendjemandem ernsthaft in Streit gerät. Sie kennen sie nicht, sie …« Sie hatte den Kopf wieder gehoben und schaute beide Beamten mit tränengeröteten Augen an. Ihre Arme hingen schlaff und kraftlos von den Schultern, die Hände lagen noch immer gefaltet in ihrem Schoß.
-
»Das kann ich dir sagen …« Bergers Zornesfalte glühte und seine Stimme hatte eine bedrohliche Lautstärke angenommen. »Wenn der glaubt, er könnte hier das Hännesjen mit uns machen … wenn der das glaubt, dann soll der mich mal richtig kennen lernen. Wenn der morgen nicht hier auftaucht und seine Arbeit macht, dann … dann Gnade ihm Gott!« Im Rhythmus der zuletzt gebrüllten Worte klopfte er mit seinem Zeigefinger auf der Schreibtischplatte herum. Die andere Hand hielt er als geballte Faust in die Luft und drohte damit quasi symbolisch dem nicht anwesenden Fassbender.
Sorokin nickte betont abwesend und notierte sich irgendetwas. Er saß an seinem Schreibtisch, hinter dem er sich angesichts Bergers lauten Wortschwalls sicher fühlte und ertrug den Wutausbruch seines Vorgesetzten daher fast mit Gelassenheit. Er wusste, dass man Berger nicht bremsen konnte, wenn er mal Fahrt aufgenommen hatte. Und letztlich betraf es ihn selbst ja nicht. Klar, was sich Fassbender erlaubte, war unmöglich. Sich an so einem Tag krank zu melden, war eine Frechheit. Wie pflegte Berger stets zu sagen: Solange wir den Kopf nicht unter dem Arm tragen, sind wir im Dienst. Da war auch was dran. Wer sich zum Polizeidienst verpflichtete, ging ganz bestimmte Verpflichtungen ein, übernahm Verantwortung, die vor einer handelsüblichen Erkältung nicht Halt machte. Im Grunde genommen wusste Sorokin mittlerweile auch, dass Fassbender für ihre Art von Arbeit nicht gemacht war. Sicherlich hatte der sich die Polizeiarbeit ganz anders, irgendwie romantisch und so ähnlich, wie in einem Fernsehkrimi, vorgestellt. Dass man aber tatsächlich mit Blut, zerfetzten Leibern, Exkrementen und dem Abschaum der Menschheit zu tun hatte und das alles noch ansehen, anhören und manchmal auch anfühlen musste, das hatte sich Fassbender ganz offensichtlich so nicht ausgemalt. Ganz zu schweigen von dem Umstand, dass man immer etwas von dieser Arbeit mit nach Hause nahm. Und dieses Etwas meldete sich irgendwann wieder, auch wenn man es gar nicht wollte.
»Hat Rübesam gesagt, wann er den vorläufigen Bericht fertig hat?«
Berger kam so langsam wieder runter. Ist manchmal besser, wenn man ihn sich austoben lässt, dachte Sorokin zufrieden.
»Heute noch, hat er gesagt.«
Berger rieb sich die Hände. Er war ungeduldig. Wollte loslegen. War wie ein Tiger vor dem Sprung. Alle kannten das von ihm: Er konnte wochenlang wie unbeteiligt wirken, aber wenn ein richtiger Fall vor ihm lag, dann explodierte er förmlich.
»Na, ich werde mal zu ihm runtergehen und nachsehen, warum das so lange dauern muss. Vielleicht kann ich ihm auf die Sprünge helfen.« Berger klopfte auf Sorokins Schreibtisch und wendete sich zur Tür. Sorokin nickte wieder. Natürlich wusste Berger selbst, dass die Leute der Spurensicherung und Kriminaltechnik gute Arbeit machten und dass sie ihre Zeit brauchten, um die Ergebnisse ihrer Arbeit zu dokumentieren, aber er hielt es einfach nicht aus, zu warten.
Die Kriminaltechniker um Jürgen Rübesam waren ein eingespieltes Team. Hervorragende Fachleute, die ihre Arbeit verstanden. Berger hatte großen Respekt vor der Arbeit seiner Kollegen, die ihre Arbeitsräume im Kellergeschoss des Polizeigebäudes hatten.
»Jürgen, alter Physiker! Was sagt uns der Tote?«
Jürgen Rübesam, der ein Physikstudium mit ordentlichem Abschluss absolviert hatte, bevor er in den Polizeidienst eingetreten war, hatte mit seinem Team bis zum Nachmittag am Fundort der Leiche verbracht. Nun war es kurz vor drei. Rübesam saß hinter seinem Schreibtisch, auf dem sein Klapprechner, Fotoausdrucke und einige Asservatenbeutel unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Inhalts lagen. Er tippte fleißig auf die Tasten seines Rechners.
»Bin gleich so weit«, sagte er, ohne von der Tastatur aufzublicken. »Nur eins schon vorweg …« Er hob die Augenbrauen an und tippte dabei weiter. »Das wird tatsächlich schwierig mit der …« Er kratzte sich am Kopf. Offensichtlich suchte er nach einer Formulierung für seinen Bericht.
»Womit wird das schwierig?«, setzte Berger nach, bereits ahnend, dass ihm Rübesams Information nicht passen würde.
»Na, das mit den Umständen des Todes.«
»Wie meinst du das?« Berger war unmittelbar an Rübesams Schreibtisch herangetreten. Die spontan eingetretene Erregung war ihm unschwer anzumerken.
»Na, genau, wie wir eben vor Ort gemutmaßt haben, beziehungsweise, was du hellseherisch bereits geahnt hattest.« Rübesam hatte aufgehört zu tippen und sah Berger an. »Wir haben den einigermaßen verwertbaren Abdruck eines Gummistiefels. Ob der in Zusammenhang mit dem Brand steht, kann ich natürlich nicht sagen. Dann … in dem ausgebrannten Gebäude haben wir einen abgefackelten Benzinkanister gefunden. Oder zumindest das, was von ihm übrig ist. Der war aus Plastik und ist fast gänzlich verbrannt. Aber es hatte sich zweifelsfrei um einen Kanister gehandelt, schätzungsweise einen zehn Liter Kanister. Ebenso ein Feuerzeug, oder das, was von ihm übriggeblieben ist.«
Berger starrte sein Gegenüber mit offenem Mund an. »Und das soll jetzt einen Unfall beschreiben?« Er hatte die Hände gehoben, als wollte er nach etwas Rettendem greifen. Etwas, dass ihm den korrekten Tathergang doch noch sichern würde. »Aber das …« Berger rang nach Luft. »Das ist kein Unglücksfall! Das ist …«
»Woher willst du wissen, dass es kein Unglücksfall war, hm?«, unterbrach ihn Rübesam. »Außerdem, Ronny, wissen wir ja auch nicht, wie sich der Fall entwickeln wird. Das hängt ja nun von euren Ermittlungen ab.«
»Ist doch ganz klar, dass hier ein Verbrechen vorliegt«, polterte Berger, als hätte er Rübesams letzte Worte überhaupt nicht wahrgenommen. »Nachts …«, er ruderte mit den Armen und blickte mit aufgerissenen Augen zur Decke des Büros, als fände er dort Zustimmung für seine Worte. »… irgendwann nach Mitternacht. Es ist so warm, dass man selbst nur mit einem T-Shirt bekleidet nicht friert. Eine Person alleine an diesem … diesem Märchensee … mit einem Benzinkanister und einem Feuerzeug in dem maroden Schuppen. Wahrscheinlich wollte der sich ein Steak braten … oder was?« Berger wurde langsam laut. Seine Mimik verhärtete sich.
Rübesam lehnte sich in seinen Schreibtischstuhl und schob ihn vorsichtshalber etwas zurück. Berger war noch nicht fertig.
»Dabei stellt der sich so dämlich an, dass er den Inhalt des Kanisters über sich verschüttet und dann auch noch das Feuerzeug nimmt, um sich damit anzuzünden. So stellst du dir also den Verlauf des Dramas vor, was?« Berger starrte Rübesam mit funkelnden Augen an.
Rübesam ließ vier taktische Sekunden verstreichen, ehe er sich an eine Antwort traute. Er vermied es auch, Berger dabei anzusehen. Ähnlich, wie bei Raubtieren, dachte er. Die empfinden das Anstarren durch einen Artgenossen auch als Provokation.
»Ronny, ich habe doch gar nichts zum Ablauf des Geschehens gesagt. Ich habe dir nur mitgeteilt, dass wir einen verbrannten Kanister und die Reste eines Einwegfeuerzeugs gefunden haben. Und zwar in unmittelbarer Nähe des Brandopfers.« Er streckte seine Handflächen aus, als wolle er damit ein Friedensangebot machen.
»Ja, verdammt, aber damit sagst du …« Berger hielt abrupt inne. Er überlegte. Rübesam sah ihm an, wie sich die Gedanken einen Weg durch die Gehirnwindungen suchten. Seine Erregung schien sich zu legen. Jedenfalls brüllte er nicht mehr, als er wieder sprach.
»Gut, Jürgen. Das hast du mir ja jetzt gesagt. Und das steht auch in deinem Bericht, dass mit dem Benzinkanister. Oder?«
»Ja, natürlich.«
»Hm, aber du weißt auch, dass dieser Hinweis in Koblenz den Verdacht eines Unfalls aufkommen lassen könnte, was wiederum die Motivation der Ermittlungen bremsen würde.«
»Nun, Ronny, da kann man aber nun nix machen.« Er beobachtete den Leiter der K1, dessen Wutfalte an der Nasenwurzel wieder begann, Konturen zu entwickeln. Rübesam beeilte sich deshalb fortzufahren. »In diesem Zusammenhang … wir haben einen Anhänger gefunden. Das Brandopfer hatte eine dünne Kette, wahrscheinlich Gold, mit einem Anhänger daran, um den Hals. Einen kleinen Thorshammer, wenn ich es richtig deuten konnte. Ist ja alles schwarz und zusammengebacken. Ich konnte das Teil nicht abnehmen, weil es mit dem Brandopfer regelrecht verschmolzen ist. Aber ich denke …«
»Ein was? Ein Thor …?« Bergers Interesse an diesem Detail war augenblicklich geweckt.
»Ein Thorshammer. Ein verkleinerter Hammer des germanischen Gottes Thor.«
»Du meinst so was Germanisches?«
»Ja, Thor. Oder Donar, wie sie hier in unserer Gegend gesagt haben, die Germanen. Der Hammer ist sein Symbol.«
»Was bedeutet das? Ich meine, was bedeutet ein Thorshammer, oder was bedeutet es, wenn ihn jemand trägt?«
»Also zum einen: Wegen dem Anhänger und dem eher dünnen Goldkettchen glaube ich, dass unser Brandopfer weiblich ist. Frauen tragen eher einen Anhänger, und ein Mann hätte wahrscheinlich eine kräftigere Kette getragen oder ein Lederband. Zum anderen …« Er tippte auf seine Tastatur ein und winkte Berger zu sich, damit er auf den Bildschirm blicken konnte, auf dem sich eine Internetseite öffnete. »Hier siehst du, wie der Thorshammer aussieht: Irgendwie, wie ein auf dem Kopf stehendes T.« Sie betrachteten einen Gegenstand, bei dem man in der Vergrößerung verschlungene Ornamenten erahnen konnte.
»Ja, und was bedeutet das?«
»Thorshämmer, werden von Menschen getragen, die sich dem germanischen Glauben oder allgemein den Germanen verbunden fühlen.«
Berger musste unwillkürlich an seine Frau denken. Wenn er sich richtig erinnerte, arbeitete sie in ihrer Arbeit als Psychologin auch mit solchen Dingen. Sie hatte ihm irgendwelche archetypischen Bilder oder Symbole erklärt, die sie in der psychotherapeutischen Arbeit mit ihren Patienten nutzte. Eben auch solche aus der germanischen Mythologie. Zumindest bei Patienten aus dem heimischen Kulturkreis. Trotzdem fragte er: »Ist das irgendwas Anstößiges oder …?«
»Du meinst die Neonaziszene?«
»Ja, zum Beispiel.«
»Nein, das glaube ich nicht. Es ist vielleicht so, dass auch Nazis solche Germanensymbole nutzen, das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass jeder, der mit solchen Symbolen hantiert ein Nazi ist. Mit anderen Worten: Was können die Germanen dafür, dass sich Jahrhunderte nach ihnen, im Dritten Reich, irgendwelche Kriminellen für sie interessiert haben. Also, unser Brandopfer könnte einfach zu denen gehören, die sich für unsere Vorfahren oder ihre Mythologie begeistern.«
»Gut, verstehe. Aber nochmal zu deinem Bericht. Du weißt, wenn du das mit dem Kanister schreibst, wird das womöglich nicht der Aufklärung des Falles dienen.« Da Rübesam die Augenbrauen hob, fügte er erklärend hinzu: »Weil die dann glauben, dass es ein Unglücksfall war.«
»Ja, aber ich muss doch die Ergebnisse dokumentieren, Ronny!«
»Ja, Jürgen. Aber könntest du nicht …« Berger bewegte die Hände abwägend auf und ab, um anzudeuten, dass es immer mehrere Möglichkeiten oder gar mehrere Wahrheiten gäbe.
»Du meinst, ich soll die Information gar nicht …?« Rübesam war von seinem Stuhl aufgesprungen.
Berger sah ihn mit einem breiten Grinsen von der Seite an.
»Nee, Ronny!« Rübesam schüttelte entschieden mit dem Kopf. »Das kannst du knicken. Der Bericht ist fast fertig und geht genau so raus.« Er wies mit dem Finger auf seinen Rechner.
»Jürgen!« Bergers Stimme hatte einen fast väterlichen Ton angenommen. Er legte trat näher an den Kollegen heran und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Ich meine ja nicht, dass du was verschweigen sollst. Aber könnte das mit dem Kanister nicht zum Beispiel auf der zweiten Seite stehen? Und du unterschreibst beide Blätter und …?«
»Und du willst die zweite Seite verschwinden lassen?«
Berger wiegte den Kopf hin und her. »Nicht verschwinden lassen, Jürgen. Aber, sieh mal, ich fahre den Bericht gleich nach Koblenz und gebe ihn dem Monreal. Und was weiß ich, was auf dem Weg nach Koblenz passieren kann. Es ist heiß draußen … die Wagenfenster sind offen … Durchzug … Du verstehst?« Er rüttelte Rübesam sanft an der Schulter und nickte gelassen.
»Also Ronny, ich weiß nicht. Du …« Rübesam schüttelte den Kopf und trat einen Schritt zur Seite und damit weg von Berger. »Ich mache den Bericht jedenfalls jetzt fertig. Und zwar vollständig. Das Detail mit dem Spritkanister steht sowieso auf der zweiten Seite, wenn du weißt, was ich meine. Mach damit, was du willst!« Mit diesen Worten setzte er sich wieder vor seine Tatstatur und tippte die letzten Zeilen in den Bericht.
-
»Sollte dieses undankbare Pack irgendeinen Scheiß erzählen, dann Gnade ihnen Gott. Ob es sich um meinen Sohn, oder deine Tochter handelt. Da kenne ich kein Pardon, mein lieber Martin. Dafür kennst du mich. Da kenne ich weder Freund, noch Feind!«
»Mensch, Erhard. Das ist doch alles ganz normal. Wir waren doch auch nicht anders. Du weißt doch, wie das in diesem Alter ist. Hauptsache aufsässig sein. Die meinen das im Grunde genommen doch nicht wirklich ernst.«
»Dein Wort in Gottes Ohr, Martin. Dein Wort in Gottes Ohr. Das will ich wirklich hoffen. So schnell, wie ich den Fabian zu einem dreijährigen Betriebspraktikum in die Ukraine verfrachtet habe, kann der gar nicht Luft holen. Und du wirst mit deiner lieben Tochter das gleiche machen, mein Lieber. Da kommst du nicht drum herum, wenn sich bewahrheiten sollte, was ich befürchte …«
Erhard Rothgerber war in Fahrt. So, wie man ihn kannte. Mit seinen dreiundfünfzig Jahren stand der Capo, wie er von seinen Parteifreunden ehrfurchtsvoll genannt wurde, voll im Saft und in der Blüte seines beruflichen wie politischen Lebens. Als gelernter Bankkaufmann hatte er sich Stück für Stück hochgearbeitet und vor gut zwanzig Jahren den Sprung zur Selbständigkeit gewagt. Das hatte sich gelohnt. Als professioneller Anlageberater verdiente er heute mehr als das Zehnfache seines damaligen Gehalts. Politisch hatte ihn sein Hang zu einfachen und klaren Worten, gepaart mit einem immensen Selbstbewusstsein und einer dicken Hornhaut an den richtigen Stellen, bis an die Spitze der Mehrheitsfraktion im Koblenzer Stadtrat getragen. Diese Position in Kombination mit dem Parteivorsitz in Koblenz hatte er stets zu seinem Vorteil zu nutzen gewusst. Der Unterstützung seiner Parteikollegen konnte er sich dabei sicher sein, denn der Großteil derer hatte größere oder kleinere »Geschenke« von ihm erhalten. Die Kommune war mit ihrer Stadtverwaltung oder dem städtischen Energieversorgungsunternehmen KWK ein großer Versorgungsapparat für Parteikollegen, deren Ehepartner, Kinder oder sonstige nahe Verwandte. In den vielen Abteilungen der Kraft-Werke-Koblenz und der Kommunalverwaltung fanden sich somit fast alle Familiennamen, die auch auf der Fraktionsliste standen. In der Stadtverwaltung war es nicht viel anders. Für die Postenbeschaffung sorgte Rothgerber. Und spurte ein Verantwortlicher in den Verwaltungen mal nicht, so konnte man sicher sein, dass seine Stelle innerhalb des nächsten halben Jahres neu ausgeschrieben werden musste.
Insbesondere der Koblenzer Energieversorger KWK war es, der Rothgerber stets besonders interessiert hatte. Schließlich war die Energieversorgung ständigem Wandel unterworfen, ein Betätigungsfeld mit Abenteuercharakter, in dem moderne Goldgräber immer wieder mal eine Goldader fanden. Eine Branche, in der man mit geschickten Schachzügen Millionen bewegen konnte, ein Wirtschaftszweig, in dem motivierte Kaufleute noch so etwas wie Spannung erleben durften. In dem man scheitern, in dem man aber auch in luftige Höhen kolossalen wirtschaftlichen Erfolgs katapultiert werden konnte. Das reizte Rothgerber. Es weckte seinen Sportsgeist. Zudem, aber das hätte er selbst niemals als Triebfeder seines eigentlichen Interesses beschrieben, boten sich in diesem Geschäftsfeld hervorragende Möglichkeiten, den eigenen Vorteil zu nutzen. Sei es durch Prämien der großen Strom- und Gasanbieter, sei es durch Vorzugsbehandlung im eigenen Betrieb. Hier ein Kontingent preiswertes Gas, dort ein besonders günstiges Stromangebot. Ein Werbefahrzeug ohne Werbeaufkleber … Irgendwas ging immer. Rothgerber war der eigentliche König der KWK. Martin Seifert, der Direktor des Energieversorgers, war lediglich sein Statthalter. Wenn Rothgerber dreimal wöchentlich im Besucherstuhl des luxuriösen Seifertschen Büros im fünften Stock des Verwaltungsgebäudes saß, konnte jeder unschwer erkennen, wer das Sagen hatte und wer Befehlsempfänger war. Den finanziellen Nutzen, den Rothgerber aus seinem Engagement beim Koblenzer Energieversorger zog, wusste er geschickt zu teilen, so dass Seifert nicht alleine auf sein dürftiges Jahressalär von einer Viertelmillion Euro angewiesen war. Hin und wieder sprang auch mal ein erkleckliches Sümmchen aus einer Rückerstattung oder ein Sonderposten aus Rabatten heraus, die in »Naturalien« bezahlt wurden, beispielsweise ein gasbetriebenes Fahrzeug oder ein Jahr Strom umsonst. Alles irgendwie halb- bis illegal, aber jedenfalls problemlos zu kaschieren und stets unbemerkt, sofern der Direktor des Betriebes die Abwicklung selbst in die Hand nahm, wie es Seifert zu tun pflegte.
Rothgerbers Aufgeregtheit an diesem Morgen war nicht aufgesetzt, wie sie es sonst schon mal sein konnte, wenn er sich mit Wutausbrüchen ins rechte Licht zu setzten wusste. Er war aufrichtig entrüstet und erzürnt. Hatten sich doch sein Sohn Fabian und dessen Klassenkameradin Katharina Seifert, Martins Tochter, offensichtlich auf die Seite aufrührerischer Verschwörungstheoretiker und Weltverbesserer geschlagen und beschlossen, ihre Väter an den Pranger zu stellen. Diese undankbare Brut hatte scheinbar vergessen, wer sie in Wohlstand und Luxus aufgezogen und ihr das Abitur ermöglicht hatte. Fabian war im Grunde genommen seit Jahren aufsässig, kam ganz nach seiner Mutter, mit der man auch nicht über Geschäftliches reden konnte. Die hatte das Geschäftliche aber wenigstens nie interessiert. Sie genoss einfach das Leben an der Seite eines der mächtigsten Männer in Koblenz. Aber Fabian kam irgendwie nicht aus seiner Pubertät heraus, hatte Flausen im Kopf und hatte ihn erst vor wenigen Tagen, anlässlich eines Streits über das monatliche Unterhaltsgeld, mit seiner Kenntnis über »Machenschaften« bei den KWK konfrontiert. Dabei hatte Sohnemann keinen Zweifel daran gelassen, dass er genau wusste, wer die Verantwortlichen dabei waren: sein Vater und Martin Seifert. Dessen Tochter Katharina steckte in diesem Akt von Illoyalität wohl mit drin.
»Bleib ganz ruhig, Erhard. Ich bin ganz sicher, dass es sich lediglich um eine Art jugendlicher Aufsässigkeit handelt. Das haben wir doch auch in dem Alter gemacht. Die wollen sich ausprobieren, loten ihre Grenzen aus … irgend sowas. Das gibt sich schon wieder, glaub mir, Erhard. Also, was die Kathi angeht, die würde niemals mit sowas an die Öffentlichkeit gehen. Die interessiert sich eigentlich gar nicht für meine Arbeit. Und bei Fabian kann ich mir das auch nicht vorstellen.« Martin Seifert wusste, dass der Capo nicht leicht zu bremsen war. Er musste es trotzdem versuchen. Nichts war im mehr zuwider, als Streitigkeiten.
»Jaja, Martin, ich hoffe, du hast recht. Aber ich habe ein ganz beschissenes Gefühl. Und sowas von den eigenen Kindern … da könnte ich wirklich zum Tier werden.« Rothgerber mahlte mit den Zähnen.
»Verstehe ich ja, Erhard. Aber das Problem kannst du doch lösen. Was glaubst du denn, wie schnell der Fabian wieder spurt, wenn du ihm anstelle seines Corsa ein Tigra Cabrio vor die Türe stellst? Den könntest du dir mit dem nächsten Rabattpaket von RWC im August erstatten lassen.«
»Mmh … das könnte passen, damit hätte ich ihn zusätzlich korrumpiert.« In der kurzen Pause, die Rothgerber einlegte, konnte man förmlich das Rauschen der Gedankenströme hören. Rothgerber war zwar ein Praktiker, für die notwendige Planung brauchte er jedoch immer etwas mehr Zeit. »Gut, lass es uns erst einmal dabei bewenden. Ich beobachte den Burschen jedenfalls, den lass ich nicht mehr aus den Augen. Und ich empfehle dir, das Gleiche mit der Katharina zu tun. Sollten wir nur den Ansatz eines Verrats entdecken, müssen wir blitzschnell reagieren. Hast du mich verstanden, Martin? Blitzschnell!«