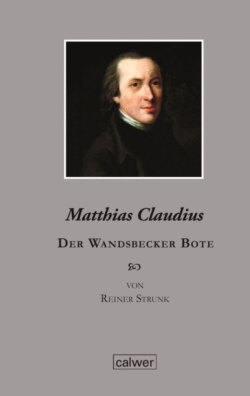Читать книгу Matthias Claudius - Reiner Strunk - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBegegnungen in Kopenhagen
Zwei Jahre lang, von 1762 bis 1764, gab es für Claudius viel Mußezeit und wenig Perspektiven. Seine ›Tändeleyen und Erzählungen‹ wurden veröffentlicht, jene frühen, in Jena und im Kontext der ›Teutschen Gesellschaft‹ entstandenen Poesieversuche, die eine miserable Presse fanden und von denen bereits die Rede war. Auch das schien also nichts zu sein, woran sich größere Hoffnungen knüpfen ließen. Ein ausführlicher Brief von ihm ist erhalten aus dieser Zeit, gerichtet an Gerstenberg, dem er bald am dänischen Hof wieder begegnen sollte. In diesem Brief vom 2. Oktober 1763 offenbart sich die ganze prekäre Lage des jungen Claudius. Eine melancholische Saite seines Wesens klingt an, die in späteren Jahren leiser werden, aber nie völlig verstummen sollte. Sein dickes hypochondrisches Blut nennt er das jetzt (Br. 20). Es belastet ihn und wirkt lähmend. Poetisch habe er nichts mehr zustande gebracht, stattdessen fühle er sich zu Stätten des Todes hingezogen. Da ist von Grab und Totengräbern, von Bahren und Beinhäusern die Rede, die nun seine Ziele bildeten. Eine bloße Marotte ist das gewiss nicht, eher ein Zeichen seiner psychischen Gefährdung. Claudius tritt nicht nur auf der Stelle, er droht vor einem Abgrund zu stehen. Folgerichtig verknüpft er in seinem Brief den gewährten Einblick in seine seelische Verfassung mit einem Hilferuf: Stirbt in Kopenhagen nicht ein Sekretär oder braucht nicht ein junger Herr einen Hofmeister, mit ihm auf die Universität zu gehen? Sogar Norwegen schließt er nicht aus mit den Bergwerken dort, wenn sich bloß eine Anstellung für ihn abzeichnen würde.
Ein Jahr darauf, 1764, scheint sich das Blatt zu wenden. Claudius kann sich von seinen Eltern und dem Asyl im Reinfelder Pastorat verabschieden und im Frühjahr den Weg nach Kopenhagen antreten. Sein Onkel Josias Lorck, Pfarrer an der deutschen Kirche in Christianshaven, hatte ihm einen Sekretärsposten beim Grafen Holstein in der dänischen Hauptstadt vermittelt. Die Aufgabe in der Heeresverwaltung dürfte den jungen Claudius nicht besonders gereizt haben, aber die Stadt war verlockend. Eine Residenz mit kulturellem Flair, jung, aufstrebend, dazu überschaubar und gemütlich im Vergleich zu den großen Hauptstädten im übrigen Europa. Kopenhagen besaß damals mehr vom geistigen Charme des klassischen Weimar als von den Turbulenzen einer Metropole.
König Friedrich V. hatte schon 1751 Klopstock an seinen Hof berufen, der seit Jahren mit dem Literaturprojekt des ›Messias‹ befasst war. Er hatte es auf zwanzig Gesänge angelegt und brachte es in mehreren Lieferungen heraus. Ein ehrgeiziges und in seiner sprachlichen wie thematischen Gestaltung ganz neuartiges Werk, das nicht überall mit Beifall aufgenommen wurde. Klopstock schwebte die Schaffung eines nationalen Heldengedichts vor, und dazu wählte er, kurios im Grunde, einen biblischen Stoff, den er in homerische Hexameter goss. Die Hoffnung, zur Fertigstellung dieses Projekts von nationaler Bedeutung an einem Fürstenhof finanziell unterhalten zu werden, zerschlug sich zunächst. Dann aber verschaffte ihm Graf Bernstorff eine Pension in Kopenhagen, die ihn zu nichts verpflichtete und lediglich mit der Erwartung verbunden war, er möge sein begonnenes Versepos vollenden.
Graf Bernstorff, Staatsminister in dänischen Diensten, der aus dem Harz stammte, war nicht nur ein politischer Kopf, sondern auch ein kultureller. Er zog eine Reihe von namhaften Gelehrten, Künstlern und Schriftstellern nach Kopenhagen, die untereinander befreundet waren oder wurden. Claudius sah sich bald einbezogen, durch Gerstenbergs Fürsprache wahrscheinlich, und lernte Klopstock kennen, der als geistiger Mittelpunkt der ganzen Kolonie allseits verehrt wurde. Auch gesellschaftlichen Vergnügungen wie dem ›Schrittschuhlaufen‹ (sic!) im Winter war der Meister durchaus zugetan. Und nun was das Schrittschuhlaufen anlangt, schreibt Claudius im Februar 1767, längst wieder zurück in Reinfeld, an den Freund Schönborn in Kopenhagen, so ist es mir lieb, dass der Großmeister (Klopstock) und seine Gesellen gesund sind und Eis haben (Br. 33).
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803)
Der Kontakt zu Klopstock ist über Jahrzehnte nie abgerissen, der berühmte Dichter kam zu Besuch nach Wandsbeck, übernahm Patenehren, und Claudius sollte noch 1803 an seiner feierlichen Beerdigung teilnehmen, von der er seiner Tochter Anna berichtet: Klopstock ist endlich gestorben und den 22. März mit viel Gepränge und viel Teilnahme in Offensen bei seiner ersten Frau begraben worden. 75 Kutschen mit Ministern, Ratsherren und aller Art Leuten aus Hamburg und 50 mit dito aus Altona folgten dem Leichenwagen. Alle Wachen, wo wir vorbeikamen, traten ins Gewehr, auch war Infanterie und Kavallerie bei dem Zuge (Fambr. 65).
Zum Herbst 1764 kam Gottlob Friedrich Ernst Schönborn nach Kopenhagen, den Claudius in Reinfeld kennen gelernt hatte, als er unschlüssig und antriebsschwach im väterlichen Pfarrhaus saß. Schönborn war Hauslehrer in der Nachbarschaft gewesen und hatte, als geistig umtriebiger Mensch, zum jüngeren Claudius eine aufrichtige Zuneigung gefasst. Er hielt zu ihm und erweiterte dessen Horizont, machte ihn mit Shakespeares Dramen und mit Klopstocks Versen bekannt und lieferte philosophische und künstlerische Anregungen. Auf dem Gut des Grafen Bernstorff, wo sich die deutsche Intelligenz von Kopenhagen traf, war Schönborn zweifellos in seinem Element.
Claudius war ebenfalls dabei und nahm sich zurück. Aber er profitierte von den Begegnungen, die er in Kopenhagen machen konnte, und sammelte seine Eindrücke. Noch weit davon entfernt zu ahnen, dass die geistige Atmosphäre, in die er nun eingetreten war, für ihn selbst einmal lebensbestimmend werden sollte, genoss er die Kontakte, die sich ergaben, und den Austausch von Ideen, dem er beiwohnen durfte. Doch diese Zeit der Hospitation im höfischen Kulturmilieu war begrenzt. Die Sekretärsstelle beim Grafen Holstein, die seine Gegenwart in Kopenhagen rechtfertigte, lief aus. Zugesagt hatte sie ihm ohnehin nicht, auch weil der Graf ihn mit einiger Herablassung zu behandeln pflegte. Plötzlich, nach anderthalb Jahren, nimmt Claudius seinen Abschied, verlässt die dänische Residenzstadt und klopft erneut an die Tür des Pfarrhauses in Reinfeld.
Klage und Hoffnung: ›An – als ihm die – starb‹
Der Säemann säet den Samen,
Die Erde empfängt ihn, und über ein kleines
Keimet die Blume herauf–
Du liebtest sie. Was auch dies Leben
Sonst für Gewinn hat, war klein Dir geachtet,
Und sie entschlummerte Dir!
Was weinest du neben dem Grabe
Und hebst die Hände zur Wolke des Todes
Und der Verwesung empor?
Wie Gras auf dem Felde sind Menschen
Dahin, wie Blätter! Nur wenige Tage
Gehn wir verkleidet einher!
Der Adler besuchet die Erde,
Doch säumt nicht, schüttelt vom Flügel den Staub, und Kehret zur Sonne zurück!
Das Gedicht hebt an wie ein biblisches Gleichnis und wie ein Gesang aus der Feder Klopstocks zugleich. Mit beidem zeigt es sich verbunden und konnte darum 1777 bei der ersten Veröffentlichung im ›Almanach der deutschen Musen‹ auch irrtümlich Klopstock selbst zugeschrieben werden.
So wenig dem Lied die religiöse Komponente fehlt, so wenig wird sie doch hervorgehoben. Sie erscheint mehr in Anspielungen, in den Bildern und im Sprachgebrauch. Schon der Eingangsvers – Der Säemann säet den Samen – erinnert an Luthers Übersetzung des Sämannsgleichnisses aus Matthäus 13. Die Formulierung über ein kleines zitiert Johannes 14,19, und mit den Menschen, die wie Gras auf dem Felde erscheinen, wird in den gedanklichen und atmosphärischen Kontext der Psalmen 90 und 103,15f versetzt. Wenn am Schluss des Gedichts ein ausdrücklicher Hinweis auf christliche, den Tod und mögliche Todesüberwindung betreffende Inhalte vermieden wird, heißt dies also nicht, dass von einer biblisch begründeten Gesamtorientierung nichts zu spüren wäre. Sie bildet den zitatweise angedeuteten Horizont, in dem sich das Ganze bewegt.
Und innerhalb dieses Horizontes entsteht nun der Raum, der eine nüchterne, geradezu illusionslose Meditation menschlicher Todverfallenheit erlaubt. Das fängt an mit dem Bindestrich am Ende der ersten Strophe. Der Bindestrich markiert in der Poesie gern eine Zäsur im rhythmischen Ablauf. Hier markiert er die unvermeidliche Zäsur im Ablauf des Lebens. Mit dem Bindestrich bricht der Vers und mit dem Vers das darin bezeichnete Leben ab. Same, Wachstum, Blüte – und dann der Schnitt, ohne dass der Dichter diesem radikalen Schnitt einen sprachlichen Ausdruck geben müsste. Der plötzliche Abbruch in Gestalt des Gedankenstrichs wirkt wie die Sense des Schnitters, die mit rascher und roher Gewalt das blühende Leben der Blumen vernichtet.
Die vierte Strophe nimmt das Motiv vom zeitlich befristeten Blühen des Lebens wieder auf. Ganz im Sinne von Psalm 90 oder auch von Jesaja 40,6f wird die in Strophe 1 gewählte Metapher nun in Strophe 4 ausgeführt: wie Gras, wie Blumen, wie Blätter sind die Menschen! Nur wenige Tage sind ihnen beschieden – und darauf folgt nun eine Kennzeichnung, die dem Dichter kaum zufällig in die Feder geflossen ist: Wir gehen verkleidet einher. Nicht farbig und prächtig bekleidet, sondern ausdrücklich verkleidet. Verkleidung aber betrifft eine Äußerlichkeit, die mit dem inneren Wesen durchaus nicht übereinstimmt. Wo Verkleidung geschieht, bleibt gerade verborgen, was sich darunter befindet. Das hat einen platonischen Anklang, wonach die unsterbliche Seele von einem sterblichen Leib überkleidet erscheint, dürfte aber auch an die bei Paulus begegnende Metaphorik vom ›Entkleiden‹ und vom ›Überkleiden‹ erinnern. Sie findet sich in 1. Korinther 15 und in 2. Korinther 5 als plastische Illustration seiner Auferstehungshoffnung. Trotz aller Nüchternheit dem Todesschicksal gegenüber erkennt Paulus – im Christusgeschehen – eine Grundlage zu der Hoffnung, dass wir »nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf dass das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben« (2. Korinther 5,4).
In der letzten Strophe wird nicht dieses Bild fortgeführt, wohl aber betritt nun der Adler die Szene. Im Bildprogramm des Gedichts hatte er vorher keinen Platz. Aber der Adler kommt keineswegs zufällig ins Bild. Er ist ja nicht allein Symbol für Stärke und Lebenskraft Er ist ebenso – und darauf zielt der Schlussvers des Gedichts – ein Symbol für die Verbindung von Erde und Himmel, von Zeitlichem und Ewigem. Er besuchet die Erde, ohne ihr verhaftet zu sein. Seine Heimat ist die Sonne, das ewige Licht des Lebens, und deshalb ist sein Weg immer von der Rückkehr bestimmt zu einem Raum jenseits aller irdischen Räume und zu einer Zeit, die nicht durch Sterben und Tod begrenzt sein kann. Indem der Dichter dieses Bild vom aufsteigenden Adler wählt, berührt er das Thema möglicher Hoffnung im Angesicht des Todes. Aber er unterlässt es, dieser Hoffnung einen traditionell christlichen Anstrich zu verleihen.
Das Gedicht hat einen Adressaten. Im Titel, der wohl später hinzugefügt wurde, heißt es: An … Und die zweite und dritte Strophe wenden sich an ein Du. Möglicherweise ist damit der eigene Schwager gemeint, der 1766 den frühen Tod seiner jungen Frau, Claudius’ Schwester Dorothea Christine, zu beklagen hatte. Mit Bestimmtheit ist das aber nicht festzustellen. Das Gedicht lebt ja auch nicht vom familiären Kasus, sondern von der Übertragbarkeit. Es stellt sich an die Seite des Trauernden überhaupt. Und es führt ihn behutsam auf einen Weg zur Anerkennung des anscheinend Unerträglichen. Bei dieser Anerkennung wird nichts geschönt, was nicht schön und leicht sein kann. Der Tod ist es nicht, erst recht nicht der unerwartet plötzliche. Aber selbst die bestürzende Todeserfahrung erzwingt keine ausweglose Verzweiflung. Es wird möglich, dem Tod zu begegnen wie einem Schnitter, der die Sense gewaltig an den Halm legt. Und zugleich aufzuschauen, um dem Flug des Adlers zu folgen, der aufsteigt von der Erde, direkt in den Glanz der ewigen Sonne hinein.