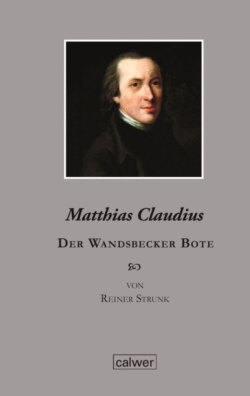Читать книгу Matthias Claudius - Reiner Strunk - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKindheit, Schule, Studium
Reinfeld, der Geburtsort des Dichters, liegt westlich von Lübeck am südlichen Rand der Holsteinischen Schweiz. Alte Beschaulichkeit zwischen Parks und Seen blieb nur in Restbeständen, ein ausgedehntes Gewerbegebiet ist heute der Ortsmitte mit der weiß getünchten Kirche vorgelagert, die Claudius’ Namen trägt. Im Übrigen wirbt man für die Kleinstadt mehr mit Karpfen (»Karpfenstadt«) als mit Claudius. Doch auch dies hat seine Geschichte. Unterhalb der Siedlung, wo sich in einem ausgedehnten, mit alten Bäumen bestandenen Gartengrundstück das evangelische Pastorat versteckt, hatten einst Zisterziensermönche neben ihrem Kloster einen Fischteich angelegt, mit den Ausmaßen eines respektablen Sees. Dieser ›Herrenteich‹ existiert noch, sein südlicher Teil trennt das Pastorat von Kirche und Ortszentrum und verschafft ihm eine Abgeschiedenheit, die an Claudius’ Kinderzeit erinnern mag.
Die älteste Ansicht von Reinfeld (um 1840)
Damals war das Pastorat, in dem sein Vater amtierte, dem größeren Schloss benachbart, das Anfang des 17. Jahrhunderts auf dem ehemaligen Klostergrund und mit dessen Baumaterial erstellt worden war. Im Besitz der dänischen Krone wurde das Schloss, das nicht mehr erhalten ist, infolge von Erbteilungen dem Herzogtum Plön zugeschlagen und zu Claudius’ Jugendzeit von der Herzoginwitwe Dorothea Christine bewohnt. Sie muss eine warmherzige, mütterliche Person gewesen sein, die einen regen Austausch mit der benachbarten Pfarrfamilie pflegte, an manchen Stellen Hilfe leistete und auch Patenschaften zwischen Schloss und Pfarrhaus stiftete. Die Kinder werden am See und im weitläufigen Pfarrgarten ebenso gespielt haben wie in den Anlagen des Schlosses. Und es ist anzunehmen, dass mit diesen Kindheitserfahrungen sich bei Claudius eine nahezu selbstverständliche Vorliebe für die Fürstenherrschaft herausbilden konnte, die er sein Leben lang beibehalten hat. Auch als es später, im Zuge der Französischen Revolution und ihrer Folgen, bei leidenschaftlichen Debatten um die angemessene und gerechte Staatsform ging, hat Claudius immer mit erstaunlicher Beharrlichkeit auf die Karte der integeren fürstlichen Persönlichkeit gesetzt. Er war keineswegs so naiv zu meinen, sie sei überall und in jedem Fall gewährleistet. Aber er hat seine Überzeugung bewahrt, dass Missstände durch mutige Appelle an Ehre und Gewissen der Fürsten beseitigt und gerechte Herrschaftsverhältnisse durch diese selbst wiederhergestellt werden könnten. Man gewinnt bei solchen, in seinen vorgerückten Jahren auch recht pathetisch vorgetragenen Stellungnahmen den Eindruck, es scheine bei allen Schilderungen der edlen, sogar liebevollen Fürstenpersönlichkeit das Kindheitsvorbild der Herzoginwitwe aus dem Reinfelder Schloss hindurch.
Im Milieu von Pastorat und Schloss und umgeben vom parkähnlichen Garten und ruhigem See ist Claudius also aufgewachsen. Das Pfarrhaus, in das sein Vater 1729 eingezogen und in dem er selbst 1740 geboren worden war, ist allerdings nicht mehr erhalten. Der nachfolgende Pastor hatte an derselben Stelle 1782 einen Neubau ins Werk gesetzt, weil ihm die »verfallene, düsterne Hütte« als unzumutbar erschienen war.
Der Vater Claudius, ebenfalls Matthias mit Vornamen, stand bereits in einer Generationenfolge von Pastoren und ging wie selbstverständlich davon aus, dass auch seine Söhne Josias und Matthias das geistliche Amt weiterführen würden. Bis ins 16. Jahrhundert hinein ist die Linie der Claudius-Pastoren in Schleswig-Holstein zu verfolgen. Vom ersten in dieser Ahnenreihe lutherischer Prediger wurde der Name Claudius angenommen. Claus Paulsen (1571–1639) wertete nach akademischem Brauch seinen Namen latinisierend auf, so dass ein Claudius Pauli daraus wurde. Bereits seine Söhne entschieden sich für den Familiennamen Claudius, der nachher fortbestehen sollte.
»Anno 1740 ist mein Sohn Matthias d. 15 august des abends um halb Elff Uhr gebohren«, hielt Vater Claudius in seiner Familienbibel fest.9 Er war nach dem Tod seiner Ehefrau Lucia Magdalena Hoe, die zwei Söhne geboren und 1737 früh verstorben war, in zweiter Ehe seit 1738 mit Maria Lorck verheiratet, einer Ratsherrentochter aus Flensburg. Neben den allgemeinen Pfarramtsgeschäften beteiligte er sich an der Unterrichtung seiner Kinder. Nach Matthias wurden im Reinfelder Pastorat noch sechs weitere Kinder geboren, von denen drei 1751 in kurzer Folge nacheinander an einer Epidemie starben, für Matthias Claudius die erste schmerzlich verstörende Begegnung mit dem Tod, die sein Leben lang nachwirkte und einen erheblichen Einfluss auf seine Gesamthaltung dem Sterben und dem Tod gegenüber gewinnen sollte.
Nach Abschluss des Elementarunterrichts in Reinfeld, der insbesondere biblische Grundkenntnisse vermittelt hatte, besuchte Matthias die Lateinschule in Plön, gemeinsam mit dem älteren Bruder Josias. Die ›Öffentliche Evangelisch-Luthersche Lateinische, auch Schreib- und Rechenschule‹ in Plön, der Residenzstadt auf einer Landenge zwischen zwei Seen, verdankte sich einer Stiftung, die erst seit ein paar Jahrzehnten bestand und über kein eigenes zentrales Schulgebäude verfügte. Der Unterricht sowie die Unterkunft für auswärtige Schüler erfolgte in mehreren Häusern des Orts, in denen die Brüder Claudius vier Jahre lang verkehrten. Ihr Schulrektor Alberti muss ein Pädagoge von eigenwilligem Zuschnitt gewesen sein, streng in den Anforderungen an die Schüler, dagegen nachlässig in der Wahrung seiner amtlichen Formen. Es kam vor, dass er seine Unterrichtsstunden mit der Schlafmütze auf dem Kopf und mit Pantinen an den Füßen abhielt, und Claudius hat später diesem Kauz mit seiner Figur des ›Rektor Ahrens‹ ein parodistisches Andenken bewahrt, z.B. 1774 im ›Wandsbecker Bothen‹ mit einer skurrilen Korrespondenz. Da ersucht Ahrens den Boten mit gestelzten Wendungen und mit zahlreich eingestreuten lateinischen Brocken um die Lieferung eines Kurzgedichts aus delikatem Anlass: Ein vornehmer Herr mit schöner Gemahlin werde nämlich von einem zweiten vornehmen Herrn um eben dieser schönen Frau willen häufig besucht und möchte, ebenso dezent wie deutlich, dem unerwünschten Nebenbuhler einen Denkzettel verpassen. Und nun habe er, Rektor Ahrens, sich an den Schüler Claudius erinnert und an seine Gaben »im Poetisieren« und bitte ihn um ein paar Verse zur besagten Situation. Nur »fein« müsse es ausfallen, denn die vornehmen Herren könnten »die Wahrheit nicht geradezu leiden«. Unter N.S. fügt er hinzu, der Name des betreffenden Herrn fange mit A. an. Claudius zeigt sich behilflich und liefert dem Rektor unter dem Titel ›Asmodi‹ (Synonym für Teufel) den Vierzeiler:
Asmodius der Bösewicht
Sät Eifersucht und Zweifel.
Ach! Herr Asmodi, tu Er’s nicht,
Und scher Er sich zum T- (873).
Zu Ostern 1759 fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Das Pflichtprogramm der Lateinschule ist erledigt, jetzt locken die Weite und die Freiheit des Universitätslebens im entfernten Jena. Matthias bricht dorthin auf, wieder zusammen mit dem Bruder Josias und beide beginnen ein Theologiestudium, um nachher als Pfarrer tätig werden zu können. So bestimmte es seit Generationen die Ordnung in der Claudius-Familie, und es fehlte jedes Anzeichen, dass die beiden Söhne davon abweichen könnten. Doch es kam anders.
Josias starb, bevor er sein Studium beenden konnte. Und Matthias brach seine theologische Ausbildung plötzlich ab. Ausschlaggebend dafür waren gewiss keine schwer wiegenden Irritationen im Glauben. Sie sind ihm zeit seines Lebens erspart geblieben. Eher schon dürfte ihm der Lehrbetrieb an der theologischen Fakultät missfallen haben. Und vermutlich hat auch der tiefe Respekt vor dem geistlichen Amt dazu beigetragen, dass Claudius sich dieser Aufgabe umso weniger stellen mochte, je näher und bedrängender sie ihm auf den Leib rückte.
Indiz dafür sind briefliche Mitteilungen an seinen eigenen Sohn Johannes, als der sich anschickte, aus dem erlernten Beruf eines Kaufmanns auszusteigen und mit dem Theologiestudium zu beginnen. Bei diesen väterlichen Mahnungen, am 12. September 1799 formuliert, handelt es sich natürlich um späte Äußerungen des Dichters, die nicht ohne weiteres in die Geisteshaltung seiner eigenen Studienzeit zurückprojiziert werden können. Und doch verraten sie Grundeinstellungen, von denen angenommen werden darf, dass sie auch schon für den jungen Claudius gültig waren.
Zunächst verwundert schon, dass Claudius den Entschluss seines Sohnes zum Pfarrberuf keineswegs mit freudiger Zustimmung zur Kenntnis nimmt. Seine Reaktion strotzt vielmehr vor Bedenken und Einwänden. In sieben Punkten listet er sie auf. Und am Schluss, wenn alle praktischen Vorbehalte, die er zusammengetragen hat, nicht fruchten sollten und der gelernte Kaufmann nach Ansicht des Vaters etwas Besseres und Edleres begehrt und insbesondere einen ernstlichen Trieb hätte, als Theologe Gutes in der Welt zu schaffen, dann wolle er sich mit dessen Berufswahl abfinden; allerdings nicht, ohne ihm eine nochmalige Selbstprüfung dringend ans Herz zu legen: Nun prüfe, überlege und bitte Gott, dass er Dich das Beste wählen lässt. Auf alle Fälle aber musst Du Deines Ernstes sicher sein (Fambr. 44). Ein derartiges Maß an beschwörender Warnung vor einer womöglich leichtfertigen Entscheidung zum Pfarramt wird nur auf dem Hintergrund seines eigenen Weges während der Studienzeit in Jena verständlich. Es ist ja nicht die Sorge um die intellektuellen Fähigkeiten des Sohnes, die Claudius umtreibt. Erst recht sind keine Einwände gegen Kirche und Christentum im Spiel, die ihm völlig fern gelegen haben. Bleibt eigentlich nur der hohe Anspruch an das Pfarramt selbst und ein daraus resultierender übersteigerter Respekt, der den Vater beim erklärten Berufswunsch seines Sohnes wieder einholt, wie er vor Jahrzehnten schon seinen eigenen Eintritt ins Pfarramt verhindert haben mochte. Die Selbstverständlichkeit, mit der in der Claudius-Familie das pastorale Amt vererbt wurde, war durch ihn und für ihn gebrochen. An ihre Stelle war die Frage nach dem persönlichen Ernst getreten. Die Latte wurde also hoch gelegt, und es bedurfte eingehender Prüfungen, um herauszufinden, ob sie wirklich zu überspringen oder ob es ratsam wäre, sie in einem Bogen zu umgehen. Für Claudius selbst endete der Klärungsprozess mit dem Verzicht aufs Pfarramt und mit dem Abbruch des Theologiestudiums; beides nicht aus mangelnder Loyalität gegenüber der Aufgabe, die die Familientradition prägte, sondern mehr aus Sorge, ihr persönlich nicht in der gebotenen Weise entsprechen zu können.
Die Jahre in Jena wurden Jahre der Orientierung, ohne klare, zukunftsfähige Ziele zu erreichen. Der Spagat zwischen den beiden theologischen Grundrichtungen, die an der Fakultät miteinander im Streit lagen, dem orthodoxen Luthertum und dem theologischen Rationalismus, konnte auf die Dauer kaum durchgehalten werden, und die Entscheidung für eine dieser Richtungen mochte Claudius offenbar auch nicht treffen. Ersichtlich wohler fühlte er sich bald in einem akademischen Nebenprogramm, das auf einen studentischen Tummelplatz für Literatur und Poesie einlud. Er beteiligte sich an der ›Teutschen Gesellschaft‹ in Jena, kam dabei erstmals mit jungen Literaten in Berührung und konnte sich in eigenen poetischen Stücken versuchen. Dies scheint ihm Appetit gemacht und für die Folgezeit eine wichtige, ihm selbst vorläufig noch verborgene Spur gelegt zu haben.
In der ›Teutschen Gesellschaft‹ ging es um Sprachpflege und Literaturkritik. Man traf sich an Samstagen, befasste sich mit zeitgenössischer Dichtung, mit Gleim und Klopstock, der gerade dabei war, den ersten Band seines ›Messias‹ herauszugeben. Man las und besprach Gedichte, namentlich solche aus eigener Feder, betrieb deutsche Grammatik, begab sich aufs Feld der Rhetorik und der Semantik und schwärmte für poetische Bilder und Szenen, die aus dem Staub der akademischen Gelehrsamkeit herausführten in entfernte arkadische Landschaften und zu Liebesidyllen unter blühenden Bäumen und südlicher Sonne. Die betreffende poetische Richtung heißt ›Anakreontik‹, benannt nach dem altgriechischen Lyriker Anakreon aus dem 6. Jahrhundert v. Chr., der ein Meister des poetischen Spiels um Liebe, Wein, Hirtenromantik und heitere Festlichkeit und zur Zeit als literarisches Vorbild wieder stark in Mode gekommen war. Gleim lag völlig auf dieser Linie, ebenso Hagedorn, den man in der ›Teutschen Gesellschaft‹ schätzte, und einer der Studierenden brachte es sogar selber zu einer frühen Publikation von anakreontischen Versen: Heinrich Wilhelm von Gerstenberg. Der war 1759 gerade noch in der ›Teutschen Gesellschaft‹ vertreten, als Claudius nach Jena kam, und veröffentlichte seine ›Tändeleyen‹ im selben Jahr.
Claudius hat diesen Jurastudenten mit poetischer Begabung in Jena nur noch flüchtig, seine literarischen Produkte dagegen intensiv kennen gelernt und bewundert, und der erste Brief, der von ihm erhalten ist, richtet sich mit Datum vom 18. Oktober 1761 an Gerstenberg. Darin bittet Claudius ihn um neue Gedichte, da es eine große Wollust sei, solche Tändeleien zu lesen (Br. 13), und er versichert ihn mit der größesten Hochachtung und Zärtlichkeit seiner Freundschaft.
Ein Jahr darauf, im Oktober 1762, kann er seinem verehrten Vorbild von Reinfeld her die briefliche Mitteilung machen: Ich habe auch Tandeleien gemacht, Tandeleien, denn ich wusste nicht, wie ich sie anders nennen sollte (Br. 16). Und in der Tat hat er sie nicht bloß gemacht, sondern auch veröffentlicht. Eine Sammlung mehr oder weniger frivoler Liebeslieder, die sich anakreontischer Vorlagen bediente und Gerstenbergs Gedichte in einem Maß nachahmte, dass der Plagiatsverdacht nicht nur in der Luft lag, sondern in Rezensionen auch deutlich angesprochen wurde. Gerstenberg hat seinem munteren Gefolgsmann, der sich in unschuldiger Offenheit selbst als solcher ausgegeben hatte, großmütig verziehen, und die beiden haben eine gute und lange Freundschaft zueinander entwickelt.
Das tragische Erlebnis in der Jenaer Studienzeit war für Claudius der Tod seines Bruders Josias. Nach einer Pockenerkrankung, die Matthias ebenfalls kurz zuvor befallen hatte, starb der Bruder am 19. November 1760. Die Trauer saß tief, aber zur Trauer blieb eigentlich keine Zeit. Der überlebende Bruder hatte für die Umstände der Bestattung Sorge zu tragen, namentlich im Hinblick auf das akademische Zeremoniell. Da waren die hohen Herren der Universität versammelt, der Rector magnificus persönlich, dazu die Professoren der Fakultät und die Studenten. Vom Bruder des Verstorbenen wurde eine Rede erwartet, keine persönliche, die der Trauer hätte Raum geben können; sondern eine gelehrte Abhandlung über Sterben und Tod. Man muss sich das vorstellen: ein junger Mensch, kaum der Kindheit entwachsen, fern von daheim, allein gelassen mit der unsäglichen Aufgabe, am Sarg des eigenen Bruders Gescheites für die kritischen Ohren der akademischen Lehrer zu sagen! Wo er hätte heulen und sich in seinem Schmerz verkriechen oder einfach davonlaufen mögen, musste er rhetorische und moraltheologische und metaphysische Klimmzüge vollführen und nach Erklärungen suchen für das Unerklärliche. Nachher sollte das Ganze auch noch gedruckt werden. Es wurde seine erste Publikation, und schon der formalistische Titel vermittelt einen Eindruck von der grotesken Situation, in die Claudius da hineingeraten war, und von der gelehrsamen Farce, zu der er genötigt wurde. Der Titel lautete: ›Ob und wie weit Gott den Tod der Menschen bestimme, bey der Gruft seines geliebtesten Bruders Herrn Josias Claudius der Gottesgelahrtheit rühmlichst Beflissenen welcher zu Jena den 19ten des Wintermonats 1760 seelig verschied von M. Claudius, der teutschen Gesellschaft zu Jena ordentlichen Mitgliede‹.
Wie anders klingen da die Zeilen, die der junge Claudius als unmittelbaren Ausdruck seiner Trauer schrieb:
Ich mag heut nicht im Dichterschmuck erscheinen,
Mein Lied sei traurig, wie mein Herz!
O lieber Leser, höre meinen Schmerz
Und habe Lust, mit mir zu weinen … (725).
Mit seinem Bruder Josias nahm Claudius in Jena auch von der Theologie Abschied. Eine innere Nähe zum Poetischen ist ihm aufgegangen, aber zu einer beruflichen Orientierung hat das noch nicht gereicht. Also suchte er weiter. In Jena zunächst unter dem wissenschaftlichen Angebot verschiedener Fakultäten. Er hörte dies und studierte das, einigermaßen zufällig, wie es scheint. Etwas Staatsrecht und ein bisschen Philosophie, auch Geschichte, Völkerrecht, Kameralistik. Nirgendwo ging er bleibend vor Anker und nichts brachte er zu Ende. 1762 packte er seine Sachen zusammen und kehrte ohne Examen dorthin zurück, wo er zu Hause war, seiner Herkunft und seinen innigsten Gefühlen nach. Die akademische Laufbahn war Stückwerk, und seine Orientierungsversuche waren nicht gerade befriedigend verlaufen10. Daheim in Reinfeld, unter dem guten und geduldigen elterlichen Dach, blieb Zeit, sich umzusehen, wohin der weitere Weg führen sollte.
9 Claudius, Matthias 1740–1815. Ausstellungskatalog zum 250. Geburtstag, Heide i. H. 1990, S. 51.
10 Gleichwohl verwendet A. Kranefuss sich dafür, Claudius nicht als ›Studienabbrecher‹ zu bezeichnen: »Für die Mehrzahl der Studierenden war ein Universitätsbesuch ohne Graduierung die Regel«, Kranefuss, Annelen: Matthias Claudius, Hamburg 2011, S. 32.