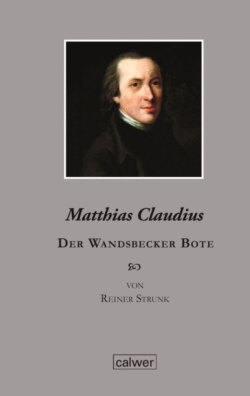Читать книгу Matthias Claudius - Reiner Strunk - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеRedakteur in Hamburg
Erneut verbringt Claudius einige Jahre (1765–1768) im Reinfelder Elternhaus. Es wird für ihn eine stille Phase, Inkubationszeit sozusagen, die der gemächlich sich entwickelnde junge Mann offenbar brauchte, um seine Talente auszubilden und den künftigen Weg vorzubereiten. Kontakte nach Kopenhagen zu Gerstenberg und Schönborn erhält er aufrecht, und die geistigen Anregungen, die er dort gefunden hatte, wirken nach. Er beschäftigt sich mit Literatur, macht Ausflüge in die Philosophie zu Spinoza, zu Newton und schult seine Kenntnisse in Fremdsprachen. Darin erreicht er eine Fertigkeit, die er später zu Übersetzungen nutzen konnte, vor allem von Werken aus dem Französischen und Englischen. Das kam seinen Interessen entgegen und erbrachte willkommene Nebeneinkünfte. Im Lauf der Jahre hat er die ›Apologie des Sokrates‹ aus dem Griechischen übertragen, Terrassons Roman ›Sethos‹, der den Stoff für Mozarts ›Zauberflöte‹ hergeben sollte, aus dem Französischen, ebenso Saint Martins ›Irrtümer und Wahrheit‹ und Fénelons ›Werke religiösen Inhalts‹.
Die Voraussetzungen dafür erlangte er in seinen privaten Studien während dieser Reinfelder Jahre. Ein klares Konzept zur Berufsausübung stand nicht dahinter, aber die Neigungen klärten sich. Die Welt der Kaufleute, der Verwaltungen und Finanzen zog ihn nicht an, er liebte die andere Welt des Geistes und der Literatur. Und ebenfalls die Musik! Bald macht er in Hamburg die Bekanntschaft Carl Philipp Emanuel Bachs, von dessen Kompositionen er begeistert ist und dessen Klavierspiel er rühmt. Und Bach soll sich auch, als ich etwas spielte, recht wohlwollend geäußert und bemerkt haben, er spiele mit Leib und Seele (Br. 44). Da verwundert es nicht, dass Claudius, der auch das Orgelspiel beherrschte, die Reinfelder Beschaulichkeit beinahe abgebrochen hätte, um eine Organistenstelle in Lübeck zu übernehmen, im Herbst 1765. Beworben hat er sich für die Aufgabe, übernommen hat er sie nicht. Dabei scheint er nicht einmal abgelehnt worden zu sein. A.M. Sprickmanns Wiedergabe der Angelegenheit hat einige Wahrscheinlichkeit für sich, auch wenn dieser Gewährsmann aus dem Kreis des ›Göttinger Hains‹ zu schönen Übertreibungen neigte. Claudius habe es in Lübeck gar nicht zur Vorstellung seiner Künste kommen lassen, berichtet er. Ihm sei mitgeteilt worden, dass neben ihm – und zwar pro forma – weitere Kandidaten für die Organistenstelle bereit stünden, und er sei hingegangen und habe sich einen von ihnen angehört. Im Anschluss habe er sich an den Magistrat gewandt und erklärt, der Konkurrent verdiene die Stelle mehr als er selber, habe sich höflich bedankt und sei gegangen.11 Ob das nun anekdotisch oder historisch ist: Es entspricht Matthias Claudius vollkommen, und zwar seinem Sinn für künstlerische Meisterschaft ebenso wie seiner Hemmung, solche Meisterschaft für sich selbst in Anspruch zu nehmen.
Und noch etwas: Der melancholische Zug, der in seinen Reinfelder Tagen vor dem Wechsel nach Kopenhagen zu beobachten war, ist jetzt einer vorwiegend heiteren Stimmung gewichen. In köstlichen Wendungen kann er sich brieflich über den Magister Jakob Friedrich Schmidt äußern, mit dem er seit Jenaer Studententagen befreundet war. An Schönborn schreibt er im September 1766, er sei von Schmidt und dessen Braut nach Lübeck eingeladen worden: Ich habe also 12 Stunden seiner Liebe zugesehen, die in der Tat etwas edler sein muss, weil seine Frau nichts hat und gar nicht schön ist, und in Celle, wo er Prediger ist, schöne Mädchen sein sollen (Br. 31). Später kolportiert er: Magister Schmidt lässt sich ein Kind nach dem andern gebähren (Br. 60). Dies Letztere sollte er selbst freilich in absehbarer Zeit überhaupt nicht anders halten, vorläufig allerdings war kein Denken daran. Er nahm sich Zeit, ließ wie beiläufig seine Möglichkeiten reifen und erwartete gelassen, was sich ergeben würde.
Und was sich plötzlich ergab, war der Sprung aus der ländlichen Abgeschiedenheit in die hanseatische Großstadt. Anfang 1768 geriet er nun doch mitten in die Welt der Kaufleute, des Handels und der Finanzen hinein, die wahrhaftig nicht seine Traumwelt war. Als Redakteur mochte ihm zwar der günstige Anschluss vorschweben ans literarische Metier, aber die ›Addreß-Comtoir-Nachrichten‹, bei denen er eine Anstellung fand, waren ein lokales Handelsblatt mit vielen Zahlen und Informationen für die Geschäftswelt. Hier ging es in erster Linie um Verordnungen und Wechselkurse und Handelsberichte. Allerdings nicht ausschließlich. Das Blatt lieferte neben den wirtschaftlichen auch gesellschaftliche Nachrichten und riskierte sogar Beiträge zum kulturellen Leben und zum Schöngeistigen. Vermutlich hat diese Seite Claudius bewogen, die Stelle anzutreten, die ihm wohl durch die Kopenhagener Freunde (der Verleger Leisching war Klopstocks Vetter) nahe gebracht wurde. Tatsächlich sollte seine Hauptaufgabe aber darin bestehen, die eingehenden vermischten Nachrichten redaktionell aufzubereiten. Seine Vergütung war kläglich, und Claudius schreibt kurz nach der Übersiedelung nach Hamburg an Gerstenberg:
Rathaus und Börsenplatz von Hamburg um 1760
Ich habe mir eine Stube auf 4 Wochen gemietet, das traurigste dabei ist, dass ich täglich mit Lebensgefahr zu einem Nachtstuhl im Keller hinabsinken muss (Br. 39).
Immerhin lernte er bei den Hamburger ›Addreß-Comtoir-Nachrichten‹ das journalistische Handwerk. Berichte zu verfassen, Rezensionen zu schreiben, mit leichter Feder auch schwierige Zusammenhänge darzustellen, das wurde jetzt verlangt von ihm und darin brachte er es rasch zu beachtlichen Erfolgen. Die Aufgabe des Journalisten hat seinen Stil geformt, und Claudius hat diesen Stil im Wesentlichen beibehalten. Wo er nicht als Lyriker in Erscheinung trat, war er Journalist. Was wichtig zu sein beanspruchte, musste für ihn auch allgemein verständlich werden. Darum bevorzugte er die Umwege, suchte für Theoretisches anschauliche Bilder, arbeitete mit fiktiven Szenen und mit Gleichnissen, um einen komplizierten Gegenstand vorzustellen. Die Lektüre seiner Texte sollte nicht allein Kenntnisse vermitteln oder Leser bilden, sie sollte auch angenehm unterhalten. Heitere und satirische Momente kommen deshalb in seinem gesamten Schrifttum nicht zu kurz. Mit der journalistischen Aufgabe in Hamburg hatte er endlich den Schlüssel gefunden, der ihm die Welt erschloss und sein Lebenswerk einleitete.
Neben Bach machte Claudius in Hamburg eine zweite bedeutende Bekanntschaft: mit Gotthold Ephraim Lessing. Dass beide miteinander in Berührung kamen, war nicht überraschend bei der Profession des einen als Dramaturg am jüngst gegründeten Nationaltheater und der Zuständigkeit des anderen für die Berichterstattung von Theateraufführungen. Überraschend war nur, dass sie miteinander auskamen, und mehr als das: sich gegenseitig schätzten. Der kritische, weltgewandte Geist mit dem beißenden Urteil auf der einen Seite und der kaum seiner holsteinischen Provinz entrückte, vorsichtige, stets um Ausgleich und Verständigung bemühte junge Redakteur auf der anderen. Wenn Lessing Dir begegnet, kannst Du immer den Hut vor ihm abnehmen (752), lässt Claudius in seiner originellen Besprechung der ›Minna von Barnhelm‹ den begeisterten Theaterbesucher Fritz vermelden. Doch er selber sieht es genauso. Die anfänglich regen Kontakte, in die Carl Philipp Emanuel Bach, Nachfolger Telemanns als Hamburger Kirchenmusikdirektor, lebhaft einbezogen war, verloren sich zwar, als Lessing die Hamburger Bühne verließ (das ehrgeizige Experiment des Nationaltheaters war in kürzester Zeit gescheitert), um in Wolfenbüttel der herrschaftlichen Bibliothek vorzustehen; aber die Sympathien blieben erhalten. Dabei konnten ihre Positionen vor allem zu Fragen von Religion und Christentum kaum gegensätzlicher ausfallen. Lessing wies die Religion in ihre Schranken vor dem Forum der Vernunft. Claudius wies die Vernunft in ihre Schranken vor dem Forum der Religion. Eine sachliche Übereinstimmung war da kaum denkbar, aber zum Zerwürfnis ist es auch nicht gekommen.
Bezeichnend wirkt die Art und Weise, wie Claudius sich zum sogenannten ›Fragmentenstreit‹ verhielt, der in Hamburg gewaltig Staub aufwirbelte. Damals war Lessing, der im Zentrum der Auseinandersetzungen stand, nicht mehr in Hamburg und Claudius nicht mehr bei den Comtoir-Nachrichten. Er redigierte inzwischen den ›Wandsbecker Bothen‹. Lessing hatte nach und nach die kritischen Schriften eines ›Ungenannten‹ veröffentlicht, hinter dessen Maske sich der bereits verstorbene Hamburger Gymnasiallehrer Reimarus verbarg, dessen Anonymität Lessing übrigens bis zu seinem Tode nicht preisgegeben hat. In seinen Schriften hatte Reimarus die biblischen Überlieferungen einer schonungslosen historischen Kritik unterzogen. Vergleiche zwischen den Evangelien mit ihren unterschiedlichen Textfassungen wurden durchgeführt, um den Nachweis zu erbringen, dass es sich um menschliche Produkte und nicht um direkte Eingebungen des Heiligen Geistes handle. Widersprüche wurden aufgelistet, die Bezeugungen von der Auferstehung Jesu und vom leeren Grab in Frage gestellt. Das Ganze ergab eine explosive Mischung, die von Lessing ans Licht gebracht und zum Teil auch kommentiert wurde und die er, fein dosiert und deshalb umso wirksamer, in mehreren Lieferungen der erstaunten Leserschaft zumutete.
Claudius hat zu diesen Provokationen nicht geschwiegen. Er konnte und mochte ihnen freilich, von seiner eigenen Warte her, auch nicht applaudieren. Also wählte er einen Weg, der für ihn und sein Vorgehen charakteristisch ist: Er baute seine Stellungnahme zu Lessings Fragmenten-Edition in eine Dialogszene ein, die Audienz des Wandsbecker Boten beim Kaiser von Japan. Wir haben dieses literarische Kabinettstück bereits erwähnt und beschränken uns hier auf die Passage, die sich direkt auf Lessing bezieht.
Der Kaiser von Japan, der sich vielseitig interessiert zeigt an den kulturellen Verhältnissen in Europa, fragt den Boten, wie es dort mit den »Zweifeln gegen die Religion« stünde. Und der Bote antwortet: Herr Lessing hat noch ganz neuerlich in seinem vierten Beitrag verschiedene Zweifel eines Ungenannten bekannt gemacht, davon einige recht gelehrt und artig sind. Er hat sie aber widerlegt (138). Und weiter kleidet der Bote in ein Gleichnis, was er von Lessings Publikation der religionskritischen Reimarus-Fragmente hält. Der lasse nämlich die Zweifel mit Ober- und Untergewehr aufmarschieren und lade das Publikum ein: marschiert ihr dagegen! Und damit die gewappneten Zweifel auf keine Wehrlosen träfen, habe Lessing gleich jedem Zweifel einen Maulkorb umgetan beziehungsweise jedweden Zweifel ’n Felsstück mit scharfen Ecken in den Hals geworfen, daran zu nagen (139). Worauf der Kaiser erwidert: Herr Lessing gefällt mir.
Diese Wiedergabe der großen Kontroverse um die Reimarus-Schriften ist nicht ganz verfehlt, aber auch nicht ganz zutreffend. Vor allem erscheint sie geschönt. Denn Lessing ist keineswegs wie ein unerschrockener heiliger Georg aufgetreten, der dem Zähne fletschenden Drachen der Religionskritik das Maul gestopft hätte. Seine Sympathie für Reimarus und dessen Methode, die biblischen Urkunden mit historischer Skepsis zu beurteilen, war ungleich größer als sein Verständnis für die orthodoxen Verteidiger dogmatischer Besitzstände. Trotzdem hat Lessing den radikalen Ergebnissen seines ›Ungenannten‹ durchaus nicht generell Recht gegeben. Gerade den vierten Teil seiner Veröffentlichungen, auf den Claudius sich bezieht, hat Lessing mit einer Einleitung versehen, die sich deutliche Abstriche an den vorgetragenen Thesen erlaubt. Dass er sie – nach Claudius – samt und sonders widerlegt habe, ist zwar eine Übertreibung, aber nicht einfach aus der Luft gegriffen. Etwas später erklärt Lessing selbst: »Ich habe nirgends gesagt, dass ich die ganze Sache meines Ungenannten völlig so, wie sie liegt, für gut und wahr halte. Ich habe das nie gesagt; vielmehr habe ich gerade das Gegenteil gesagt.« In dieser ganzen Auseinandersetzung habe er nichts behauptet, »was mich dem Verdacht aussetzen könnte, ein heimlicher Feind der christlichen Religion zu sein«12.
Bemerkenswert ist, dass Claudius den folgenden, über Monate hin überaus scharf geführten Streit zwischen Lessing und dem Hamburger Hauptpastor Melchior Goeze nicht mehr kommentiert hat. Dabei ging es immer noch um die ›Fragmente eines Ungenannten‹ und um Lessings Rolle und Zielsetzung bei deren Herausgabe. Goeze war nicht zimperlich in seinen Anwürfen gegen den Wolfenbütteler Bibliothekar, den er für einen Freigeist und Religionsverächter hielt. Lessing aber gebärdete sich noch maßloser dem kämpferischen Lutheraner gegenüber und schreckte nicht davor zurück, ihn lächerlich zu machen. Eine Kostprobe für die ätzende Art seiner Entgegnungen: »Es ist erlaubt, Ihnen den Eimer faulen Wassers, in welchem Sie mich ersäufen wollen, tropfenweise auf den entblößten Scheitel fallen zu lassen.«13
Das Gefecht der beiden Kampfhähne hat Claudius zweifellos verfolgt, aber er hat dazu nicht Stellung genommen. Zum einen vermutlich, weil er sich über Goeze bereits ein paar Jahre vorher geäußert hatte, bei dessen Konflikt mit Alberti14. Schon damals war es ihm so gegangen, dass ihm die sachliche Position, die Goeze einnahm, durchaus nahe lag, dass er sich aber nicht auf dessen Seite schlagen mochte, weil ihm die rabiate Person nicht behagte. Zum andern vertrat er den Standpunkt, über Lessing hinreichend dargetan zu haben, was aus seinem Blickwinkel über ihn zu sagen war. Als Gleim 1781 nach Lessings Tod bei Claudius anklopfte, um ihn zu einem Beitrag zu dessen Bestattung zu bewegen, gab Claudius ihm die Antwort: Es ist mir auch Ihretwegen leid, dass Lessing gestorben ist, aber wegen eines Grabgesangs kann ich nichts zusagen. Ich kann über Lessing nicht anders sprechen, als ich vor dem Kaiser von Japan über ihn gesprochen habe, das ist, für und wider ihn zugleich, und ich weiß nicht, ob mir das in einem Grabgesang so recht geraten würde (Br. 307).
Außer mit Bach und Lessing durfte Claudius in Hamburg mit einer dritten Größe Bekanntschaft schließen, mit Johann Gottfried Herder. Es sollte eine geistige und auch sehr persönliche Freundschaft daraus werden, die lange Jahre anhielt und sich in wechselseitigen Besuchen und einer, wenigstens von Claudius Seite her intensiv gepflegten Korrespondenz niederschlug. Die Briefe an Herder sind erhalten geblieben, umgekehrt gingen Herders Briefe an Claudius leider verloren. Claudius bezeugt selbst in einem Schreiben an Herders Frau Karoline, 24. März 1804: Ich habe vor einigen Jahren, als einiger Schein zu etwanigen Heereszügen und Flucht war, meine Briefe verbrannt, auch die Herder und Hamann mir geschrieben hatten (Br. 436).
Herder, wenige Jahre jünger als Claudius, hatte Riga mit seiner dortigen Tätigkeit als Lehrer und Prediger den Rücken gekehrt und im Sommer 1767 eine umfängliche Reise angetreten. Von Frankreich aus, wo ihn der Auftrag erreichte, den Sohn des Herzogs von Holstein-Eutin als Hofmeister zu begleiten, macht er auf der Reise nach Kiel im März 1768 Station in Hamburg. Lessing vermittelt die Begegnung mit Claudius, und beide sind rasch füreinander eingenommen. Herders große Schriften wie die ›Abhandlung über den Ursprung der Sprache‹ oder ›Älteste Urkunde des Menschengeschlechts‹, die Claudius im ›Wandsbecker Bothen‹ enthusiastisch besprechen sollte, standen noch aus. Aber mit anderen Schriften zur Literatur, die angesichts der späteren, seinen Ruhm begründenden Werken mehr in den Hintergrund rückten, war er doch schon hervorgetreten und in den einschlägigen Kreisen von Kultur und Kunst ein bekannter Mann. Claudius hatte, als redaktioneller Anfänger in einem wirtschaftlichen Lokalblatt, nichts Vergleichbares zu bieten. Doch man verstand sich und mochte einander, und Herder verstieg sich sogar zu dem gewagten Urteil, der junge Claudius sei das »größte Genie«, das er in Hamburg angetroffen habe. Claudius wiederum ließ seiner Begeisterung für Herder in einem Brief an Gerstenberg freien Lauf: H. Herder ist hier seit 8 Tagen. Sie können denken, wie ich gehorcht habe, wenn er von Hamann erzählte, auch habe ich gehorcht, wenn er sonst etwas sprach. Er ist sehr lebhaft (Br.61). Wenig später sucht er ihn zur Mitarbeit beim Projekt des ›Wandsbecker Bothen‹ zu gewinnen, sogar mit Erfolg: Helfen Sie mir den Wechselbalg zur Welt bringen, schreibt er ihm, noch von Hamburg aus. Etwas Bedeutendes brauche er ihm nicht zur Verfügung zu stellen, nicht mal eine Rezension, nur etwas aus Ihrer eigenen Quelle, was und wie Sie wollen (Br. 71).
Johann Gottfried Herder (1744–1803)
Die Beziehung zwischen Claudius und Herder sollte im Lauf der Jahre nicht frei von Verstimmungen, später auch von Entfremdungen sein, und sie war für Claudius, seinen Weg und sein Denken, von weit größerer Bedeutung als für Herder. Dass man so lange freundschaftlich verbunden blieb, war nicht zuletzt den Frauen zu verdanken, Rebecca Claudius und Karoline Herder, die es immer wieder verstanden, Brücken zu schlagen, auszugleichen und die Kontakte aufrecht zu erhalten. Als Herder im Dezember 1803 in Weimar verstorben war, wandte sich Claudius Anfang 1804 in einem Brief an Karoline: Es sind nun über 30 Jahre, dass ich ihn zuerst sahe und lieb gewann. Ich hätte ihn gerne noch einmal gesprochen. Friede dem Entschlafenen! Er kommt nicht wieder zu uns, aber wir kommen zu ihm (Br. 435).
Die Zeit in den Redaktionsstuben der Hamburger ›Addreß-Comtoir-Nachrichten‹ war entscheidend für Claudius’ Entwicklung zum Literaten und Dichter, aber sie ging unrühmlich und abrupt zu Ende. Der Verleger Leisching war mit seinem Angestellten unzufrieden und verpasste ihm eine Abmahnung. Claudius reagierte Anfang Oktober 1770 mit seiner Kündigung. Vielleicht zeichnete sich da bereits eine neue und für ihn attraktivere Gelegenheit zur redaktionellen Tätigkeit ab, die ihm eine Kündigung in Hamburg leicht machte. Im selben Oktober nämlich ließ er seinen Freund Gerstenberg wissen, wohin er sich zu verändern gedenke: Auf Neujahr legt Bode eine Zeitung in Wandsbeck an und ich werde sie schreiben helfen (Br. 68).
›Ein Wiegenlied bei Mondschein zu singen‹
So schlafe nun du Kleine!
Was weinest du?
Sanft ist im Mondenscheine,
Und süß die Ruh.
Auch kommt der Schlaf geschwinder,
Und sonder Müh:
Der Mond freut sich der Kinder,
Und liebet sie.
Er liebt zwar auch die Knaben,
Doch Mädchen mehr,
Gießt freundlich schöne Gaben
Von oben her
Auf sie aus, wenn sie saugen,
Recht wunderbar;
Schenkt ihnen blaue Augen
Und blondes Haar.
Alt ist er wie ein Rabe,
Sieht manches Land;
Mein Vater hat als Knabe
Ihn schon gekannt.
Und bald nach ihren Wochen
Hat Mutter mal
Mit ihm von mir gesprochen:
Sie saß im Tal
In einer Abendstunde,
Den Busen bloß,
Ich lag mit offnem Munde
In ihrem Schoß.
Sie sah mich an, für Freude
Ein Tränchen lief,
Der Mond beschien uns beide,
Ich lag und schlief;
Da sprach sie: ›Mond, oh scheine,
Ich hab sie lieb,
Schein Glück für meine Kleine!‹
Ihr Auge blieb
Noch lang am Monde kleben,
Und flehte mehr.
Der Mond fing an zu beben,
Als hörte er.
Und denkt nun immer wieder
An diesen Blick,
Und scheint von hoch hernieder
Mit lauter Glück.
Er schien mir unterm Kranze
Ins Brautgesicht,
Und bei dem Ehrentanze;
Du warst noch nicht. (75f)
Es ist ein auffälliger Kontrapunkt zu den Handelsnachrichten für die Hamburger Geschäftswelt: Claudius mischt Verse unter die geballte Nüchternheit der ›Addreß-Comtoir-Nachrichten‹ von 1770. Das Lied gehört zu seinen frühen Veröffentlichungen und widmet sich dem zartesten Gegenstand in vollendeter Form. Ein ständiger Rhythmuswechsel erzeugt das schwingende Gleichmaß, das stets auf die Ruhe zuläuft, und bildet so im Versmaß die Bewegung ab, mit der das Kind in den Schlaf gewiegt wird. Die Einheit der Szene bleibt auch dort (und gerade dort!) gewahrt, wo sich im Bild von der singenden Mutter eine entsprechende Szene aus deren Vergangenheit auftut (Strophe 6-12), in der sie nun ihrerseits als gewiegtes Kind ihrer Mutter erscheint. In der Wiederholung des Geschehens verstärkt und vertieft sich dessen stille Bedeutsamkeit.
Der angestellte Hamburger Redakteur präsentiert sich nach seinem Herzen und auch nach seiner Begabung als Poet. Es sind Vorkommnisse und Eindrücke aus dem Alltag, bei denen es nach seiner Wahrnehmung zu verweilen lohnt. Eine Mutter wiegt ihre kleine Tochter in den Schlaf, was wäre natürlicher, ungekünstelter, und es handelt sich doch um eine menschliche Konstellation voller Poesie.
Das unterstreicht der Dichter, indem er die Szene ins Mondlicht rückt. Der Ort, an welchem man sich die beiden - Mutter und Kind - vorzustellen hat, wird offen gelassen; ob im Haus, am offenen Fenster des Schlafgemachs oder im Freien draußen vor der Tür, auf einer Bank mit der Wiege davor. Dem Hörer sind alle Möglichkeiten frei gestellt, sich selber ein Bild zu machen. Der Ort ist beliebig, nur die Zeit ist von Belang. Die Zeit des Mondes und des Mondscheins.
Wir begegnen dem Motiv des Mondes immer wieder in Claudius’ Werk. Es ist für ihn zu einer Art Zentralsymbol geworden. Weit über die romantische Gewohnheit hinaus, den Mond poetisch zu bemühen, um träumerische Stimmungen zu erzeugen, gewinnt der Mond bei Claudius eine viel weiter reichende und differenzierte Bedeutung. Er steht nicht in jedem Gedicht und in jedem Prosastück, das von ihm handelt, für eine und dieselbe Erfahrung. Vielmehr gilt der Mond für Claudius zunächst als herausgehobenes Medium für Erfahrung überhaupt. Er lädt ein zur Betrachtung, und zwar zur Betrachtung all jener Seiten des Lebens, die sich dem nüchternen Blick bei Tageslicht eher entziehen. Im Mondschein wird Betrachtung zur Wahrnehmung von Verborgenem und auf diesem Wege zur Meditation.
Dem Wiegenlied kommt generell die Aufgabe zu, ein Kind in den Schlaf zu singen. Dazu entwickelt es sinnvollerweise eine Atmosphäre von Geborgenheit. Die Nacht an sich kann angstbesetzt sein, aber der Mond wird in der Nacht zum Garanten des Vertrauten und der Vertrauenswürdigkeit. Das ist seine Rolle in dieser poetischen Szene. Er ist sanft, heißt es in der ersten Strophe, er freut sich der Kinder / Und liebet sie, und er steht vor allem für Kontinuität des Guten. Mit diesem Akzent versieht Claudius das Mond-Symbol in seinem Wiegenlied. Wo der Tag endet und die Nacht einbricht, scheinen der Bruch zu herrschen und die Diskontinuität. Doch der Mond gewährt das Bleiben und vermittelt Verlässlichkeit. Mein Vater hat als Knabe / Ihn schon gekannt, singt die junge Mutter, und dann schweift sie ab in eigene Kindheitsräume, wo sie selbst auf dem Schoß ihrer Mutter gewiegt wurde: Der Mond beschien uns beide / Ich lag und schlief. Aber damit nicht genug. In der Erinnerungsszene singt die Mutter der jungen Mutter und bittet den Mond ausdrücklich: Schein Glück für meine Kleine! Und der Mond erhört die Bitte, als Anwalt der Kontinuität des Guten, und denkt nun immer wieder an die Mutter mit ihrer Geborgenheitssorge für das dem Schlaf zu überlassende Kind.
Als Claudius seine Verse von der intimsten Mutter-Kind-Beziehung und über die Atmosphäre, die sich dabei aufbaut, niederschrieb, hatte er noch nicht die Bekanntschaft mit Rebecca, seiner späteren Frau, gemacht und war noch nicht von den Eindrücken familiärer Vertrautheit geprägt, die ihm lebenswichtig werden sollten. Vorerst bleibt das gewählte und poetisch gestaltete Bild reine Imagination. Aber doch eine Imagination, in der sich bereits ankündigt, was einmal zur Passion des Dichters werden sollte: das häusliche Leben mit seiner Frau und mit den Kindern.
Zum Nuancenreichtum des Lieds und des Mond-Motivs, das Claudius in die Mitte rückt, zählen nicht zuletzt erotische Anspielungen. Der Mond erscheint hier nicht weiblich – als lateinische Luna – sondern männlich. Darum die verschmitzte Bemerkung in Strophe 3: Er liebt zwar auch die Knaben, / Doch Mädchen mehr. Darum die Erinnerung der Mutter: Er schien mir unterm Kranze/Ins Brautgesicht in der letzten Strophe sowie die intime Begegnungsstunde zwischen dem Mond und ihrer Mutter: Sie saß im Tal. In einer Abendstunde / Den Busen bloß … – Dass Claudius im gleichen Zeitraum mit dem Mond durchaus pubertär-erotische Phantasien verbinden konnte, jetzt freilich auf einen weiblich vorgestellten Mond – Frau Luna – bezogen, wird deutlich in einem kurzen Prosatext, einem ›Brief an den Mond‹ von 1771, wo er der stille glänzende(n) Freundin gesteht, sie schon lange heimlich geliebt zu haben. Als Knabe sei er gern in den Wald gelaufen, um sich halbverstohlen hinter’n Bäumen nach Ihnen umzublicken, wenn Sie mit bloßer Brust oder im Negligé einer zerrissenen Nachtwolke vorübergingen (57).
11 Roedl, Urban: Matthias Claudius, Hamburg 1950, S. 59.
12 Lessing, G.E.: Anti-Goeze, 7. Teil, in: Lessings Werke Bd. 3, hg. v. K. Wölfel, Frankfurt/M. 1967, S. 481.
13 A.a.O., S. 457.
14 Vgl. S. 65ff.