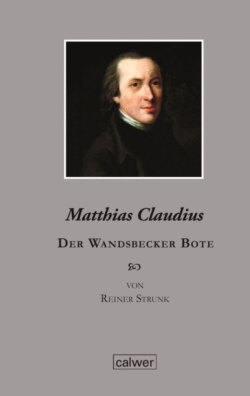Читать книгу Matthias Claudius - Reiner Strunk - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKonturen einer Dichtergestalt
Wir Vögel singen nicht egal;
Der singet laut, der andre leise,
Kauz nicht wie ich, ich nicht wie Nachtigall,
Ein jeder hat so seine Weise. (16) 1
Mit einfachen, bildkräftigen Versen und in heiterer Selbsteinschätzung empfiehlt Claudius sich den Lesern des ›Wandsbecker Bothen‹ als Redakteur. Er gibt Gelegenheit zu schmunzeln und lässt durchblicken, dass man mit seiner Eigenart im Singen und im Schreiben zu rechnen habe. Eine Nachtigall zu sein, beansprucht er nicht, aber für einen Kauz sollte man ihn auch nicht halten. Er wird die Welt betrachten und in Einzelheiten besingen oder besprechen, wie er sie sieht. Eine vorwiegend kleine Welt übrigens, die seinen persönlichen Erfahrungen und Urteilen zugänglich ist. Hans Jürgen Schultz hat ihn in dieser Hinsicht treffend gekennzeichnet: »Er gehört nicht zu denen, die ihre Zeit prägen. Dafür vergeht er auch nicht mit ihr.«2
Bei Claudius fehlt in der Tat alles Monumentale und Epochale, wie es einen Goethe und Schiller ausmachte, die seine Zeitgenossen waren. Er konnte neben ihnen bestehen, ohne mit ihnen konkurrieren zu müssen. Doch die Erinnerung an ihn ist verbreitet geblieben, nicht nur wegen des ›Abendlieds‹, das zum deutschen Volksliedschatz gehört und für kirchliche Gesangbücher unverzichtbar geworden ist. Ein großer Dichter sei er wohl nicht, aber immerhin ein kleiner, hat Claudius selbst bemerkt. Und es lohnt dann schon, diesem Dichterleben, das im Jahre 1815 zu Ende gegangen ist, etwas genauer nachzuspüren und herauszufinden, worin eigentlich das Geheimnis seines Überdauerns besteht, mit einem Werk, das nach den üblichen geistes- und literaturgeschichtlichen Maßstäben nicht als ›bedeutend‹ eingestuft zu werden pflegt, sowohl seinem Gesamtumfang als auch seinem Gehalt nach.
Claudius war ein Kind des 18. Jahrhunderts. Geboren im selben Jahr 1740, als Maria Theresia in Wien den kaiserlichen Thron bestieg und Friedrich II. den königlichen in Preußen. Für die eine, Maria Theresia, empfand Claudius freundliche Sympathien und bedachte sie zu ihrem Tode 1780 mit ehrenvollen Versen3. Den Preußenkönig Friedrich den Großen dagegen hat er weniger geschätzt. Und zwar wegen dessen militanter Politik, die den Holsteiner Bürger, der sich mit Dänemark verbunden wusste, wiederholt bedrängte, und auch wegen seiner aufgeklärten Geisteshaltung, die sich nicht gut mit den Grundüberzeugungen des Wandsbecker4 Boten vertrug.
Gestorben ist Claudius im selben Jahr 1815, in dem Napoleon bei Waterloo vernichtend geschlagen, die Ära der napoleonischen Kriege beendet und mit dem Wiener Kongress und der Heiligen Allianz zwischen Preußen, Österreich und Russland die politische Restauration in Europa durchgesetzt wurde.
Dazwischen spannt sich sein Leben, aufs Ganze gesehen erstaunlich unangespannt in den gärenden Zeiten geschichtlicher und geistiger Umbrüche. Es war das Leben eines Menschen, der durchgängig gefasst in sich selber ruhte. Nicht so, dass er den konsequenten Rückzug aus allen Konfliktzonen gesucht hätte; aber doch so, dass ihn die Stürme, die in einiger Entfernung von seinem Wohnort losbrachen, nicht wirklich erschüttern konnten. Seine Biographie ergibt darum keine Abfolge markanter Veränderungen, sie bildet eher ein Kontinuum der Beständigkeit, sowohl in seinem Denken als auch in seiner praktischen Lebensgestaltung. Von Abenteuern hielt er nicht viel, nicht mal von schwer kalkulierbaren Herausforderungen, die das Gleichmaß seines Lebens hätten stören können. Wo es nötig erschien, setzte er sich zur Wehr, in der Regel in schriftlicher Form und als Zeitungsmann, und verteidigte die alten Werte aus Religion und Monarchie gegen die neuen Ideen in aufgeklärten und revolutionär erhitzten Köpfen.
So scheint er zu seiner Zeit mit dem Rücken zur Zukunft und mit dem Gesicht zum Vergangenen verharrt zu haben, nur in Maßen beweglich und mäßig belehrbar. Wirklich ein Exponent des 18. Jahrhunderts gegen die Ansprüche und Versprechungen des neunzehnten. Im Alter, als er selbst die Schwelle zum 19. Jahrhundert zu überschreiten sich anschickte, verstärkte sich diese Tendenz. Frühere Freunde gingen, für ihn gewiss schmerzlich, allmählich auf Distanz.
Einer unter den Großen der Dichtung wollte er nicht sein und hat in dieser Richtung auch überhaupt keine Anstrengungen unternommen. Nicht einen einzigen Roman hat er geliefert, auch keine großen Erzählungen, und die Verfassung von Dramen erscheint bei seinem Naturell geradezu unvorstellbar. Mit einem hervorragenden epischen und theatralischen Talent war er anscheinend nicht gesegnet, wohl aber mit einem lyrischen. Allerdings – auch das war und ist umstritten. Goethe hat, nach anfänglichem Wohlwollen, in Claudius’ Lyrik nichts entdecken können, was der Erwähnung wert gewesen wäre. Herder hingegen urteilte anders.
Die Frage nach dem Dichter und nach eindeutigen Qualitätsmerkmalen für Dichtung ist nicht leicht zu beantworten. Sie muss ja in Rechnung stellen, dass Dichtung sich im Laufe der Kulturgeschichte sehr unterschiedlich dargestellt hat und dass die Maßstäbe für Dichtung einem unentwegten Wandel unterliegen. Trotzdem herrscht auf diesem Feld natürlich nicht die reine Beliebigkeit. Es lassen sich Gesichtspunkte nennen für das, was einen Dichter ausmacht. Gehen wir einigen dieser Gesichtspunkte nach in dem Interesse abzuwägen, warum wir es bei Matthias Claudius mit einem Dichter zu tun haben. Denn nur unter dieser Voraussetzung mag es reizvoll erscheinen, sich näher auf seine Person und sein Werk einzulassen.
Dass er Traktate zu allen möglichen Themen verfasst, launige Gelegenheitsverse geschrieben, als Rezensent sich über Lavater und Swedenborg, freilich auch über Lessings ›Emilia Galotti‹ und Herders ›Ursprung der Sprache‹ äußern konnte, dies alles mag für Experten von historischem Gewicht sein, rechtfertigt aber kaum den Aufwand zu einer allgemeinen Relektüre seiner Schriften. »Was bleibet aber, stiften die Dichter«, erkannte Hölderlin5, und das heißt umgekehrt: Was von Dichtern herrührt, hat bleibenden Wert.
Was aber kennzeichnet den Dichter?
Erste Antwort: die Sprache. Genauer: eine eigene Weise des Sprachgebrauchs. Das Vermögen, Sprache so einzusetzen, wie der Bildhauer den Meißel und der Maler den Pinsel einsetzt, also künstlerisch. Unmittelbar leuchtet das bei der Lyrik ein. Die Sprache dient ihr nicht als Instrument zur Mitteilung von Nachrichten. Sie wird in Form gebracht. Sie wird abgehorcht auf Möglichkeiten ihrer lautlichen und rhythmischen Musikalität. Lyrisch gesetzte Sprache schwingt und bringt ins Schwingen. Sie hat eine Nähe zum Gesang. Gedicht und Lied sind Geschwister, und es lag deshalb auf der Hand, dass lyrische Verse, auch solche von Claudius, gern vertont wurden.
Allerdings machen Rhythmus und Melodie noch nicht die Qualität einer Versdichtung aus. Man kann auch in metrischer Gliederung Trivialitäten verbreiten. Das hat Claudius selber getan, vornehmlich in seinen jüngeren Jahren, im Studentenalter. Seine erste Publikation, ›Tändeleyen und Erzählungen‹, 1763 in Jena erschienen, gibt beredtes Zeugnis davon. Den Strauß von Liebesliedern und Schäferszenen (mit Titeln wie Der steigende Busen oder Die süßen Lippen der Mädchen) hat er später nicht mehr für wert geachtet, in seine ›Sämtlichen Werke‹ aufgenommen zu werden. Verse, die eben gemacht, aber nicht erlebt waren. Peinliche Rezensionen wiesen ihm obendrein Kopiertes und Imitiertes nach. Wer aber bloß imitiert, hat jedenfalls noch nicht entdeckt, was er selbst sein könnte. Und Artikulationsübungen in einem poetischen Versuchslabor ergeben noch keine Dichtung.
Dabei war Claudius sprachgewandt und sogar sprachverliebt. Er zeigte sich überaus empfänglich für den hohen Ton und den erhabenen Gehalt von Klopstocks Dichtungen, vom ›Messias‹ und auch von den ›Oden‹. Aber so sehr er Klopstock verehrte, in Kopenhagen seine persönliche Bekanntschaft suchte und sie über Jahre zu erhalten wusste, so wenig hat er doch den Versuch unternommen, dessen Sprache und Stil nachzuahmen. Im Gegenteil: Es hat den Anschein, als habe ihm gerade der enge Kontakt zu Größen der damaligen Literatur, zu Klopstock, zu Lessing, zu Herder, nachhaltig dazu verholfen, seine eigene Sprache und seinen eigenen Stil zu entwickeln. Die große Form, die er bei andern ausdrücklich zu bewundern imstande war, sollte offensichtlich seine Sache nie werden. Nicht die große Form (im Versepos, im Roman oder im Drama) und auch nicht die hymnisch erhöhte oder virtuos verspielte Sprache. Claudius wurde stattdessen zum Entdecker und zum Liebhaber des Einfachen. Seine Texte bevorzugen die kleine Form, das Gedicht, den knappen Dialog, den Brief, die Parabel. Und seine Sprache horcht auf den Gang volkstümlicher Redeweisen und auf den Klang der Volkslieder. Herder sammelte sie, und Claudius half ihm dazu und bat sich Proben aus Herders Beständen aus.
Selten lässt er sich direkt auf Mundartliches ein, das in der Familie natürlich gesprochen wurde, aber er versucht in seinen Texten den niederdeutschen Ton wenigstens anklingen zu lassen. In einem Brief an Herder bekennt er auch, was ihn dazu bewogen hat: Die Schriftsprache ist ein infamer Trichter, darin Wein zu Wasser wird (Br. 193)6. – Mit dem Zug zum Einfachen, Volkstümlichen sucht Claudius im Grunde das Echte im Erleben und das Unmittelbare und Unverstellte im Ausdruck; sozusagen die Priorität des Herzens vor dem Verstand. Und eben dies: die Fähigkeit, dem Einfachen, alltäglich sich Ereignenden eine Würde zum begründeten Aufmerken zu verleihen, erhebt viele seiner Texte zur Dichtung7. Dass er auf diese Weise nicht in die ehrgeizig besetzten und argwöhnisch gehüteten oberen Ränge deutscher Dichtung einzurücken vermochte, hat ihn wenig bekümmert. Als ihm der ›Kaiser von Japan‹ bei seiner fiktiven Audienz nach Poeten in Europa fragt, antwortet er: Poeten genug; große und kleine, und ich bin einer von den kleinen (136).
Zweite Antwort: die Einbildungskraft oder Phantasie. Nach der klassischen Poesiekritik schien der Makel der Dichter darin zu bestehen, dass sie von Erfindungen leben. Homers Epen stellten keine Tatsachenberichte dar, wie sie von Historiographen erwartet wurden. Es waren fabulae, erfundene Geschichten. Die Personen, die Ereignisse, die Lokalitäten, sogar die Götter mit ihren Leidenschaften und Intrigen – alles erfundene Dinge. Entwurf und Erzählung von einer virtuellen Welt. Mit Realitätsbezügen durchsetzt, gewiss, aber ohne Anspruch, der Wirklichkeit gerecht zu werden. Die Phantasie erlaubt sich gewagte Sprünge. Sie kann faszinieren damit, aber nicht überzeugen.
Dieser Erfindungsvorwurf, der über alle Dichtung den Stab brechen sollte, verlor jedoch zur Zeit des Claudius an Gewicht. Man begann, zwischen Wirklichkeit und Wahrheit zu unterscheiden und entwickelte ein Sensorium dafür, dass es Wahrheiten geben könne, die nicht einfach im Horizont handgreiflicher Realitäten einzuordnen waren. Die Mythen verrieten jetzt mehr und anderes als angebliche Lügengeschichten. Sie lieferten grundmenschliche Erfahrungswahrheiten, in Bildern und Bildszenen verdichtet. Herder nahm diese, von Alttestamentlern vorgetragene neue Mythentheorie auf und förderte sie. Er erkannte das besondere Vermögen menschlicher Einbildungskraft, die in Bildern vermittelt, was sich eindeutiger Begrifflichkeit entzieht. Die Romantik sollte an diesem Faden kräftig weiterspinnen und Verständnis gewinnen für Wahrheiten, die in Geschichten, Poesien, überhaupt in den Künsten enthalten sind. Damit wurde die Phantasie zum salonfähigen Partner nicht nur im Milieu erfundener Welten, sondern auch im Streit um die Wirklichkeit selbst. Dichtung sollte nicht nur schön, sondern auch wahr sein in dem Sinne, dass sie einen Beitrag zu leisten versprach zur Entdeckung verborgener Seiten des Wirklichen und zur Vertiefung ihrer Wahrnehmbarkeit.
In der oben bereits erwähnten ›Audienz beim Kaiser von Japan‹ liefert Claudius eine wunderbare Antwort auf die Frage, was denn Poeten eigentlich seien: Helle reine Kieselsteine, an die der schöne Himmel, und die schöne Erde, und die heilige Religion anschlagen, dass Funken herausfliegen (136). Diese Auskunft ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Denn sie erklärt und definiert ja nicht. Sie bedient sich vielmehr der Poesie, um anzudeuten, was es mit der Poesie und dem Poeten auf sich habe. Claudius wählt die Metapher des reinen Kieselsteins, der Funken sprüht, wenn er richtig angeschlagen wird. Im Bild, nicht mit Begriffen und Argumenten, vermag er sich dem Wesen des Poetischen anzunähern. Da wird mehr nachempfunden als analysiert. Einbildungskraft bringt sich ins Spiel und gibt, wo es um anderes als wissenschaftliche Erkenntnisse geht, den Ton an. Und noch etwas: Claudius versteht den Poeten im Sinne eines Mediums. Der beschreibt nicht bloß, was ihm objektiv vor Augen tritt; er holt auch nicht nur ans Licht der Öffentlichkeit, was sich verborgen in seinem Innern bewegt; sondern er wird zum Resonanzkörper für die geheimen Mitteilungen, die der schöne Himmel und die schöne Erde und die heilige Religion bereitstellen. Ohne die mediale Existenz des Poeten blieben das Schöne und das Heilige unzugänglich und unerkannt. Das ist eine Hochschätzung der Dichter, wie sie in Klopstocks Werk und dann betont wieder im poetischen Selbstverständnis Hölderlins anzutreffen ist.
Das Spiel der Einbildungskraft hat bei Claudius aber nicht allein seinen Platz, wo er die hohe Kunst der Dichtung in den Blick fasst. Er hat ihr fortwährend nachgegeben, in jeder denkbaren Beziehung. Die ganze Audienz beim Kaiser von Japan verdankt sich diesem Spiel der Einbildungskraft, bis hin zu der Idee, den wunderlichen Gesprächsgang mit noch wunderlicherem Pseudo-Japanisch zu durchsetzen, für dessen Zusammenstellung er einige vergnügte Mühe aufgebracht haben dürfte. Rezensionen schreibt Claudius prinzipiell nicht so, wie man damals Rezensionen schrieb und heute noch schreibt, nämlich nüchtern, exakt, informativ. Kritisch kann er sich zwar ohne weiteres zeigen, aber er erzählt dann in Bildern und Gleichnissen, viel mehr offenbarend, wie ihm selber beim Lesen des Buchs, beim Anschauen eines Schauspiels zumute war, als den Inhalt und die Machart des besprochenen Stücks zu erörtern. Zu einem Kabinettstück auf diesem Gebiet geriet ihm die Besprechung von Lessings ›Minna von Barnhelm‹, die er in das Kostüm einer Korrespondenz zwischen einem etwas einfältigen, jedoch erkennbar vom Geist des ›Sturm und Drang‹ bewegten Fritz mit seinem Vater sowie einer sittlich entrüsteten Tante (Du bist in dem Hause mit dem Vorhange gewesen … Ihr heimlichen Sündenböcke, Ihr. Und Du schämst Dich nicht…, 752f) kleidet. Einbildungskraft tritt da gepaart mit der Gabe des Humors auf, eine Mischung, die Claudius ersichtlich lag und die er häufig einzusetzen wusste.
Dritte Antwort: Gefühl und Empfindsamkeit. Es ist bezeichnend, dass Claudius’ Begabung weit weniger in der Behandlung großer Themen lag, seien sie nun philosophischer, theologischer oder politischer Natur, als im Erfassen spontaner Eindrücke und deren pointierter Wiedergabe. Er bewegte sich gern im Haus der großen Gedanken und focht dort auch tapfer um Positionen, die er vertrat, allerdings nicht immer mit Fortune. Zu Hause war er jedoch auf dem Terrain des unmittelbaren Erlebens, bei Szenen ums Geborenwerden und Sterben, in Augenblicken des überraschenden Glücks und der schmerzlichen Klage, bei den Schicksalsschlägen und den Triumphen kleiner Leute. Dort fand er sein Herz berührt und konnte mit Liedern und Gedichten die Herzen anderer rühren.
Dichtung ohne Gefühlseinsatz ist schwer vorstellbar, doch mit problematischem Gefühlseinsatz wird häufig Dichtung intendiert, aber Kitsch produziert. Die Trennlinie zwischen beidem wurde auch in poetischen Zirkeln und Schreibstuben zur Claudius-Zeit nicht selten überschritten. Er selbst hatte es in seinen ›Tändeleyen‹ getan. Und im ›Göttinger Hain‹, deren Poetengesellschaft er nahestand, ohne ihr anzugehören, pflegte man eine Lyrik mit beträchtlicher Gefühlsinnigkeit, vor allem die Liebe zum Vaterland betreffend, die sich mit Impulsen des ›Sturm und Drang‹ verband und eine neue Ich-Erfahrung mittels tief greifender Stimmungen und außerordentlicher Gefühlslagen feierte. »Das Fühlen will sich fühlen«, bemerkt Gerhard Kaiser8, das Grundanliegen der ›Empfindsamkeits‹-Dichter auf eine Formel bringend, und man kann sich leicht ausmalen, was bei einer Hypertrophie der Empfindungen an schwer Verdaulichem zustande gebracht werden konnte.
Claudius war nicht frei von solchen Neigungen, und das zeigt sich besonders deutlich, wo er, dem Programm der Empfindsamkeit entsprechend, in seinen jüngeren Jahren eine seltsam anmutende Vorliebe für Friedhöfe, Gräber und aufgebahrte Leichen an den Tag legt. Das sind für ihn zweifellos Orte und Gelegenheiten, die intensive Gefühle hervorrufen, aber es führt auch zu Äußerungen hart am Rande der Geschmacklosigkeit. Im Übrigen wurde ihm bald die Empfindsamkeitskultur viel zu manieriert, als dass er sich lange auf sie hätte einlassen mögen. Spätestens 1782, im vierten Teil seiner ›Sämtlichen Werke‹, ist sein Urteil in dieser Beziehung geklärt, sowohl was die Abwehr gestelzter Empfindsamkeit als auch was die Berechtigung echter Gefühle in der Dichtung anbelangt: es wird in diesen Jahren mit Empfindungen und Rührungen ein Unfug getrieben, dass sich ein ehrlicher Kerl fast schämen muss gerührt zu sein … Wahre Empfindungen sind eine Gabe Gottes und ein großer Reichtum, Geld und Ehre sind nichts gegen sie; und darum kann’s einem leid tun, wenn die Leute sich und andern was weismachen, dem Spinngewebe der Empfindelei nachlaufen und dadurch aller wahren Empfindung den Hals zuschnüren und Tür und Tor verriegeln (223f).
Vierte Antwort: die Mission. Zum Dichterberuf gehört das Bewusstsein, einer Sendung verpflichtet zu sein. Das muss nicht ans Selbstverständnis eines Klopstock heranreichen, der sich als prophetischer Mittler göttlicher Wahrheiten verstand, und auch nicht Hölderlins Überzeugung gewinnen, an Offenbarungen des Ewigen teilzuhaben. In einem geistigen Klima, wo Poesie und Religion noch verschwistert waren, konnte sich eine derartige Auffassung vom Dichterberuf noch anspruchsvoll präsentieren. Aber auch da, wo diese Verbindung bereits in Auflösung begriffen war, verschwand die Vorstellung von der Sendung des Dichters keineswegs. Nur der angenommene Ursprung und das angestrebte Ziel seiner Mission verwandelten sich. Jetzt wurden die Dichter zu Missionaren der Freiheit wie bei Schiller, oder zu Sendboten der Toleranz wie bei Lessing, und alles in allem zu Aposteln eines neuen Geistesaufbruchs gegen die Dürre des Verstandes und die Trägheit der Herzen.
Claudius hat sich programmatisch und konsequent den Titel eines ›Boten‹ beigelegt. Das geschah äußerlich zunächst im Zusammenhang seiner Redaktionstätigkeit beim ›Wandsbecker Bothen‹. Die erste Ausgabe der neuen Zeitung eröffnete er zum 1. Januar 1771 mit einem Gedicht, in welchem er sich dem Publikum vorstellte:
Ich bin ein Bote und nichts mehr,
Was man mir gibt das bring’ ich her … (779).
Damit knüpft er nicht etwa ans Motiv des Götterboten an, sondern an die Aufgabe des einfachen Briefboten und Kuriers, der daheim vorbeibringt, was an Neuigkeiten der Erwähnung wert ist. Der Zeitungsschreiber sollte sammeln, was ihm über irgendwelche Agenturen auf den Tisch kam, und es aufbereiten für die Leserschaft. Das war sein Ausgangspunkt und die geforderte Tätigkeit, für die er – sparsam – bezahlt wurde. Aber dabei blieb es nicht. Claudius warf seine Energie nicht auf den größeren politischen Teil der Zeitung, sondern auf den kleineren des Feuilletons. Und er experimentierte mit den Möglichkeiten, die sich hier anboten. Er bat namhafte Autoren wie Herder und Dichter, unter ihnen sogar Goethe, um Zulieferung eigener Texte, und er setzte sich selbst daran, der letzten Seite im ›Wandsbecker Bothen‹ sein eigenes Profil zu verleihen. Er wollte die geistreiche Unterhaltung und ein Stück aktueller Volksbildung.
Insofern wurde der ›Bote‹, seiner eigenen Intention nach, weit mehr als ein Lieferant von Nachrichten. Er wurde zum Herold wesentlicher Wahrheiten, sei es in der Form geistiger Orientierungsversuche in einer offenkundigen Umbruchszeit, sei es in der Gestalt poetischer Beiträge zu dem, was man damals eine ›Herzensbildung‹ nannte. Der Bote aus Wandsbeck konnte wieder und wieder das Gewand wechseln, in dem er auftrat, nicht aber die Ursprünge, aus denen er schöpfte, und die Richtung, in die er sich gesandt fühlte. Ein Poet ist er unter diesen Bedingungen sicherlich geworden, wenn auch, seiner bescheidenen Selbsteinschätzung zufolge, nur ein kleiner und in jedem Fall, ohne dieses bis zu Spitzweg hin romantisch verklärte Modell jemals angestrebt zu haben, auch ein wirklich »armer Poet«, der um seinen Lebensunterhalt besorgt sein musste.
1 Zitate aus den ›Sämtlichen Werken‹ werden im Text mit Seitenzahlen angegeben.
2 Hans Jürgen Schultz: Claudius – quelle adresse! In: Nicht umsonst auf die Welt gesetzt, Herrenalber Protokolle 81, 1990, S. 9.
3 Vgl. unten S. 158.
4 Claudius hat den Ortsnamen stets mit »ck« geschrieben. Wir behalten durchgängig diese Schreibweise bei, auch wenn sich der Name »Wandsbek« mit einfachem k durchgesetzt hat.
5 Friedrich Hölderlin: Andenken, in: Sämtliche Werke und Briefe Bd. I, München 1992, S. 475.
6 Claudius: Botengänge. Briefe an Freunde, Berlin 2. Aufl. 1965 werden im Text zitiert mit »Br.« und Seitenzahl; die Familienbriefe mit »Fambr.« und Seitenzahl.
7 J. Chr. Hampe erklärt: »Seine Welt ist die Nachbarschaft und die Nachbarschaft seine Welt«, Johann Christoph Hampe: Bekenntnis zu Matthias Claudius, München 1979, S. 14.
8 Gerhard Kaiser: Aufklärung. Empfindsamkeit. Sturm und Drang, 6. Aufl. Tübingen 2007, S. 35.