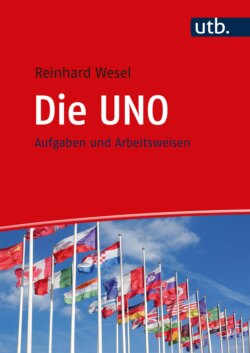Читать книгу Die UNO - Reinhard Wesel - Страница 15
3.2 Entstehung und Gründung im Zweiten Weltkrieg
ОглавлениеDie UNO ist wie der Völkerbund aus dem mörderischen Geschehen eines Weltkrieges heraus auf Initiative von kriegführenden Regierungen späterer Siegermächte entstanden, nicht als kühner Entwurf für eine bessere Weltorganisation aus der Mitte der „Völker“. Schon die Benennung der neuen Organisation als die der „Vereinten Nationen“ zeigt, dass sie ein unmittelbares Produkt des Zweiten Weltkrieg ist: Als die Alliierten gegen Deutschland, Italien und Japan an Neujahr 1942 eine gemeinsame programmatische Botschaft abgaben, nannten sie diese die „Erklärung der Vereinten Nationen“ („Declaration by United Nations“).
Der Kampf gegen Deutschland und Japan wurde ohne den Völkerbund gewonnen, in dem die Alliierten kein geeignetes Instrument gegen staatliche Aggression mehr sahen; dennoch galt es schon im größten und schlimmsten Krieg der Geschichte als selbstverständlich, dass nun eine neue und bessere internationale Organisation zu gründen war, die endlich dauerhaft in der Lage sein sollte, Krieg und Kriegsverbrechen zu verhindern – und Frieden aktiv zu ermöglichen. Trotz der Enttäuschungen mit dem Völkerbund geriet die Organisation der Vereinten Nationen in Ansatz und Struktur ihm recht ähnlich nach den idealtypischen Merkmalen, die der ausgearbeitete Gedanke einer internationalen Friedens-Organisation vorgab:
Das im vorausgegangenen Krieg siegreiche Bündnis wird zu einem System der kollektiven Sicherheit unter Vorrang der Großmächte, die als ständige Mitglieder im entscheidungsmächtigsten Gremium sitzen;
dabei bleibt die unantastbare Souveränität der einzelnen Staaten oberste Maxime, also auch das prinzipielle Verbot der Einmischung in deren innere Angelegenheiten;
idealistisch wird Abrüstung beschworen und realistisch Rüstungsbegrenzung versucht;
zum Konfliktaustrag ist friedliche Streiterledigung verpflichtend, durch Verhandlungen und/oder Schiedsgerichte;
stützend werden Mechanismen für Entwicklung und Ausbau der Beziehungsgeflechte zwischen den Staaten im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich vorgesehen;
dazu werden (eigenständige) Fachorganisationen eingerichtet;
rhetorische Formeln dienen dem Bekenntnis zu hochstehenden moralischen Prinzipien und Zielen, insbesondere zur Achtung der Normen des Völkerrechts und der Menschenrechte.
Die USA waren die treibende Kraft der Neugründung; die Amerikaner gingen wohl davon aus, dass ihre aktive und bestimmende Mitarbeit nun den Erfolg bringen würden. Da dieser Optimismus durch ihr im Krieg ständig gewachsenes Machtpotential wohl unterfüttert war, konnten die alten Rezepte nur wenig modifiziert fortgeschrieben werden. Somit wurde der status quo von 1945 in die Struktur der neuen Organisation nur schwer korrigierbar eingeschrieben; jedenfalls wurde „die einmalige Gelegenheit versäumt, eine an den Bedürfnissen der Staatengemeinschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgerichtete Weltorganisation zu schaffen“ und ihr „institutionelle […] Mechanismen, die einen kontrollierten Wandel ermöglicht hätten“, zu geben (Bertrand 1995, S. 37f.).
Die Gespräche und Verhandlungen zu Konzept und Planung der neuen Organisation seit 1941 verliefen entlang von drei interessenbestimmten Konfliktlinien,
zwischen den USA unter Präsident Franklin D. Roosevelt und Großbritannien unter Premierminister Winston Churchill,
zwischen diesen beiden und der Sowjetunion unter Generalsekretär Josef Stalin,
zwischen den Großmächten und dem Rest der Kriegsalliierten.
Der Verhandlungsprozess war immer von Konkurrenz um Macht und die dynamische Entwicklung ihrer Verteilung im Krieg geprägt: Großbritanniens Vormachtstellung schwand im Abwehrkampf gegen Deutschland, während das Machtpotential der hilfreichen USA trotz ihres Engagements auf zwei Kriegsschauplätzen rasch wuchs; die früher randständige Sowjetunion musste immer stärker in die Entscheidungen eingebunden werden, damit der Krieg in Europa zu gewinnen war, weswegen unterschiedliche Vorstellungen der USA und Großbritanniens der gemeinsamen Linie gegenüber Stalin untergeordnet wurden.
Die UNO wurde in vier Phasen konzipiert und ausverhandelt:
Dezember 1941 bis Sommer 1944: erste Überlegungen, auslotende Gespräche und erste konzeptionelle Absprachen;
August/September 1944: detaillierte Verhandlungen zur Festlegung der Struktur;
Februar 1945: verbindliche Entscheidungen in einzelnen Interessenkonflikten;
April-Oktober 1945: Konsens-Findung und Gründungs-Beschluss.
Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill berieten bereits im August 1941 über die Nachkriegsordnung – die USA waren noch gar nicht in den Krieg eingetreten. Weil das Treffen an Bord des britischen Schlachtschiffes „Prince of Wales“ mitten im atlantischen Ozean stattfand, wurde die Abschlusserklärung als „Atlantik-Charta“ bekannt; sie betonte als wesentliche Prinzipien der zukünftigen Weltordnung das Selbstbestimmungsrecht der Völker und den Gewaltverzicht der Staaten untereinander sowie den internationalen Freihandel, aber auch internationale Zusammenarbeit in wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Zur Frage einer neuen internationalen Organisation wurde vorerst nur die Absicht zur „Errichtung eines weiteren und dauernden Systems der allgemeinen Sicherheit“ verkündet. Die leitende Vorstellung war wohl zunächst, dass die USA zusammen mit den Briten als hegemoniale Ordnungsmächte die internationale Sicherheit garantieren würden, während alle anderen Staaten abrüsteten.
Aber die Dynamik des Krieges erwies das dann als unrealistisch, weil zur Bezwingung von Deutschland, Italien und Japan eine wesentlich breitere Koalition von Alliierten nötig wurde. Anfang 1942 beschloss das Kriegsbündnis von 26 Staaten die – für die spätere UNO namengebende – „Erklärung der Vereinten Nationen“ („Declaration by United Nations“). Auch die Sowjetunion (UdSSR) unter ihrem Diktator Josef Stalin war als alliierte Großmacht einzubinden, wofür ihr der Status einer mit den USA und Großbritannien gleichberechtigten Schutzmacht für die spätere internationale Ordnung zugestanden werden musste. Aus der atlantischen Zweier-Hegemonie wurden die „großen Drei“ und später sogar die „großen Vier“, als die drei Großen auf der Außenministerkonferenz in Moskau im Oktober 1943 beschlossen, dass auch China als Garantiemacht für den Weltfrieden nötig sein würde. Aus dem hegemonialen Denken und Vorgehen heraus hatte sich ein stärker multilaterales Moment entwickelt.
Erstmals wurde von der Moskauer Konferenz die Absicht erklärt, als Ersatz für den Völkerbund eine neue Weltorganisation zu gründen, was in einem speziellen Konsultations- und Verhandlungsprozess vorbereitet werden sollte. Die „großen Drei“ handelten die grundsätzlichen Entscheidungen, die zunächst meist recht kontrovers waren, im Kern unter sich aus: Die UNO ist von ihrer Entstehung an durchwegs ein Verhandlungskompromiss.
Zwei Optionen standen zur Entscheidung,
eine regionale Konzeption, nach der jeweils die Großmächte unabhängig voneinander als Hegemonialmächte in ihren Weltregionen Frieden schaffen, also die USA in Amerika, Großbritannien in Europa und die Sowjetunion im Fernen Osten – was Churchill und Stalin bevorzugten,
eine universale Konzeption, nach der die Großmächte in gemeinsamer weltweiter Zuständigkeit den Weltfrieden sichern – was Roosevelt vertrat.
Der amerikanische Präsident konnte sich auf der Konferenz in Teheran im November 1943 durchsetzen: Die UNO würde von universaler Struktur sein.
Die USA dominierten auch den folgenden Gründungsprozess: Im Sinne der klassischen Verhandlungs-Maxime „always control the paper“ übernahmen sie die Federführung bei der Ausarbeitung und Formulierung der Charta – also der völkerrechtlichen Vertragsgrundlage – zu Aufbau und Auftrag der zu gründenden Organisation.
Der Entwurf der Charta aus dem US-Außenministerium war die Arbeitsgrundlage der entscheidenden Expertenkonferenz, die auf dem Landsitz Dumbarton Oaks bei Washington im Spätsommer 1944 über Wochen im Detail verhandelte; vertreten waren nur die „großen Vier“ – USA, Großbritannien, UdSSR und China.
Das Verhandlungsergebnis legte die Struktur der zu gründenden Organisation in ihren wesentlichen Elementen fest. Die prägenden Maximen waren,
dass ein gegenüber der Versammlung aller Mitgliedstaaten in Fragen von Krieg und Frieden vorrangig zuständiger Sicherheitsrat mit wenigen Mitgliedern und mit handlungsbefähigenden Kompetenzen einzurichten sei,
dass im Gegensatz zur Versammlung aller Mitgliedstaaten in diesem operativen Gremium die Großmächte substantielle Vorrechte haben sollten: Ständige Mitgliedschaft und eine Art Vetorecht.
Zudem wurde schon entschieden, dass auch dem bislang besetzten Frankreich als fünfter Großmacht ein ständiger Sitz in diesem Sicherheitsrat zustehe.
Zwei noch offene Fragen klärten Roosevelt, Churchill und Stalin auf ihrer Konferenz in Jalta im Februar 1945: Die Forderung der Sowjetunion, alle 16 Sowjetrepubliken als selbständige Mitglieder der Organisation aufzunehmen, hätte Stalin einen gewichtigen Stimmenblock in der Vollversammlung verschafft; sie wurde auf die Aufnahme von nur zwei (Weißrussland, Ukraine) abgemildert. Schwieriger war die Einigung auf einen Abstimmungsmodus im Sicherheitsrat; der als „Jalta-Formel“ bekannte Kompromiss gab den Großmächten ein indirekt formuliertes Vetorecht: Nicht nur eine festgelegte Anzahl von Mitgliedern des Rates, sondern darunter auch alle ständigen Mitglieder müssen dem Entwurf einer Resolution zustimmen, um sie wirksam zu verabschieden.
Nach den Klärungen von Jalta sollte nun die neue Organisation so schnell wie möglich gegründet werden – auch um das noch günstige Meinungsklima in den USA zu nutzen. Zur Gründungskonferenz (United Nations Conference on International Organization/UNCIO) luden die „großen Vier“ für den 25. April 1945 nach San Francisco (USA) ein; bis zum 26. Juni konferierten die Vertreter von 50 Regierungen – die der alliierten Staaten, die mit Deutschland und Japan im Kriegszustand waren, ferner Argentinien, Libanon und Syrien sowie die Sozialistischen Sowjetrepubliken Ukraine und Weißrussland; Polen konnte seine Delegation zwar nicht rechtzeitig anmelden, gilt aber als 51. Gründungsmitglied.
Zumindest staatsrechtlich waren ca. 80 Prozent der Weltbevölkerung vertreten – alle Kontinente, alle Rassen, alle Religionen; 850 Delegierte, ihre Mitarbeiter und Berater sowie das Konferenz-Sekretariat, insgesamt ca. 3500 Personen, nahmen teil, anwesend waren etwa 2500 politische Beobachter und Journalisten – UNCIO war wahrscheinlich die größte nicht-kriegerische internationale Versammlung der Geschichte bisher.
Ihre Arbeitsweise und Verhandlungsmethoden sind für alle großen multilateralen Konferenzen üblich geworden, weil sie deren organisatorische und kommunikative Probleme zwar nicht lösen aber wenigstens vereinfachen:
Die Vollversammlung dient rechtlich der formellen Beschlussfassung und politisch der öffentlichen Darstellung – das Opernhaus von San Francisco war ein angemessener Ort. Im Vorsitz der Versammlung wechselten sich die Leiter der Delegationen der vier Großmächte (USA, GB, UdSSR, China) ab.
Die eigentliche Arbeit, die konkreten Formulierungen des Vertragstextes zu verhandeln, wurde verteilt auf verschiedene Ausschüsse und meist differenziert organisiert durch informelle Interessen-Gruppen oder „Freundes“-Zirkel. Ein Lenkungsausschuss aus allen 50 Delegationsleitern entschied in wesentlichen Fragen; weil aber auch er zu schwerfällig war für die Behandlung der Masse der Probleme, wurde ein 14-köpfiger Vorstand gewählt, der Empfehlungen vorbereitete.
Der Entwurf der Charta wurde in vier Abschnitte und entsprechende Kommissionen aufgeteilt, in denen der Text detailliert bis ins letzte Komma ausformuliert wurde: (1) allgemeine Ziele der Organisation, Grundsätze, Mitgliedschaft, Sekretariat, Frage von Änderungen der Charta, (2) Generalversammlung und ihre Kompetenzen, (3) Sicherheitsrat und seine Kompetenzen und (4) die Satzung des Internationalen Gerichtshofs, die von Juristen aus 44 Ländern vorbereitet worden war; diese vier Kommissionen waren unterteilt in zwölf Fachausschüsse. Nur zehn Vollversammlungen von allen Delegationen, aber fast 400 Sitzungen der Ausschüsse wurden abgehalten.
Viele Fragen waren trotz der zum Teil schon definitiven Vorgaben durch die Abmachungen der Großmächte noch zu klären. Neue oder noch nicht bedachte Probleme ergaben sich, deren Lösungen noch offen waren. Oft ging es aber um Konfliktstoffe aufgrund der Interessengegensätze zwischen Großmächten und anderen Staaten, aber auch aus denen zwischen der Sowjetunion und des sich ihr gegenüber formierenden westlichen Lagers: der „Kalte Krieg“ zwischen Ost und West hatte schon längst begonnen.
Politisch bedeutende Streitpunkte und ihre Lösungen waren:
Das Recht jedes einzelnen der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, gegen Beschlussvorschläge ein „Veto“ auszusprechen, war so umstritten, dass die Konferenz wegen des zähen Widerstandes von vielen Ländern mit niedrigerem Machtstatus zu scheitern drohte; beschlossen wurde aber sogar gemäß des Vorschlags der Großmächte die weitestgehende „Veto“-Regelung nach der „Jalta-Formel“.
Der Status von „regionalen Organisationen“, die durch regionale Abkommen über Verteidigung und gegenseitigen Beistand zu begründen oder wie die Arabische Liga schon gegründet waren; beschlossen wurde, sofern ihre Ziele und Aktivitäten mit denen der Vereinten Nationen übereinstimmten sollten sie an der friedlichen Beilegung von Konflikten sowie gegebenenfalls sogar an Zwangsmaßnahmen beteiligt werden.
Die Kompetenzen des Internationalen Gerichtshofs; beschlossen wurde, dass die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sein würden, die Zuständigkeit des Gerichtshofs anzuerkennen, aber sich einer verbindlichen Rechtsprechung freiwillig unterwerfen könnten.
Zukünftige Ergänzungen der Charta; beschlossen wurde eine extrem strukturkonservative Option mit sehr restriktiven Regelungen für Änderungen und Ergänzungen.
Neben den oft widerstrebenden Vorstellungen der mächtigen und der weniger mächtigen Regierungen gab es noch andere politische Akzente in den Debatten von San Francisco: Amerikanische Nichtregierungsorganisationen und engagierte Einzelpersonen waren in den Wochen der Gründungskonferenz aktiv dabei – als Lobbyisten oder sogar als Delegationsmitglieder (wie die Literatur-Professorin und Frauenrechtlerin Virginia Gildersleeve); erst ihr Druck ermöglichte es, dass Menschenrechte als Ziel der Vereinten Nationen in den Text der Charta aufgenommen wurden. Vor ihrer formellen Gründung schon mischten sich also zivilgesellschaftliche Akteure in die Arbeit der neuen Internationalen Organisation ein – wobei selbstverständlich galt, dass deren Grundstruktur zwischenstaatlich und ihre Arbeitsebene regierungsamtlich sein sollte.
Darin wirkte schon eine die UNO prägende Ambivalenz zwischen ihrer politischen und rechtlichen Grundlage als zwischen-staatlicher Regierungs-Organisation und den vielfältigen Ansprüchen an die „Organisation der Vereinten Nationen“ als vermeintlicher Weltinstanz – wie es sich auch in der heute modischen Rhetorik von „global governance“ (siehe 2.2) u.ä. ausdrückt. Dieser Widerspruch lässt sich gut an der feierlich-idealistischen Präambel zur Charta (siehe 4) erkennen, die wie ein Fremdkörper wirkt vor dem rechtsverbindlichen internationalen Vertrag, der in sachlicher Rechtsprache hart errungene Kompromisse als Ergebnisse zwischenstaatlicher Verhandlungen der mächtigsten Regierungen der Welt mitten in einem mörderischen Krieg festhält.
Bei der Abstimmung über den dann endlich vorgelegten Entwurf der Charta in der letzten Plenarsitzung am 25. Juni 1945 war eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig; die Delegierten aller teilnehmenden Länder nahmen die Charta der Vereinten Nationen sogar einstimmig an. Sie versammelten sich am nächsten Tag zum Ritual der Unterzeichnung – symbolisch passend im Auditorium der Veterans’ Memorial Hall – und unterschrieben nacheinander die Texte der Charta der Vereinten Nationen und der Satzung des Internationalen Gerichtshofs; als dem erstem Opfer eines Angriffs im Weltkrieg kam China die Ehre zu, zuerst zu unterzeichnen.
Aber erst nach dem vollständigen Durchlaufen der Prozedur der Schaffung internationalen Vertragsrechts konnte die Charta wirklich in Kraft treten: In der Mehrzahl der unterzeichnenden Länder („Signatarstaaten“), darunter in allen ständigen Mitgliedsländern des künftigen Sicherheitsrates, musste sie von den legislativen Instanzen, meist den gesetzgebenden Parlamenten, in formellem Beschluss angenommen, also „ratifiziert“ werden. Zudem musste die offizielle Bekanntgabe dessen hinterlegt werden, im Fall der VN-Charta beim Außenministerium der USA; am 24. Oktober 1945 war dies erreicht – dieses Datum wurde dann von den Vereinten Nationen zum Tag der „Vereinten Nationen“ erklärt.
Und es ist immer wieder daran zu erinnern: Der Zweite Weltkrieg war noch nicht zu Ende, als die UNO gegründet wurde; die amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki fielen erst am 6. und 9. August 1945, Japan kapitulierte am 2. September.
In der Konzeption der neuen Organisation zur künftigen Sicherung des Weltfriedens war ein sachlich nicht auflösbares Dilemma politisch zu bewältigen:
Anders als im Völkerbund sollten alle Großmächte dauerhaft eingebunden sein – aus eigenem Interesse an einer aktiven und möglichst konstruktiven Mitarbeit, d.h. die internationale Kooperation sollte ihnen verlässlich mehr Nutzen als Kosten bringen und insgesamt auch für sie nützlicher sein als Nicht-Kooperation.
Zugleich sollte die neue Organisation eine wirklich universale werden, also möglichst alle Staaten als aktive Mitglieder haben, nicht nur als mitlaufende Statisten oder gar passive Zuschauer, d.h. alle Regierungen sollten ungeachtet der oder gar gegen die Machtposition der Großmächte ihren Einfluss ausüben können.
Einerseits wurde befürchtet, dass die neue Organisation ohne eine Vormachtstellung der Großmächte nicht wirksam werden könnte, weil diese daran desinteressiert sein könnten, andererseits, dass die Großmächte ihre Vormachtstellung nur zur Verfolgung eigener Interessen nutzen würden – was beides dem Frieden nicht dienlich wäre. Ein spezielles, aber ernstzunehmendes Problem war zudem die öffentliche Meinung und außenpolitische Stimmungslage in den USA, die wie nach dem Ersten Weltkrieg wieder in Isolationismus hätte umschlagen können.
Die nötige Quadratur des Kreises konnte auch auf der Gründungskonferenz 1945 in San Francisco nicht gelingen: die gefundene Lösung privilegiert die Großmächte durch die Sonderstellung der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat; in den meisten entscheidenden Fragen ist der Sicherheitsrat vorrangig und steht in einem institutionellen Spannungsverhältnis zur Generalversammlung, in der dafür die „souveräne Gleichheit“ aller Mitglieder unbehindert zelebriert werden kann.
Literaturverweis zu 3.2.: Entstehung und Gründung der UNO im Zweiten Weltkrieg
Bertrand 1995; Kaltofen 2015; Morris 2018; Schlesinger 2003; Tavares de Sá 1966; Volger 1995, 2008; Weber 1991