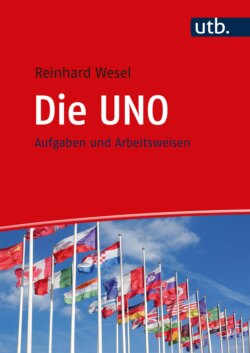Читать книгу Die UNO - Reinhard Wesel - Страница 16
3.3 Entwicklung seit 1945
ОглавлениеSo war die UNO also nun gegründet als „eine Organisation, in der die Großmächte einen beherrschenden Einfluss ausüben, in der sie vor allem jede Aktion verhindern können, die sie nicht billigen“ (Volger 1995, S. 27f). Die Großmächte, von denen bald für Jahrzehnte nur noch die den Westblock anführenden USA und die Sowjetunion für den Ostblock als Supermächte übriggeblieben waren, haben ihre privilegierte Stellung in der UNO
sowohl destruktiv zur Blockade von deren Funktionsfähigkeit,
als auch konstruktiv zur Unterstützung ihrer Arbeit
genutzt; oft haben sie Regeln und Prinzipien der Vereinten Nationen missachtet, selten aber explizit misshandelt.
Die Welt hat sich seit 1945 wesentlich verändert, doch die Grundstruktur der UNO hat sich in diesem dreiviertel Jahrhundert bewährt. Die Organisation bzw. das vielfältige „System“ der um sie gruppierten internationalen Institutionen ist stark gewachsen – oder gar aufgebläht – und ist differenzierter geworden, wurde aber nie wesentlich geändert. Der rapide Wandel der inter- und transnationalen Probleme und Beziehungen lässt das problematisch erscheinen und Reformbedarf ist tatsächlich überall zu entdecken – aber interessanterweise hat sich gerade durchaus auch als Stärke erwiesen, dass die niemals ideale Grundstruktur der UNO und besonders die immer unvollkommene Charta der Vereinten Nationen so veränderungsresistent sind: Man musste früh lernen, damit kreativ und flexibel umzugehen.
Nach der Gründungsphase 1941-1945 sind folgende Phasen anzusetzen:
erste Bewährungsproben 1945-1954,
Konflikt und Kooperation zwischen Ost und West 1955-1963,
Umsetzung des Universalitätsanspruchs dank der Entstehung neuer Staaten 1964-1973,
Aufbrechen des Gegensatzes zwischen Nord und Süd 1974-1986,
die Eröffnung neuer Chancen mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes 1987-1995,
neue Herausforderungen, Reformbemühungen und Enttäuschungen seit 1995,
die Gefahr von Beschädigung und Bedeutungsverlust seit 2003.
In dieser langen Entwicklungszeit der Funktions- und Arbeitsweisen der UNO stellten sich ihr – oder besser ihren entscheidungsmächtigen Mitgliedsregierungen – viele politische Herausforderungen und neue wirtschaftliche und/oder gesellschaftliche Probleme, die oft in eigendynamischen Prozessen zu unerwarteten Folgen führten sowie die Handelnden zu improvisierten Methoden zwangen. Die wohl wirkungsmächtigsten waren
die Blockade des Sicherheitsrates im Kalten Krieg zwischen dem Westen und dem Ostblock,
die Dekolonisierung der dann sogenannten „Dritten Welt“ und
die Probleme von deren „Entwicklung“ und Eingliederung in die Weltwirtschaft,
dann thematisch völlig neu und als „globaler“ Problemkomplex politisch vielschichtig die Gefährdung der natürlichen Umwelt und des Weltklimas,
mit diesen neuen Arbeitsgebieten auch der wachsende Einfluss der transnational operierenden Wirtschaftsunternehmen und das Auftreten von immer mehr neuartigen Mitspielern aus der sog. Zivilgesellschaft,
die Hoffnungen auf eine „neue Weltordnung“ und eine „Friedensdividende“ nach dem Ende des Ost-West-Konflikts – die zumeist heftig enttäuscht wurden,
der „Krieg gegen den Terror“ seit den Anschlägen vom 11.September 2001, der auch mit problematischen oder gar schädlichen Mitteln geführt wird – oft am Instrumentarium der UNO vorbei,
und damit eng verbunden die Gefahr der dauerhaften Konfrontation zwischen dem Westen und der islamischen Welt sowie des – hoffentlich nur nostalgischen – Wiederaufflackern des Kalten Krieges.
Wie die Gegner der Veto-Regelung befürchtet hatten, wurde die besondere Machtstellung der Großmächte – die diese ja eben verlässlich einbinden sollte in den politischen Prozess in der UNO – immer wieder genutzt, um das Funktionieren des Sicherheitsrates zu behindern oder gar zu blockieren. Die ständigen Mitglieder Großbritannien und Frankreich haben ihre Position nur selten (wie in der Palästina-Frage und in der Suez-Krise 1956) im engeren Eigeninteresse als ehemalige Kolonial- und Weltmächte ausgespielt. Aber im weltumspannenden und sich stetig vertiefenden Konflikt zwischen dem kapitalistischen und größtenteils demokratisch verfassten Westen und dem staatswirtschaftlich-kommunistischen und diktatorisch geführten Osten hatten rasch nur noch die Hegemonialmächte der beiden Blöcke entscheidende Bedeutung. Der politische Kampf zwischen dem amerikanischen und dem sowjetischen Imperium wurde mit allen diplomatischen und militärischen Mitteln auch auf ideologischer und wirtschaftlicher Ebene geführt; die neue Weltorganisation wurde zur meistbeachteten Bühne für den rhetorischen und symbolpolitischen Austrag der Gegensätze, aber sie war nicht die eigentliche Kampfarena, denn gültige Entscheidungen konnten ja eben wegen der Veto-Rechte der Protagonisten nicht zustandekommen. Solange der Westen in Sicherheitsrat und Generalversammlung noch Mehrheiten hatte, blieb dem Osten innerhalb der UN-Gremien nur eine konsequente Verweigerungshaltung, indem ein Veto eingelegt oder wenigstens angedroht wurde – oder schlicht durch eine „Politik des leeren Stuhls“ Sitzungen boykottiert wurden.
Dennoch befasste sich der Sicherheitsrat mit einer Reihe von internationalen Konflikten: Durch den Ost-West-Konflikt verursacht oder zumindest auf ihn bezogen waren die Berlin-Blockade 1948/49, der Korea-Krieg 1950-1953, der Ungarn-Aufstand 1956, die Kuba-Krise 1962, sowie der Indochina-Krieg 1946-54 bzw. Vietnam-Krieg 1964-1975; vom Ost-West-Gegensatz stark beeinflusst waren u.a. die Problemsituationen Iran 1946, Griechenland 1946-1950, Palästina 1947-1949, Indien/Pakistan 1948, Suez 1956 und Kongo 1960.
Weil ein unmittelbarer Konfliktaustrag wegen der Gefahr der gegenseitigen Vernichtung mit Atomwaffen nicht mehr möglich war, lieferten sich die Blöcke politische und militärische Kämpfe („Stellvertreterkriege“) in abgelegeneren Weltregionen, wo der Prozess der Entkolonialisierung und der politischen Emanzipation reichlich Konfliktstoff bot. Probleme der klassischen Sicherheitspolitik zwischen hochgerüsteten Großmächten bestimmten wie erwartet zunächst die Arbeit der UNO, aber es stellten sich sehr bald auch ganz andere Fragen der Friedenswahrung, die von den Autoren der Charta nicht vorhergesehen werden konnten. Neuartige inner- bzw. trans-staatliche Konfliktstoffe erwiesen sich als komplexer und schwieriger lösbar als es die herkömmlichen zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen gewesen waren; anti-koloniale Befreiungsbewegungen und postkoloniale Verteilungskämpfe sorgten in der eingefrorenen Schlachtordnung des Kalten Krieges für heiße Stellen und einige Brände.
Bis Mitte der 1960er-Jahre bildeten sich in der politischen Praxis Musterlösungen für Handlungsmöglichkeiten in und durch die UNO heraus, die ihre weitere Arbeit stärker prägen sollten als manche Absichten der Gründungsphase. Diese pragmatischen Lösungen hielten einer kritischen formalen Betrachtung oft kaum stand – aber sie funktionierten und wurden so als gängige Übung im Lauf der Zeit zur allseits akzeptierten Regel:
Während nach dem Text der Charta schon eine Enthaltung für ein Veto ausreicht, gilt es praktisch nur durch eine explizit abgegebene Nein-Stimme eines der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates als eingelegt.
Der Machtkampf um die Kompetenzen der einzelnen UN-Hauptorgane zeigte, dass die Rollenverteilung zwischen Sicherheitsrat und Generalversammlung nicht geklärt war; jedenfalls konnte die Generalversammlung durchaus weitergehende Ansprüche erheben, wenn der Sicherheitsrat nicht funktionierte (vgl. die „Uniting for Peace“-Resolution von 1950; siehe 6.2).
Zur Strukturierung des politischen Willens der Mitgliedsregierungen, zur Kanalisierung und Artikulation ihrer Interessen sowie zur Bündelung ihres Machtpotentials und ihrer Handlungsfähigkeit bewährte sich spätestens mit dem raschen Anstieg der Mitgliederzahl die Bildung von und die Zusammenarbeit in Ländergruppen als effizienteste Methode für multilaterale Verhandlungs- und Entscheidungsprozesse.
Der von der Charta mit der militärischen Komponente der kollektiven Sicherheit beauftragte Generalstabsausschuss ist nie ernsthaft eingesetzt worden, geschweige denn dass ein UN-eigenes Militärpotential aufgebaut worden wäre; wegen des militärischen Patts und der politischen Blockade zwischen den Blöcken blieben als Instrumentarium zur Kanalisierung und Eindämmung von Konflikten nur unkonventionelle und in der Charta in dieser Weise nicht vorgesehene „friedenserhaltende“ Maßnahmen – wie der Einsatz von Militärbeobachtern („Blaumützen“) und Friedenstruppen („Blauhelmen“).
Mit dem meist unfriedlichen Prozess der Dekolonisierung der abhängigen Gebiete entstanden Dutzende „junger Staaten“ – als List der Geschichte waren die wichtigsten untergehenden Kolonialmächte neben Belgien, Holland und Portugal die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates Großbritannien und Frankreich. Die neuen souveränen Staaten und UNO-Mitglieder wurden als die sog. „Dritte Welt“ neben der ersten (Nordwest) und der zweiten (Nordosten) wahrgenommen; sie ergänzten dann den Ost-West-Gegensatz um den insbesondere als wirtschaftlich verstandenen Nord-Süd-Konflikt.
Vielzahl und Vielfalt neuer Länder vor allem in Asien und Afrika veränderten die UNO und die multilaterale Diplomatie gründlich; zwischen 1945 und 1965 verdoppelte und bis 1975 verdreifachte die Weltorganisation die Zahl der ihrer anfangs 51Vollmitglieder (1955: 76, 1965: 117, 1975: 144) und bis heute hat sie die Anzahl – besonders wegen der Auflösung des östlichen Imperiums – fast vervierfacht (1985: 159, 1995: 185, 2005: 191; 2015: 193). Schon Anfang der 1970er-Jahre hatten die Ländergruppen der afrikanischen Staaten (über 40 Mitglieder) und der asiatischen Staaten (etwa 30) zusammen die Stimmenmehrheit in der Generalversammlung; die Gruppe der sog. Entwicklungsländer wuchs bis Ende der 1970er Jahre auf über zwei Drittel der Mitgliedschaft.
Größe und Bevölkerungszahl, Ressourcenausstattung und wirtschaftliches Potential, Kulturen und Religionen, politische Traditionen und Verfassungen variierten in der wachsenden Mitgliedschaft in den verschiedensten Mischungen. Damit wurde die UNO erst wirklich universal – und zugleich differenzierten und erweiterten sich die Interessen der Mitglieder. Die Schwerpunkte der internationalen Kooperation verlagerten sich allmählich auf die Probleme wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung; Konfliktstoff lag in der Frage, welche Strukturen des Welthandels dafür schädlich oder günstig waren. Die Führungsmächte der Blöcke bemühten sich, die neuen Staaten in die Ost-/West-Konfrontation auf ihrer Seite einzubinden, diese versuchten oft, den Ost-West-Gegensatz zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Auf fast allen Foren des UN-Systems wurde mit großer Rhetorik und viel politischer Energie der Nord-Süd-Konflikt geführt um
die angemessene entwicklungspolitische Orientierung für die auf- bzw. auszubauenden Wirtschaften und Gesellschaften zwischen den westlichen und östlichen Konkurrenzmodellen,
den Wunsch nach der Finanzierung von „nachholender Entwicklung“ („Entwicklungshilfe“),
internationale Gerechtigkeit und Ausgleich kolonialer Beschädigungen (Struktur des Welthandels, Fragen der Rohstoffe-Preise, Forderung einer „Neuen Weltwirtschaftsordnung“),
die Berechtigung zur politischen Nutzung der Knappheit bestimmter Rohstoffe, bes. des Erdöls (OPEC-Kartell),
Apartheid und Rassismus, die von der südlichen Mehrheit der UNO-Mitglieder neben Südafrika auch Israel vorgeworfen wurden,
Zweifel, ob das westliche Eintreten für die Menschenrechte im Osten und im Süden immer nach den gleichen Kriterien ausgerichtet sei.
Diese Probleme sind nicht erledigt, aber in den Hintergrund geraten: Nach 1989 ist mit dem Zusammenbruch des Ostblocks die konkurrierende System-Alternative zur kapitalistischen Marktwirtschaft und zum potentiell unbegrenzten Freihandel weggefallen. Von noch epochalerer Bedeutung war, dass die ungelösten Probleme der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Süden schon seit den 1970er-Jahren wachsende Konkurrenz bekommen hatten durch die globale Bedrohung für Umwelt und Klima – eben aufgrund der effizienten wirtschaftlichen Entwicklung des Nordens. Die Forderung nach „nachholender Entwicklung“ ist längst auskonkurriert von der Losung der „nachhaltigen Entwicklung“.
Nicht-staatliche Akteure aller Art aus der sog. Zivilgesellschaft haben nennenswerten und manchmal entscheidenden Einfluss gewonnen; verschiedene Typen neuartiger Akteure sind als (internationale) Nichtregierungsorganisationen oder kurz (I)NGOs immer stärker in Erscheinung getreten – wobei ihre politische Einschätzung kontrovers bleibt (siehe 7.7). Zumal die großen thematischen „Weltkonferenzen“ der 1990er Jahre boten ihnen politische Bühne und sachliche Bedeutung besonders auf den Arbeitsfeldern Zusammenarbeit in wirtschaftlich-sozialen Fragen, Menschenrechtsschutz und Umwelt- /Klimagefahren.
Ende der 1980er-Jahre kam dank des Kollapses des sowjetrussischen Imperiums weitere Bewegung in die Arbeit der UNO. Frohe Hoffnungen auf eine entscheidende Rolle der UNO in einer „neuen Weltordnung“ regten sich und Spekulationen über eine „Friedensdividende“ aus der Einsparung von Rüstungskosten zugunsten wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung kamen auf. Doch zeigten sich schnell und ernüchternd auch Probleme: Neue Mitgliedstaaten aus der Konkursmasse der Sowjetunion kamen zwar zur „Staatengemeinschaft“ dazu, aber scheinbar vergessene alte Konflikte brachen wieder aus (wie auf dem Balkan) und neuer Konfliktstoff entwickelte sich. Nicht immer gelang es den Mitgliedern des Sicherheitsrates, dessen Kompetenzen zur Friedenswahrung erfolgreich einzusetzen, auch spektakuläre Misserfolge (wie in Somalia) oder schlichtes Versagen (wie in Ruanda durch Nichtbehandlung) sind zu kritisieren. Die Friedensdividende fiel aus, aber Weltwirtschaft und Welthandel wuchsen und vernetzten – oder „globalisierten“ – sich rapide, was einige Länder der sich ausdifferenzierenden ehemaligen „Dritten Welt“ wirtschaftlich florieren, viele andere aber randständig bleiben ließ.
Das alles provozierte seit den 1970er Jahren bei der westlichen Führungsmacht wachsende Frustrationen über den multilateralen Betrieb. Die Vereinten Nationen waren wieder einmal in Gefahr, vom Hoffnungsträger zum Sündenbock zu werden. Zwar begleiten Forderungen und Überlegungen zu nötigen Reformen die UNO seit ihren Anfängen, aber vor allem auf Druck der USA wird sei den 1990er Jahren eine andauernde Reformdebatte geführt, in der von Verwaltungseffizienz über „Blauhelm“-Einsätze bis zu einer Erweiterung des Sicherheitsrates alles Denkbare und auch viel Irrationales auftauchte. Im Kontext von Menschenrechtsschutz und der Legitimität „humanitärer Intervention“ wurde schon vor den Terror-Anschlägen vom 11.September 2001 eine interkulturelle Konfrontation zwischen den westlichen Staaten und vor allem der islamischen Welt („clash of civilizations“) diskutiert – oder auch inszeniert. Im „Krieg gegen den Terror“ seit 2001 wurde jedenfalls mehrfach Völkerrecht verletzt und die UNO beschädigt – eben von ihrem Gründungspaten, den USA.
Die US-amerikanische Politik und Öffentlichkeit und deren jeweilige Haltung zu international-multilateraler Zusammenarbeit waren immer von grundlegender und entscheidender Bedeutung für die UNO. Ob idealistische Begeisterung („One World“) oder verschwörungstheoretische Ablehnung, war das Verhältnis meist prekär, denn es wird
rational durch die klassische Dynamik der schwankenden Doktrinen der Außenpolitik der USA gesteuert, einem an der UNO desinteressiertem Isolationismus einerseits und andererseits einem sie offensiv instrumentalisierenden hegemonialen Interventionismus,
kognitiv und emotional von meist schlicht bis schlecht informierenden Medien und von oft populistischen Politikern geprägt, was die öffentliche Meinung zwischen Liebe und Hoffnung einerseits und Frustration und Angst anderseits pendeln lässt.
Das Interesse an internationaler Politik ist bei der US-amerikanischen Wahlbevölkerung traditionell recht gering und das Wissen darüber ist noch geringer; deswegen überwiegen die Vorbehalte gegen die UNO vor allem bezüglich ihrer Effizienz, aber auch irrationale Befürchtungen vor ihrem angeblichen Machtanspruch, die amerikanische Souveränität zu mindern.
Auch deswegen war nie zu erwarten, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich in ihrer eigenen Politik substantiell von den Vereinten Nationen beeinflussen lassen würden, denn tatsächlich bietet ja asymmetrischer Unilateralismus einer Hegemonialmacht – zumindest auf kurze und mittlere Sicht – viel mehr Möglichkeiten als schwerfälliger Multilateralismus. Auch andere wichtige Mitgliedstaaten, allen voran die Sowjetunion/Russische Föderation und die VR China, verhielten sich selten wie vorbildliche Multilateralisten, aber die USA haben einen speziellen Sonderweg zwischen Unilateralismus und Multilateralismus gefunden:
Seit dem Versickern des Idealismus der Gründertage verfolgten sie meist einen instrumentellen bzw. selektiven Multilateralismus (siehe 2.2), der den Interessen der USA dienen, ihre Maßnahmen unterstützen und zumal ihre politischen Absichten legitimieren soll. Wenn internationale Kooperation in diesem Verständnis nicht funktionierte, versuchten alle US-Regierungen, ihre Ziele mit einer Koalition mit gleichgesinnten Regierungen („coalition of the willing“) oder im Alleingang zu erreichen. Die einzige verbliebene militärische Weltmacht kann unter den verschiedenen Angeboten je nach Bedarf das günstigste auswählen – solange China sich erst noch als Konkurrenz einübt.
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und dem daran angehängten „Krieg gegen den Terror“ ab 2003 sowie generell dank einer engen Sicherheits-Fixierung der Politik ist die UNO immer wieder in Gefahr, als multilaterales Instrument beschädigt zu werden und an Bedeutung zu verlieren. Wie in aller politischen Geschichte können auch in der Entwicklung der UNO schnelle und dichte Zeiten beobachtet werden, in denen rasch Vieles entschieden wird und Wichtiges passiert, und dann wieder Phasen der Konsolidierung oder gar des Stillstandes und scheinbaren Bedeutungsverlustes; die Qualitäten der Zeiten korrespondieren meist eng mit guten und schlechten Meinungskonjunkturen.
Literaturverweis zu 3.3.: Entwicklung der UNO seit 1945
Luard 1982/1989; Volger 1995, 2008; Weiss/Daws 2018; Yoder 1997