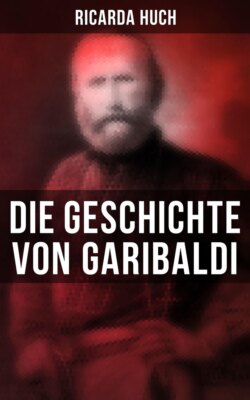Читать книгу Die Geschichte von Garibaldi - Ricarda Huch - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGaribaldi war kaum in Rom angekommen, als er wieder zu Pferde stieg und, nur von dem Mohren begleitet, einen Rundgang um die Stadt machte, um sich von der Beschaffenheit des Bodens in Hinblick auf die Verteidigung zu überzeugen und zu sehen, was zur Befestigung geschehen wäre. Oberhalb der Engelsburg stieß er auf eine hölzerne Brücke, die, um dem Feinde nicht zum Uebergange zu dienen, abgerissen werden sollte, und an welcher auch schon gearbeitet war, doch waren mehrere der größten Pfeiler stehen geblieben, sei es, daß man für unnötig gehalten hatte, sie zu entfernen, oder daß die Arbeiter, der dringenden Umstände ungeachtet, um die Nachmittagsstunde schon Feierabend gemacht hatten. Garibaldi sah sich nach Leuten um, die zugreifen könnten; da aber niemand in der Nähe war, fragte er mit den Augen den Mohren, ob er allein damit fertig würde, worauf dieser das Gerüst, das noch stand, mit einem hochmütigen Blick maß, nickte und zugleich den schwarzen Umhang, den er trug, abnahm und auf die Erde warf. Garibaldi stieg in das seichte Wasser des Ufers, fing an, die Schrauben loszudrehen, die das Holzgefüge zusammenhielten, und rüttelte versuchsweise an einem großen Balken, der widerstand. Der Mohr lächelte, schlang beide Arme um das Holz und zog mit dem ganzen Gewicht seines riesenhaften Körpers, wobei er ein dumpfes, langsam anschwellendes und ausrollendes Brüllen ausstieß, bis der Balken ächzend nachgab. Dann reckte er sich, trocknete den Schweiß ab, der ihm vom Gesicht lief, und watete tiefer in den Fluß hinein, um weiterzuarbeiten; sein Oberkörper stieg wie ein nasser, schwarzer Felsen, an dem das Licht sich spiegelt, aus dem gelben Tiberwasser. Während sie noch an der Arbeit waren, kam der Leutnant Nino Bixio, der am selben Tage aus Genua zurückgekommen war und Garibaldi begrüßen wollte, und da er von weitem sah, bei welcher Beschäftigung der General und der Mohr waren, beschleunigte er den Schritt, zog im Laufen schon den Rock aus und sprang mit einem Satze in den Fluß, um sich zu beteiligen. Garibaldi lachte und lobte ihn wegen seines Talentes, zur rechten Zeit zu kommen; nicht so stark wie der Mohr, doch robust genug, hantierte er mit so viel Sachkenntnis und Geschick, daß bald alles weggerissen war, was noch zum Vorteil des Feindes hätte dienen können.
Während Garibaldi den Lauf des Tiber verfolgen wollte, beauftragte er Bixio, von ein paar Soldaten, welchen er zuerst begegnen würde, die Porta Fabbrica nächst der Peterskirche verbarrikadieren zu lassen, wenn es nicht schon geschehen wäre, und da die Stadt von Truppen voll war, stieß Bixio bald auf ein Häuflein Legionäre, die er nach dem bezeichneten Tore mitnahm. In der Nähe desselben kamen ihm drei junge Offiziere entgegen, die denselben Rang wie er hatten, und da er nicht wußte, wieviel und welcherlei Arbeit es geben würde, rief er ihnen zu, sie möchten sich anschließen. Einer von den dreien war ein Neapolitaner, dessen Vater ein hoher Offizier in der bourbonischen Armee war, und zu dem er in unversöhnlichen Gegensatz getreten war, als er sich in den Dienst der Republik Rom begab, wobei es unklar blieb, ob ein feindseliges Verhältnis zum Vater diesen Schritt veranlaßt hatte, oder ob die Entzweiung eine Folge der abweichenden politischen Richtung war. Er war mit dem Anspruch nach Rom gekommen, von den Freiheitsmännern mit besonderer Rücksicht oder gar Bewunderung behandelt zu werden, weil er mit Verzicht auf äußere Vorteile aller Art auf ihre Seite getreten wäre, hatte aber auch Anwandlungen, wo er überzeugt war, daß man ihn als verächtlichen Ueberläufer ansähe oder den Haß gegen seinen Vater auf ihn übertrüge, was ihm eine Unsicherheit gab, die er aus Eitelkeit hinter kleinlichen Anmaßungen versteckte. Seine ganze Person, Haar, Augen, Stimme und Wesen hatten einen öligen Glanz, seine Gesichtszüge waren fein, aber schwächlich in die Länge gezogen und drückten meistens Langeweile, zuweilen eine müde, zärtliche Grausamkeit aus. Er wirkte im allgemeinen leicht abstoßend, nur die bezaubernden Formen seiner Höflichkeit und eine unabänderliche Traurigkeit, die von einem guten Beobachter unschwer als Grund seines Wesens zu erkennen war, konnten mit ihm versöhnen.
Da er feinfühlig, ja überempfindlich war, hatte er bei dem ersten flüchtigen Bekanntwerden bemerkt, daß Bixio ihn nicht leiden mochte, und sagte jetzt, in der Absicht, ihn zu reizen, kaum die Augen aufschlagend, mit einem nachsichtigen Lächeln: »Ihr sprecht vielleicht im Auftrage des Generals?« um anzudeuten, daß Bixio sein Ansinnen nicht fein eingekleidet und daß er ihm nichts zu befehlen habe. Die Art, wie diese Bemerkung gemacht wurde, hätte Bixio in jedem Falle geärgert; da ihm aber der Neapolitaner ohnehin zuwider war, stieg der Zorn ihm jäh in den Kopf, und er entgegnete kurz und unhöflich, er hoffe, jener wolle nicht die Moden der bourbonischen Armee in Garibaldis Heer einführen, worauf dieser wiederum, in demselben Geiste vornehmen Mitleids wie vorher, mit einem Spott über die Ungeschliffenheit der genuesischen Seeleute antwortete. Nun war Bixio so weit, daß er nichts mehr als den eignen oder den Tod des Gegners vor den siedenden Augen sah, und er schleuderte ihm das Gehässigste, was ihm einfiel, ins Gesicht, damit es nur schnell zu Handgreiflichkeiten käme: In Neapel gäbe es nur Räuber, Henker oder Spione, infolgedessen könnten die Neapolitaner und die Bewohner andrer italienischer Provinzen nichts miteinander gemein haben. Der andre erbleichte und griff nach seinem Säbel, und es wäre trotz der Einmischung der beiden andern auf der Stelle zum Schlagen gekommen, wenn nicht in diesem Augenblick Garibaldi erschienen wäre, bei dessen Anblick die Streitenden auseinander wichen. »Was muß ich sehen!« rief er. »Zwei meiner Offiziere, die Italien gegen die Völker Europas verteidigen sollten, ziehen am Vorabend der Schlacht den Säbel gegeneinander! Wenn ich das Vorgehen nicht bestrafe, geschieht es, weil ich hoffe, daß ihr morgen die Gelegenheit nutzt, es zu sühnen. Jetzt reiche der, der sich schuldig an diesem Auftritt fühlt, dem andern die Hand zur Versöhnung!« Er richtete bei diesen Worten die Macht seines Blickes auf Nino Bixio, der ihn trotzig eine Weile aushielt, ohne sich zu rühren; plötzlich aber nahm er sich zusammen, machte hastig einen Schritt auf den Neapolitaner zu und streckte ihm die Hand hin, die jener mit der seinen, einer länglichen, etwas behaarten Hand, vorsichtig wie etwas Unsauberes berührte. Garibaldi enthielt sich jeder weiteren Bemerkung, erteilte, als wäre nichts geschehen, den drei Offizieren in liebenswürdiger Weise einen Auftrag und wendete sich mit Bixio der Porta Fabbrica zu.
Unterwegs sagte er zu Bixio, der düster neben ihm herging: »Nino, Nino, dein Herz ist ein junger Bluthund, der an der Kette liegen muß; beeile dich, es abzurichten, damit ein edles Tier daraus wird, das frei ohne Maulkorb laufen darf, und vor dem nur die Schlechten zittern.« Bixio antwortete bescheiden: »Ihr habt recht, mein General; aber mir wäre wohler, als mir jetzt ist, wenn ich dem Skorpionsgesicht einen Säbelhieb durch sein niederträchtiges Lächeln gezogen hätte.« Garibaldi hielt sein Pferd an und rief entrüstet aus: »Ihr heillosen Zornteufel! Wenn man euch zusieht, muß man sich einen Narren schelten, daß man Blut und Schweiß vergießt, um einen gemeinsamen Stall für euch zu bauen. Er wird euch nur dazu gut sein, daß ihr um so besser miteinander raufen könnt.« Bixio wurde durch diesen Vorwurf beschämt und sagte kleinlaut, aber doch mit einer Hartnäckigkeit: »Mein General, immerhin werdet Ihr mir zugeben, daß ich auch gegen die hitzig werde, die von Rechts wegen meine Feinde sind.« Garibaldi erinnerte sich besänftigt daran, daß ihm berichtet worden war, Bixio sei vor einigen Tagen, als er, in Civitavecchia ankommend, dort die Franzosen gefunden hätte, aufgebracht über die Tücke, mit der sie sich eingeschlichen hätten, mitten in ihren Kriegsrat gestürmt, den sie gerade abhielten, und habe dem General Oudinot vor allen seinen Offizieren das unehrliche Verhalten vorgeworfen. Als Garibaldi ihn fragte, was daran wahr sei, bestätigte er es und sagte: »Oudinots Augen traten noch dümmer und größer hervor, während ich redete, und nachdem er sich lange genug besonnen hatte, nahm er meine Jugend zum Vorwand, um mir meine Keckheit zu verzeihen.« Und verlegen fügte er hinzu: »Hätte ich meinem Zorn Zeit gelassen, sich zu legen, hätte ich es unterlassen; denn im Grunde war es nur das ohnmächtige Kläffen eines gereizten Hündchens;« worauf Garibaldi ihn tröstete, er werde bald Gelegenheit finden, den Franzosen zu zeigen, daß er auch beißen könne.
Bixios Jugendgeschichte war wild und trübe. Er war einem elternlosen Kinde zu vergleichen; denn sein Vater, ein schwer zugänglicher Mann, dessen Brust vielleicht sorgfältig versteckte Träume mit mühelosem Leben füllten, beachtete seine Familie wenig und brach nur dann und wann, wenn ihr Dasein mit seinen Bedürfnissen ihn störte, rücksichtslos hart aus seiner Verborgenheit hervor; seine Mutter, die ihn liebte, Colomba Caffarelli, die jüngere Freundin der Mutter Mazzinis, starb jung in seinen ersten Kinderjahren. Seine Geschwister, die ungeleitet ihre Wege gingen, bedienten sich des Jüngsten nach Gelegenheit als Knecht, Spielzeug und Zeitvertreib, wodurch er sich gewöhnte, stets auf der Hut und von vornherein widerspenstig zu sein. Weil seine Welt in Unordnung war, denn es fehlte nun bald an Geld im Haushalt, da niemand sorgte und sparte, weil in seiner Welt das Faustrecht herrschte, wo jeder tat, was er durchsetzen konnte, sammelte sich gegen die ganze Welt in seiner Brust Haß und Verachtung. Auch die Schule bot ihm kein Beispiel der Ordnung und Gerechtigkeit; denn dafür, daß er ohne seine Schuld die vorgeschriebenen Bücher nicht hatte, mußte er sich von den Lehrern bestrafen und von den Mitschülern verlachen lassen.
Als sein Vater sich die zweite Frau nahm, war Nino schon, ehe er sie gesehen hatte, entschlossen, sie zu lieben, so warm und zärtlich war sein Herz. Die junge Frau ergriff die schwere Aufgabe, ein Haus voll halb erwachsener, verwilderter Kinder zu regieren, vielleicht nicht mit genug Klugheit und Güte; Nino hatte sie nur um so lieber, weil sie die ungebärdige Bande oft mit hilflosen Augen ansah. Das gute Verhältnis des Jüngsten zu seiner Stiefmutter ärgerte die Geschwister, und sie neckten und reizten ihn damit, bis er zornig wurde. Er hatte nämlich die Eigenheit, daß er, im allgemeinen gutmütig, hilfsbereit und dabei anspruchslos, wenn er bis zu einem gewissen Grade gereizt wurde, in krampfartige Wut ausbrach, so daß er sich blindlings auf den Neckenden warf, ohne die Folgen seines Angriffs zu berechnen. In diesem Zustande, wo seine Kraft verdreifacht war, konnte er auch älteren und stärkeren gefährlich werden. Von dem Augenblick an, wo die Erregung anfing, nach außen überzulaufen, war jeder Versuch, ihn zurückzuhalten, nutzlos und diente nur dazu, die Anwandlung bösartiger zu machen; man mußte sie wie eine Naturerscheinung vorübergehen lassen. Ihren Grund hatte diese Reizbarkeit in einer inneren Zaghaftigkeit, die sich mit leidenschaftlichem Streben schlecht vertrug; da er sich selbst mißtraute, überspannte er leicht die Kräfte und verlor dadurch das Gleichgewicht. Solange er klein war, hatten sie es als ein komisches Schauspiel angesehen, wenn er knurrte und gegen sie sprang wie ein wütender Affe, allmählich aber fingen sie an, solche Ausbrüche zu fürchten, und verklagten ihn nun bei seinem Vater. Sie schämten sich nicht, seine Eifersucht auf den fünfzehnjährigen Jungen zu lenken, und der Umstand, daß die arme Frau, um niemand zu kränken, ihre Zuneigung zu ihm zu verbergen suchte, bestärkte den übelberatenen Mann in seiner törichten Leichtgläubigkeit. Es kam dazu, daß er sie und Nino bedrohte, und daß dieser im Jähzorn seinen Vater angriff und ihn umgebracht hätte, wenn die Mutter selbst sich nicht dazwischengeworfen hätte. Nach einem solchen Auftritt verstieß der Vater, anstatt sich auf sein eignes Unrecht zu besinnen, den Jungen, der nichts gelernt hatte, keine Einsicht hatte, ja, nichts glaubte und wollte. Der lebte nun das wilde Leben eines Vagabunden und verschlang das Essen, das seine Mutter ihm heimlich auf die Schwelle setzte, wie ein kranker Hund, den niemand bei sich leiden will. Er träumte Haß, Rache, Blut und Mord, dürstete nach großen, schrecklichen Verbrechen und hätte wohl welche begangen, wenn das Meer nicht gewesen wäre; kam er auf seinen scheuen Wegen dorthin, so hielt es ihn fest, er lag stundenlang lauschend, und sein Herz wurde dabei still und frei. Wie er viel in der Nähe des Hafens umherlungerte, wurde er Schiffsjunge, kam in fremde Länder und erlebte vielerlei Abenteuer mir Flucht, Todesgefahr, Rettung und abermaligem Entweichen; mehr als unter der rohen Strenge der Vorgesetzten litt er unter dem Spott der andern Schiffsjungen, die den Herrensohn in ihm witterten und ihn nicht als ihresgleichen wollten gelten lassen. Er hatte keine Erziehung genossen und nur als Kind, solange seine Mutter lebte, das Beispiel anmutiger Sitte vor Augen gehabt, daher war er in seinem Benehmen unausgeglichen und ohne die freie Gelassenheit der Menschen, die sich zeitlebens in den durch gewisse äußere Formen ausgezeichneten Kreisen bewegt haben. Dennoch erkannte man an der eleganten Bildung seines Kopfes seinen Ursprung aus verfeinerten Schichten; alle Linien in seinem Gesicht waren bestimmt, bedeutungsvoll, kühn und zart zugleich, wie mit Silberstift von der Hand eines Künstlers gezogen, sie zeigten Verstand und Rücksichtslosigkeit ohne Roheit, ja sogar ohne robuste Veranlagung, vielmehr mit kindlicher Empfindung verbunden. Kaum war er heimgekehrt, als sein Vater, der ihn in die piemontesische Marine bringen wollte, die Polizei auf seine Spur brachte, und er versteckte sich eine Zeitlang, ließ sich dann von Gasse zu Gasse, von Winkel zu Winkel, von Dach zu Dach jagen, verhungert, knirschend, schäumend, um endlich doch dem verhaßten Geschick ausgeliefert zu werden, das ihm wohltat, indem es ihn zähmte und bildete. Zum ersten Male lernte er sich als Mensch mit Pflichten und Rechten fühlen, der vertrauen durfte, und dem andre vertrauten, für den es Aussichten und Hoffnungen gab; er ahnte hinter dem wüsten Durcheinander unruhig umgetriebener, qualvoll kämpfender Geschöpfe große, verzweigte Beziehungen, gewaltige Zwecke. Zeit, diese Fragen zu ergründen, hatte er nicht; aber das Bewußtsein schon, einem Volke anzugehören, das seine Dienste forderte, in einer Welt zu leben, die im Gesichtskreise großer Menschengeister schön und fehlerlos durchdacht erschien, hob und befestigte ihn. Gerade deswegen aber genügte ihm nach einigen Jahren das eintönige Dienen auf der sardischen Flotte nicht mehr; er lernte Mazzinis Schriften kennen, schwur auf seinen Namen und weihte sein Leben dem zu befreienden, eigentlich zu erschaffenden Italien. In Genua, wohin er ging, nachdem er die savoyische Uniform abgelegt und neuerdings allerlei abenteuerliche Meerfahrten bestanden hatte, waren seine Tage rebellischer Jubel, wahnsinniges Erkühnen um ein Nichts, um den Namen Pius IX. oder um ein verbotenes Lied, Triumphe vor der Schlacht. Er gewann in diesem Jahre einen Freund, Goffredo Mameli, der, ein Sohn des berühmten Admirals und der einer vornehmen Familie angehörigen Adele Zoagli, im Genuß heimischen Wohlstandes und heimischer Ehre aufgewachsen war und ebensoviel feine Sitte, harmonisches Wesen und Bildung besaß, wie Nino trotzig und ungleichmäßig war. Er war als kränkliches Kind von seiner Mutter in verzärtelnder Weise gepflegt worden, aber seine Phantasie zog ihn zum Kraftvollen und Heroischen. Seine dichterische Veranlagung schätzte er nicht hoch ein, und er war nicht stolz auf den Ruhm, den seine patriotischen Verse ihm eingetragen hatten; dies alles hätte er gern hingegeben, wenn er anstattdessen in einem Kriege oder sonst durch verwegene Taten zur Befreiung Italiens sich hätte auszeichnen können. Selbst seine Liebenswürdigkeit, das Weiche und Einschmeichelnde, was sowohl in seinen Zügen wie in seiner Weise sich zu geben lag und ihn beliebt machte, war ihm verdächtig als ein Zeichen von Schwäche, die ihn zu etwas Heldenhaftem untauglich mache. Mameli bewunderte an Bixio die Kraft, mit der er sich ohne Schutz und Hilfe aus Untiefen und Wüsten heraus zu den Höhen des Lebens kämpfte, seine kindliche Ahnungslosigkeit und Dreistigkeit vor den Gewundenheiten der Zivilisation, und schmiegte sich glücklich an die durch nichts zu erschütternde Felsenmasse seiner ungeteilten Liebe; Nino dagegen verehrte die reiche Kultur, die des jungen Patriziers Erbteil war, die Phantasie, die sein weiches Gesicht hundertfältig, immer anmutvoll bewegte, und das Vertrauen, das er in seine, Ninos, hohe Zukunft setzte. Da sie sich eins in ihren Hoffnungen und Zielen fühlten, wirkte ihre Verschiedenheit wie ein Zauber, der sie mehr in der geheimnisvollen Zärtlichkeit Liebender als in der selbstbewußten Zuneigung von Freunden oder Brüdern verband.
Als Garibaldi, mit Bixio von der Porta Fabbrica zurückkehrend, auf den Petersplatz kam, traf er mehrere Offiziere von der Legion und Angelo Brunetti, die sich ihm anschlossen, um den Monte Mario zu besteigen und von dort aus die Stadt zu überblicken. Auf der halben Höhe, da wo die Straße sich um den Hügel biegt und der Blick, gleichmäßig angezogen, zwischen der festlich blühenden Anhöhe und dem unendlich ausgegossenen Leben drunten auf und ab schwankt, begegneten ihnen mehrere von oben kommende junge Männer, Mailänder Offiziere, die ebenfalls an diesem Tage in Rom angekommen waren und vom höchsten Gipfel der Umgebung aus sich eine Ansicht von der ihnen unbekannten Stadt hatten bilden wollen. Es waren Luciano Manara, derselbe, der während der fünf Tage von Mailand den entscheidenden Kampf an der Porta Tosa geleitet hatte, und seine Freunde, die Brüder Enrico und Emilio Dandolo, Emilio Morosini, Signoroni, Mancini und andre, die alle die Uniform des neugegründeten Regiments der lombardischen Bersaglieri trugen, nämlich dunkelgrünen Rock und ebensolche Hosen mit karminroten Kragen, Aufschlägen und Streifen, goldene Epauletten und einen schwarzen Filzhut, über dessen breite Krempe auf einer Seite lange grüne Federbüsche herunterhingen. Da Goffredo Mameli Manara kannte, ihn begrüßte und alle stehen blieben, sprang Garibaldi vom Pferde, denn jene waren zu Fuß, bot Manara die Hand und sagte zuvorkommend: »Es möge für Rom ein gutes Zeichen sein, daß Ihr, der so jung schon Heldenruhm errungen hat, kurz vor dem Kampf hier eintrefft.« Manara grüßte höflich, aber seine blauen Augen blieben kalt und sein schmales, gebieterisches Gesicht schien Garibaldis gütige Worte gleichgültig zurückzuwerfen, indem er sagte: »Man kämpft leicht gut und glücklich für sein Vaterland; ich habe das meinige verloren.« Was ihn denn nach Rom geführt habe, fragte Garibaldi ruhig. »Die Not,« antwortete er hart; »Rückkehr nach Mailand gab es für uns nicht, auch in Piemont war unsers Bleibens nicht, hier finden unsre Soldaten Sold und Beschäftigung, und wo gekämpft wird, ist Leuten unsers Schicksals am wohlsten.« Jetzt nahm Brunetti das Wort und sagte halblaut zu Daverio und Montaldi, doch deutlich genug, um von allen verstanden zu werden: »Sie werfen ihr Almosen beileibe nicht aus Mitleid oder Liebe, sondern weil es sie drückt und sie es sonst nicht loszuwerden wissen.« Manara drehte sich rasch nach dem Sprecher um und sagte: »Wir brauchen hier wenigstens nicht bange zu sein, ob wir es loswerden, in einer Stadt, wo nur Bettler und Faulenzer einheimisch sind;« vielleicht ohne zu wissen, daß er mit einem Römer sprach, vielleicht gerade in der Absicht, ihn zu verletzen. Indes verzog Brunetti seine dicken Lippen zu einem belustigten Lächeln, warf sich in die Brust, um die natürliche Majestät seiner Haltung komisch zu übertreiben, und sagte, mit der Hand auf Manara weisend, zu den andern: »Wenn wir ein Geschichtsbuch zur Hand nehmen, können wir lesen, daß seine Väter erschrocken den Buckel krümmten, wenn die Väter der ärmsten Fischverkäufer in Trastevere niesten.« Der Scherz und der Mann gefielen Manara, so daß er mit Mund und Augenwinkeln zu lächeln anfing, während er ihn mit unverhohlenem Wohlgefallen betrachtete; allein es kamen ihm sogleich wieder trübe Vorstellungen, und er sagte bitter, wenn auch ohne Unfreundlichkeit: »Jetzt niest es im Norden statt im Süden, aber krümmen und ducken müssen wir uns wie damals.«
Unterdessen hatte Garibaldi sein Pferd wieder bestiegen, grüßte die Mailänder Herren und sagte mit Bezug auf die ersten Worte, die gewechselt waren: »Ich bedaure für euch, daß es ist, wie ihr sagt; es muß etwas Trauriges sein, für eine gleichgültige Sache zu kämpfen;« worauf die beiden Gruppen sich trennten und Garibaldi mit den Seinigen weiter den Monte Mario hinaufritt. Es entspann sich sofort ein erregtes Gespräch über Manara, dessen Benehmen und Reden Daverio und Nino Bixio entrüstet hatten, während Mameli ihn zu verteidigen suchte, das aber Garibaldi mit den Worten abschnitt, Manara sähe aus wie ein Edelmann und wäre es sicherlich; das Unglück seines Vaterlandes und sein eignes hätten wohl sein Gemüt verdüstert, man solle mit Leidenden nicht rechten.
Auf der Höhe des Berges angekommen, betraten sie den Park, der seine Stirn wie eine schwarze Krone umschlingt, und gingen durch Alleen von Zypressen und Steineichen bis zu der Plattform, von welcher aus der Blick das Meer der Stadt in seinen Grenzen umfaßt. Garibaldi trieb sein Pferd bis zum Rande vor und weidete seine Augen an dem Bilde Roms, das, die letzte Glut der Sonne verschlingend, in Purpur starrte. »Wer dieses Gipfels Herr ist, dem gehört Rom,« sagte er zu den übrigen, die, nachdem sie sich umgesehen hatten, sich einige Schritte zurückzogen, weil sie wußten, daß Garibaldi es liebte, wenn große Entscheidungen bevorstanden, allein sich die Gestaltung des voraussichtlichen Schlachtfeldes einzuprägen. Sie holten aus einem nahegelegenen kleinen Wirtshause Wein, Brot und Käse und fingen, auf einem freien Platz gelagert, zu essen an, währenddessen Montaldi erzählte, in Amerika sei der Glaube allgemein gewesen, daß in der Nacht, die einer Schlacht vorhergehe, ein Dämon Garibaldi auf das Schlachtfeld führe, ihn alle Bewegungen des Feindes sehen lasse und ihm zeige, wie er sich halten müsse, um zu siegen. Bixio erzählte sein Erlebnis mit dem Neapolitaner und wie Garibaldi ihn zurechtgewiesen habe und sagte, er liebe Garibaldi am meisten, wenn er gegen ihn zürne, obwohl er sich gleichzeitig dadurch vernichtet fühle; es gehe ihm insofern mit Garibaldi wie mit dem Meere, das er immer schön finde, wenn es mit sich selbst spiele wie ein Kind, wenn es den schäumenden Mantel seiner Gottheit entrolle, aber am schönsten, wenn er vor seinen Stürmen zittre. »Seine Augen sind wie das Meer,« sagte Mameli sinnend, »ich habe mich oft gewundert, wie sie, in ein so schmales Bett gedrängt, so unermeßlich wirken können. Sie haben keine und alle Farben, das Licht phantasiert darin, sie sind kalt, grausam, barmherzig, undurchdringlich, allmächtig; wenn man sie anschaut, ahnt man die letzten Dinge, die man sonst nicht nennen kann.«
Es verging eine geraume Zeit, bis Garibaldi sich wieder zu den Offizieren gesellte, die inzwischen ihren Imbiß beendet hatten; er aß noch etwas, wobei er nicht viel Zeit zu verlieren pflegte, und dann traten sie den Rückweg an in der Weise, daß der General, der schweigsam geworden war, voranritt und die andern langsamer folgten. Auf dem steinernen Treppenvorsprung vor der hochgelegenen Kirche Maria del Rosario saßen zwei augenscheinlich zur Kirche gehörende Geistliche, Männer mit dunkeln, scharfgeprägten Gesichtern, die die angenehme Lauheit des späten Abends genießen mochten und beim Anblick der vorüberreitenden Offiziere mit der Hand grüßend riefen: »Es lebe die Republik! Es lebe die republikanische Armee!« und ihnen aufmerksam nachsahen. Die Luft war weich vom Geruch der Akazien, die weißlich aus den schwarzen Baumgruppen am Wege schimmerten, der wolkenlose Himmel schien einen schönen Tag zu versprechen. Da aus dem dunkelblauen Dunste ein großer Stern wie ein Geharnischter des himmlischen Heeres in glitzernder Rüstung hervortrat, sagte Mameli hinaufdeutend: »Der Stern Italiens!« worauf alle mit dem Gefühle einer glücklichen Vorbedeutung nach oben und dann auf den weißen Mantel Garibaldis blickten, den die vom Ritt erregte Luft gelinde hob und lautlos bewegte.
*
Die Offiziere der mailändischen Bersaglieri waren meist untereinander befreundete vermögende junge Herren, die sich aller glücklichen Kräfte ihrer Jugend erst recht bewußt geworden waren, seit sie nach Manaras Beispiel die Anstrengungen und Gefahren des Kriegslebens unter unglücklichen Umständen auf sich genommen hatten; der Feldzug gegen Oesterreich im Jahre 1848 war schlecht geleitet, das Heer mit dem Notwendigsten nicht versorgt, die unerfahrenen Offiziere fast ganz auf ihre Talente und Eingebungen angewiesen, mit unverhältnismäßiger Verantwortung belastet. Wie nun aber die aus Mailand und Savoyen ausgestoßene Truppe sich über die Apenninen nach Rom durchschlug ohne Mittel und Unterstützung, das war eine Leistung, die zeigte, wie erfolgreich die jungen Anführer, namentlich der Hauptmann Manara, sich selbst erzogen und die Soldaten geschult hatten.
Dem Luciano Manara ordneten sich alle unter, obwohl er nicht der älteste war, nicht nur in militärischen Dingen, wo es seine Stellung mit sich brachte, sondern auch im bürgerlichen Leben. Das war nicht dem Umstande zuzuschreiben, daß er verheiratet war und Kinder hatte, während die andern fast alle Junggesellen waren, vielmehr einem seelischen Uebergewichte; in ihm war kindlich arglose Gemütsart mit einem energischen Pflichtbewußtsein verbunden, dem er sich unbedingt opferte, und zwar hielt er für seine Pflicht, was nach seiner Lage und den Zeitverhältnissen das Schwerste war. Ein Trieb, von dem ihm selbst nichts bewußt war, zog ihn vom behaglichen Genusse fort dahin, wo Kampf und Mühe um etwas Großes war; während aber andre zwar im Drange des Augenblicks Opfer auf sich nahmen, aber bald erlahmten und sich wieder zu entziehen suchten, ließ er nicht nach, sondern eben das Herzblut, das eine Sache ihn kostete, band ihn immer fester an sie. Doch war er, wie seine Freunde, keineswegs leicht zu begeistern, außer für das, was herkömmlicherweise in seinem Umkreise lag, nämlich die Unabhängigkeit Mailands und etwa noch ein in edeln Formen ausgeprägter Gottesglaube, welcher letztere freilich hinter den gegenwärtigen Bedürfnissen der ringenden Vaterstadt zurücktrat. Ohne im mindesten ehrgeizig zu sein, hatte er, was ihm irgend erreichbar war, getan, um seinen Geist auszubilden im Gefühl, daß seine Leistungen mit seinem Glückszustande im Gleichgewicht sein müßten. Als Offizier von fünfundzwanzig Jahren, denn er war erst so alt, als Mailand sich von Oesterreich losriß, traten oft Aufgaben an ihn heran, denen er bei seiner geringen Erfahrung nicht gewachsen war; in solchen Fällen scheute er sich nicht, begangene Fehler einzugestehen und wenn möglich wieder gutzumachen. Nach der stetigen Anspannung der Willenskraft war in den Stunden der Erholung seine Fröhlichkeit die eines Knaben, der die karg zugemessenen Ferien glücklich genießt, und sein Gesicht, das meist einen streng gefaßten, stolzen Ausdruck hatte, veränderte sich dann bis zur Unkenntlichkeit, harmlosen Uebermut ausstrahlend. Er verstand es, mit den Untergebenen lustig zu sein, ohne das Ansehen bei ihnen einzubüßen.
Die Brüder Dandolo waren zarte Söhne einer frühverstorbenen Mutter und eines gelehrten Vaters, die Klugheit, Geschmack und Empfindung, aber weniger Kraft und Geschlossenheit besaßen. In der Luft eines vornehmen Daseins aufgewachsen und zu hohen Zielen erzogen, dachten und strebten sie niemals unedel; aber wie die Schiffer, die ein gebrechliches Fahrzeug haben und keine kühnen Steuerer sind, sich stets dicht an der heimischen Küste halten, so schreckten sie mißtrauisch vor fremdem und stärkerem Leben zurück, weil sie fürchten mußten, bei der Berührung sich selbst zu verlieren oder unterzugehen. Enrico, der ältere, hatte die Schönheit eines reizenden Mädchens, die, obwohl nur sich selbst und nichts andres bedeutend, auf unerschöpfliche Schätze der Seele schließen läßt. Er war tapfer und pflichttreu ohne Begeisterung, nur so, als ob es zum Spiel gehöre, wie er überhaupt alles, was er tat, in einem gefälligen, zwecklosen Spiel, das ihm Vergnügen machte, zu tun schien. Gefühl verriet er selten, doch lag zuviel davon in seiner Erscheinung und seinem Wesen, als daß er kalt hätte wirken können. Auch sein Witz, in dem viel Spottlust war, konnte nicht kränken, weil er im Grunde nur um der Anmut seines flüchtigen Daseins willen gemacht zu werden schien. Mit seiner zierlichen Eigenart erschien er jünger als Emilio, der sich auch als der ältere fühlte und betrug; er war ernster und sehr erregbar und leicht zu verstimmen, wie seine Gesundheit schwächer und empfindlicher war. Er liebte Manaras wunderschöne Frau, die, wie er selbst, den Keim einer tödlichen Brustkrankheit in sich hatte, ohne auf Gegenliebe zu hoffen, und ohne das unglückliche Gefühl zu bekämpfen, das sie ahnte, und das Manara völlig durchschaute. Alle drei hüteten das glühende Geheimnis, das sie eher inniger verknüpfte als trennte, da jeder dem andern uneingeschränkt vertraute; es kam vor, daß Emilio sich gereizt und unwillkürlich ungebärdig gegen Manara zeigte, dessen schonende Liebe dadurch nicht erschüttert wurde. Rosagutti, Signoroni, Mancini gehörten gleichfalls wohlhabenden Familien an, die seit dem ersten unglücklichen Versuch Mailands, sich unter dem Schutze Savoyens von Oesterreich loszureißen, eine große patriotische Verschwörung bildeten, deren Ziel zunächst war, eine Gelegenheit abzuwarten und inzwischen an Oesterreich vorbeizuleben. Der jüngste von allen war der achtzehnjährige Morosini; seine Seele schwebte noch in einer goldenen Kindheitssphäre, die die Freunde als etwas Heiliges hüteten, in der sie sich nur mehr von außen spiegeln konnten, deren ungetrübte Vollkommenheit sie aber mit den guten und glücklichen Mächten des Daseins zu verknüpfen schien.
Unzertrennlich zu ihnen gehörte Alessandro Mangiagalli, Manaras Kutscher, der den Feldzug als gemeiner Soldat begonnen und bald den Unteroffiziersgrad erreicht hatte, und von dem man bei seiner Umsicht, Pünktlichkeit und Tapferkeit glaubte, daß er eine noch steigende Laufbahn vor sich habe. Er hatte von jeher ein besonders vertrauliches Verhältnis zu Manara und seinen Freunden gehabt, was teils in dem Umstande lag, daß er einige Jahre älter als sie war, sodann in seinem Wesen; er war zu allem zu gebrauchen, wußte immer Rat und Hilfe und war nie übler Laune, so daß er den jungen Männern fast unentbehrlich geworden war. Bildung besaß er keine, aber sein gefälliges Temperament und seine mannhafte Erscheinung kamen bis zu einem hohen Grade dafür auf. Er liebte Manara mit unbedingter Treue, aber tyrannisch und eigensinnig, wogegen Manara sich durch scharfes Hervorkehren seiner Herrschaftsstellung nicht immer erfolgreich zu wehren suchte.
Nach der Begegnung mit Garibaldi aßen die Freunde im Gasthof »zum Pavian« zu Nacht und sprachen von ihm, den keiner von ihnen zuvor, außer im Bilde, etwa in den groben Holzschnitten revolutionärer Blätter, gesehen hatte. Mangiagalli, der die Herren beim Essen bediente, machte, während er Wein einschenkte, die Bemerkung, er hätte nicht geglaubt, daß Garibaldi so schön wäre; er wäre unter den Menschen, was der Löwe unter den Tieren, die die Nase in den Sand steckten, wenn sein Haupt wie die Sonne am Rande der Wüste aufginge. »Der Mann ist schön, aber sein Kleid ist mir zu bunt,« sagte Manara kühl, und Enrico Dandolo fügte mit süßlächelnden Augen und sanfter Stimme hinzu: »Mir gefällt der Mohr am besten; er ist zweifelsohne aus Afrika oder Amerika, während Garibaldi nur aus Nizza ist, geht halbnackt und hat vielleicht schon Menschenfleisch gefressen. Wäre noch ein Affe und ein Papagei dabei, so würde ich an dem Aufzuge nichts vermissen; das können die roten Jacken des Generalstabes nicht ganz ersetzen.« Während die andern lachten, fuhr Mangiagalli unbekümmert fort: »Vor ihm sind alle andern Knechte, denn was er zu ihnen sagt, ist immer Befehl, wenn er auch höflich bittet, und was man zu ihm sagt, klingt immer wie ›zu dienen!‹, wenn einer auch ›zum Teufel!‹ sagte.« Manara wendete den Kopf nach ihm herum und sagte gereizt: »Du bist zum Bedienen da und nicht zum Reden;« indes Signoroni meinte gutmütig: »Laß ihn doch, er redet besser, als er bedient, und wenn er an einem verhaltenen Worte erstickte, so hättest du zwar nur einen störrischen Diener, aber das Vaterland hätte einen angehenden Helden verloren.« – »Meinetwegen möchte er sprechen, so viel er kann,« sagte Enrico Dandolo, »wenn er nur uns und keinen andern lobt.« Auf diese Aufforderung fiel Mangiagalli sofort ein und sagte: »Ich müßte nicht ein Mensch, sondern ein Spiegel sein, wenn ich eure Vorzüge schildern wollte, ohne hinter der von der Natur erschaffenen Schönheit zurückzubleiben. Aber die Bemerkung kann ich nicht unterdrücken, daß ich an keiner Tafel einen Herrn und nicht einmal eine Dame gesehen habe, die einen Hühnerknochen mit so schmalen Fingern so edel gehalten und mit so glänzenden Zähnen so anständig benagt hätte.« Es war bekannt, daß der junge Dandolo seine Schönheit wie ein liebes Wesen, das ihm anvertraut wäre, pflegte, sie auch ebenso gern rühmen hörte, und alle belachten den Scherz. Manara konnte. obwohl er auf die Heiterkeit der andern einzugehen versuchte, die Verstimmung, die ihn drückte, nicht verbergen. Es waren nämlich die Bersaglieri in Civitavecchia durch die Franzosen, die dort die Herrschaft an sich gerissen hatten, festgehalten und nur gegen das Versprechen freigelassen worden, vor dem 4. Mai in keinen Kampf gegen die Franzosen einzutreten, bis zu welchem Zeitpunkt Oudinot siegreich in Rom zu sein rechnete. Jetzt gestand Manara, daß er sich überlistet fühle: »Es hätte mich gelockt,« sagte er, »neben diesem Garibaldi zu kämpfen, der allen Ruhm der Tapferkeit, der in Italien aufgeht, an sich zieht und mit einer Hoheit erscheint, als müsse es so sein, und ihm und allen zu zeigen, daß es bei uns auch Soldaten gibt, die Mut und Ehre haben. Vielleicht habe ich nichts andres gegen ihn, als daß ich ihn beneide, weil er das Recht hat, sich zu schlagen, und ich zusehen muß. Ein blinder Narr war ich, dem Franzosen mein Wort zu geben; er hätte uns doch müssen ziehen lassen! War es nicht klar, daß er am 4. Mai schon alle Arbeit getan glaubte?« – »Mir war es klar,« brummte Mangiagalli, »und ich sagte es auch; aber weil ich schweigen muß, wurden meine Worte zwar gehört, aber doch auch wieder nicht gehört, nämlich nicht in Betracht gezogen.« – »Schweig,« rief Manara zornig, »du bist auf der Stelle entlassen!« worauf Mangiagalli sich schnell auf den Hacken herumdrehte und der Tür zueilte, indem er rief: »Hurra! Ich laufe zum Garibaldi und kämpfe morgen mit!«, aber von den jungen Leuten unter Gelächter ergriffen und zurückgebracht wurde. »Wärest du auch aus meinem Dienst entlassen,« erklärte Manara, »so wärest du es doch nicht aus meiner Truppe. Aber du magst in Gottes Namen noch einmal bei mir bleiben, wenn ich auch froh wäre, der Verantwortung für einen so unzähmbaren Menschen ledig zu sein.« – »Ich fände auch wohl einen bequemeren Herrn,« erwiderte Mangiagalli, »aber ich habe der gnädigen Frau bei meiner ewigen Seligkeit geschworen, für Euch zu sorgen und über Euch zu wachen; darum bleibe ich.« Er konnte es nicht vertragen, wenn die häufigen Wortwechsel mit seinem Herrn abschlossen, ohne daß er als der letzte gesprochen hätte, und da Manara diese Eigenheit kannte und nicht dagegen aufkommen konnte, hatte er sich angewöhnt, den unausbleiblichen letzten Satz zu überhören.
*
Wie vor dem eilenden Schiff her sich Wellen ausbreiten, bebte die Luft vor der nahenden Sonne, als am 30. April des Jahres 1849 die Türen der Häuser sich öffneten, Männer und Knaben mit allerhand Waffen auf die Gasse heraustraten, nach den Fenstern zurückblickten, aus denen ihnen Gruß und Segen nachklang, und nach den Wällen liefen. Angelo Brunetti ging mit seinen beiden Söhnen, von denen auch Luigi, der jüngere, eine zierliche Flinte trug, damit er nicht wehrlos sei, und seiner Frau, die das jüngste Kind auf dem Arme trug und die kleine Maria an der Hand führte, den Korso hinunter. Auf der Piazza Venezia blieben sie stehen, um Abschied zu nehmen, denn es war ausgemacht, daß Lucrezia dort umkehren und die beiden kleinen Mädchen nach Hause zurückbringen sollte. Sie empfahl ihrem Mann und ihren Söhnen, in der Peterskirche ein Gebet zu sprechen und noch vor dem Kampfe von Vater Ugo Bassi den Segen zu erbitten, und küßte sie dann nacheinander, indem sie sagte: »Ich weine nicht!« und sie fest aus ihren strahlenden Augen ansah, die dennoch feuchter und milder als sonst waren. Brunetti umarmte die Kleine, beugte sich über das schlafende Kind, dessen Kopf auf der Mutter Schulter lag, und küßte seine Hand, die wie ein winziger brauner Hügel aus allerlei buntem Zeug hervorguckte; dann gingen sie nach entgegengesetzter Richtung auseinander.
Nun stürmte die Sonne an den Hügeln hinauf in den Aether und entzündete das feurige Spiel des Lebens: Roms göttlicher Leib hob und wölbte sich in Licht und Schatten und übergoß sich mit dem Balsam seiner immergrünen Gärten. Dem Tore von San Pancrazio gerade gegenüber lag, höher als alle andern Häuser am Janiculus, Villa Corsini, die auch »das Haus der vier Winde« genannt wurde, und die, weil sie der wichtigste Punkt im Umkreise war und die weiteste Aussicht ermöglichte, Garibaldi zu seinem Standquartier gewählt hatte. Die leichte Pracht des reizenden Palastes sprach von dem Kunstsinn und der vornehmen Ueppigkeit seiner Erbauer; das Innere war mit Wandgemälden geschmückt, das Treppenhaus und die Gänge mit alten Bildwerken, die zum Teil in den Gärten des Hadrian waren ausgegraben worden. Wenn man über die breite Freitreppe in die Eingangshalle trat, fiel das Auge auf eine große Marmorgruppe, die nach der Meinung der meisten Kunstkenner Achilles darstellte, der den toten Patroklus beklagt; die Formen waren kaum noch kenntlich; aber der leidenschaftliche Gegensatz in der Bewegung des Lebens und des Todes, die der Geist eines unbekannten Künstlers vor Jahrhunderten wie einen Blitz in den Stein geschleudert hatte, war durch die Zertrümmerung erst befreit und völlig sichtbar geworden.
Von dem eleganten Turme der Villa sah Garibaldi die französische Armee über die Aurelianische Straße heranziehen und sich gegen den Vatikan und den Janiculus verteilen. Er dachte daran, daß das die Armee war, auf die noch ein Leuchten von dem untergegangenen Namen des großen Napoleon fiel, an die er nie anders als mit Bewunderung gedacht hatte, in deren Mitte zu kämpfen er früher stolz gewesen wäre. Er wußte und sah als geübter Feldherr, wie überlegen diese Truppen den seinigen waren, nicht nur durch die Zahl: sie waren erfahren, ausdauernd und tapfer nicht aus der Leidenschaft der Begeisterung oder des Hasses, sondern aus Gehorsam, Gewohnheit und Ehrliebe, Tugenden, auf die man sich verlassen konnte. Anstatt aber durch den Anblick einer solchen Kraft des Feindes erschreckt zu werden, fühlte er sein Bewußtsein gehoben; es hätte ihn nicht befriedigt, sich vor den Toren Roms mit einem geringen Gegner zu messen. Langsam ging er die Treppen hinunter, warf einen Blick auf die Gruppen der Marmorbilder und sprengte dann nach dem Tore von San Pancrazio zurück, wo sein Stab und seine Regimenter ihn erwarteten. Es waren ihm zu seiner Legion noch die Kohorte der Studenten unter dem unentwegten Zamboni, die Freiwilligen, welche noch mit dem Segen Pius' IX. ausgezogen waren und im Venezianischen gekämpft hatten, und schließlich die Abteilung der Finanzieri unter jenem Zambianchi zugeteilt, dem Gutes nachzusagen niemand wußte und Böses niemand wagte. Von den aus Venedig Heimgekehrten abgesehen, kannten diese Körper den Krieg noch nicht und kämpften heimlich gegen das Grauen der Schlacht, mit dem Unterschiede, daß die Finanzieri sich mehr vor der Gefahr, die Studenten mehr vor der Pflicht zu töten oder dann vor den Tücken ihrer unbefestigten Natur fürchteten. Aber wie Kinder, die allein im Dunkel verirrt sind und vor dem struppigen Haupt der alten Weide und vor dem Flüstern unsichtbarer Nachtgesichte zittern, aufatmen, wenn sie den Schritt des Vaters hören, der sie sucht, so verschwand die Beklemmung, als Garibaldi erschien und mit heller Stimme, aus der vor dem Beginn des Kampfes schon die Glorie des gewissen Tags strahlte, ihre jubelnde Begrüßung erwiderte. Seine Seele breitete sich gegenwärtig über dem ganzen Heere aus wie ein neues Element, in dem man siegt.
Der Verlauf des Tages war so: die Franzosen griffen zuerst den Vatikan an, wo sie von einem römischen Linienregiment unter General Galletti und den Kanonen des Ludovico Calandrelli empfangen und aufgehalten wurden; zugleich versuchten sie mit ihrem rechten Flügel die Villen im Parke Doria, der den Monte Verde krönt, zu nehmen, und es gelang ihnen, die Villa Valentini, nicht aber die Villa Corsini zu besetzen. Das Feuer der römischen Kanonen erwiderten sie durch Geschütze, die sie auf den Resten der Aurelianischen Wasserleitung aufstellten. Ihr Ziel, das sie kühn und hartnäckig verfolgten, war, von zwei verschiedenen Seiten, vom Vatikan und vom Janiculus aus, in Rom einzudringen und beide Flügel auf dem Petersplatz zu vereinigen. Erst am späten Nachmittage, als Garibaldi aus den Toren Pancrazio und Cavallegieri zugleich ausfiel, den Angriff selbst leitend, mußten sie weichen, gaben alle ihre Stellungen auf und versuchten nicht mehr, den Kampf zu erneuern.
Etwa um die dritte Nachmittagsstunde kam Goffredo Mameli mit einer leichten Wunde zu dem Torgebäude von San Pancrazio, wo die abgelösten Truppen sich mit Wein und Brot erfrischen und wo auch kleinere Verwundungen verbunden werden konnten; es hatte ihn ein Schuß, der sein Pferd tödlich getroffen hatte, am Fuße gestreift. Wenn auch bekümmert über den Verlust des Tieres, freute er sich doch der ersten Wunde, die ihm endlich das Gefühl gab, sich wie ein rechter Soldat geschlagen zu haben, denn bisher war ihm immer zumute, als spiele er nur, während die andern arbeiteten, ja, als erteile ihm Garibaldi absichtlich Aufträge, bei denen er keiner Gefahr ausgesetzt sei, weil er ihm wohl Begeisterung zutraue, aber nicht Geistesgegenwart und vernünftiges Tätigsein. Der alte Doktor Ripari, Garibaldis Leibarzt, ein Cremonese, kam bald hernach, untersuchte Mamelis Wunde und erzählte, während er sie verband, von einem jungen Genuesen, namens Ghiglione, der soeben in seinen Armen verschieden sei und ihm sein Pferd vermacht habe; es war ein Blesse, ein großes schwarzes Tier mit weißen Flecken an der Stirn und an einem Hinterfuße. Der junge Mann, sagte er, sei kurzsichtig, aber sehr verwegen gewesen, Garibaldi selbst habe ihn gewarnt, sich nicht zu weit vorzuwagen, worauf er lachend geantwortet habe, er müsse das seines kurzen Gesichts wegen tun, da er den Feind sonst nicht erkenne; da habe ihn denn bald darauf der Tod ereilt. »Ihr jungen Leute,« sagte scheltend der Alte, der seinen Kummer über das Leiden und Sterben des tapferen jungen Blutes, das er mitansehen mußte, durch Brummen über die wirklichen oder vermeintlichen Ursachen desselben zu äußern pflegte, »führt den Krieg auf eine besondere und nicht die rechte Weise. Ihr meint, er wäre für euch da, damit ihr Wundertaten verrichtet und euch auszeichnet, und anstatt sie klug zu vermeiden, sucht ihr die Gefahr; die Wunden tun ja erst hernach weh. Wir brauchen keine Zweikämpfe, keine Keckheiten, die später der Daheimgebliebene kopfschüttelnd bewundern muß! Ordnung und Plan brauchen wir, gehorsame Soldaten, nicht waghalsige Heldenjünglinge, die sich gebärden, als ob der Krieg ein Theater wäre!« Mameli, der aufmerksam zugehört hatte, sagte nachdenklich: »Ihr habt gewiß recht. Wir bilden uns viel ein und schaden wohl mehr, als wir nutzen. Ich will nicht leugnen, daß ich mich seit meinen Knabenjahren danach sehnte, der Krieg gegen Italiens Feinde möchte losbrechen, und es möchte mir vergönnt sein, nach vollbrachten Heldentaten den Heldentod zu sterben, und über meinem Trachten nach außerordentlichen Leistungen habe ich vielleicht Naheliegendes unterlassen, das zweckmäßig gewesen wäre.« – »Seht Ihr!« triumphierte Ripari. »Ich dachte mir's, daß Ihr auch einer von denen wäret! Seid Ihr nicht jener Dichter Mameli? Ihr hättet friedfertig und bescheidentlich zu Hause bleiben können, da die Phantasten ohnehin mit dem Schwerte nicht umzugehen wissen. Man sieht es Euch an, daß Ihr nicht viel aushalten könnt. Was für Arme, was für eine Brust! Da ist nichts Robustes, da sind keine Muskeln, das Ganze taugt nichts. Mein Rat ist, daß Ihr augenblicklich diese Jacke da auszieht, nach Hause geht und weiter dichtet, wozu Ihr Euch besser eignen mögt und was Euch nicht schaden wird.« Mameli sagte demütig: »Ich hatte vielmehr gehofft, Ihr würdet mir das Pferd meines verstorbenen Landsmanns überlassen, das Euch augenblicklich nicht von Nutzen sein kann, mir aber aus der Not hülfe, da ich mit meinem Fuße unberitten nicht in den Kampf zurück kann.« Ripari fuhr entrüstet auf und zankte, Mameli gehöre ins Bett, er würde nicht dulden, daß er heute noch ins Gefecht gehe, und ein andrer mischte sich ein, indem er ihn warnte, Blessen seien unglückbringende Pferde und trügen den Reiter ins Verderben; doch kam in diesem Augenblick eine Anzahl Soldaten, von Montaldi geführt, der dem Alten die Hand auf die Schulter legte und ihn erinnerte, daß er ihn vor einer halben Stunde gesehen habe, wie er den sterbenden Ghiglione gegen einen übermächtigen Feind verteidigt und sich damit auch ohne Zwang dringender Gefahr ausgesetzt habe. Sie wurden durch Ugo Bassi unterbrochen, der einen Schwerverwundeten vor sich auf dem Pferde trug; Ripari entschied, nachdem er einen Blick auf ihn geworfen hatte, daß er sofort nach der nahen Kirche San Pietro in Montorio getragen werden müsse, wo ein notdürftiges Lazarett eingerichtet war. Schon nach wenigen Minuten kam Bassi zurück, da der Mann unterwegs verschieden war; er sah traurig vor sich nieder. »Seid Ihr der Ugo Bassi, der den Krieg so predigte, daß die Blinden und Lahmen ein Messer ergriffen und ihm nachhinkten?« rief Montaldi ermunternd. »Ich würde es wieder tun,« erwiderte der Priester, »wenn es sein müßte; aber ich sage doch: der Krieg ist Sünde, die Sünde austreibt.« Montaldi füllte ein Glas mit Wein, trank ihm zu und reichte es ihm, indem er ausrief: »Es lebe der Krieg! Es lebe der Ruhm! Das Leben ist nur die Form aus Ton, die zerbrochen wird, der Ruhm das Erzbild, das glänzt und dauert!« – »Heide,« sagte Ugo Bassi lächelnd und gab das Glas zurück, worauf er wieder dem Parke zuritt, wo gekämpft wurde.
Von den Bastionen her kam gleichzeitig Garibaldi und sagte zu Montaldi, der ihm entgegenritt: »Jetzt muß es entschieden werden. Du führst die besten Truppen, die kampffähig sind, gegen den rechten Flügel, Sacchi fällt aus Porta Cavallegieri aus, so fassen wir sie von beiden Seiten und müssen sie von ihrem Lager abschneiden können.« Da sein Auge auf Mameli fiel, rief er ihm zu, er solle, verwundet, wie er sei, am Tore in seiner Nähe bleiben; der hatte aber die Gelegenheit benutzt, um sich an das Pferd des Doktor Ripari heranzuschleichen, schwang sich eben auf und jagte davon, mit spitzbübischer Miene nach dem drohenden Alten zurückblickend. Montaldi sammelte in Eile die verfügbaren Truppen und sprengte den Soldaten voran gegen den Feind, der gerade eine frische Abteilung gegen Villa Corsini führte. Diese mußte sich, flüchtend vor dem Schwung des Angriffs, zurückziehen; allein zugleich mit seinem getroffenen Pferde stürzte Montaldi und war im Nu von den schnell zurückkehrenden Franzosen umringt. Er erwehrte sich ihrer eine Weile, auch als er nicht mehr aufrecht stehen konnte, auf den Knien den zerbrochenen Säbel schwingend; so fand ihn Ugo Bassi, der herbeieilte und sich neben ihm auf den Boden warf, um den mehr von der Todesohnmacht als vom Feinde Ueberwältigten aufzufangen. Montaldi erkannte den Priester, lächelte und wollte sprechen, aber sein Kopf fiel zurück, und der Körper wog mit lebloser Schwere auf Ugo Bassis Brust; die Franzosen wurden von Legionären beschäftigt, die zu spät ihren Anführer zu befreien herbeigekommen waren. Garibaldi befand sich auf der höchsten Stelle des Walles, von wo aus der Blick den Teil des Parkes übersieht, in dem die wichtigsten Stellungen der Schlacht waren; als er sah, daß Montaldi fiel, der Angriff dadurch abgeschwächt wurde und der Kampf stockte, gab er seinem Pferde die Sporen, stellte sich an die Spitze von etwa fünfzig Reitern, die außer Tätigkeit waren, sammelte die Zerstreuten und stürzte sich selbst in das Gefecht. Aus seinem Blick empfingen die Soldaten eine Schwungkraft, die sie wie unfehlbare Werkzeuge seines Willens gegen den Feind schnellte; er wankte, gab nach und, auf beiden Flügeln gleich bedrängt, mußte das ganze französische Heer unter fortwährenden Verlusten sich zurückziehen.
Nachdem Ugo Bassi den Leichnam Montaldis einigen Soldaten übergeben hatte mit dem Auftrage, ihn aus dem Gewühl an einen geschützten Platz zu bringen, ließ er sein Pferd traben, wie es wollte, bis er plötzlich bemerkte, daß er allein jenseits der Linie des römischen Heeres zwischen Weinbergen war, die französischen Truppen als Schlupfwinkel dienten. Wie er das Pferd wendete, hörte er einen Schuß fallen, sah, daß sein Tier sich bäumte, und stürzte gleich darauf mit ihm zu Boden; er selbst war nicht verletzt, aber das Pferd tödlich getroffen; es versuchte mit krampfigen Bewegungen sich aufzurichten, wobei es seinen Herrn inständig ansah, und starb. Ugo Bassi legte den Arm um den Hals des schönen Tieres und weinte. »Ach, verlasse mich doch nicht,« klagte er, »mein Liebling, mein stummgeborener Bruder. Dein Blicken aus unergründlicher Seele war reicher als unsre Worte. Dein tanzender Schritt, das Beugen deines Schlangenhalses, das Schnauben deiner Nüstern sprach schöne und stolze Gedanken der Natur aus. Wie warest du zärtlich, aufmerksam und ungestüm, wie warst du mir vertraut! Wie die Welle das Schiff trägt, zu den Wolken hebt und wieder ins Meer reißt, so trugest du mich durch die Elemente, und wie im Rauschen der Welle witterte ich den Dunst des Weltgeists, wenn ich dein Wiehern hörte, oder wenn dein warmer Atem feucht um meine Wange blies.«
Seiner Trauer hingegeben, hatte er nicht darauf geachtet, daß französische Soldaten sich ihm genähert hatten, die ihm nun zuriefen, er solle sich ergeben. Er nannte seinen Namen, zeigte das Kreuz, welches er am Halse trug, und daß er ohne Waffen war, und bat, sie möchten ihn sein friedliches Amt weiter verrichten lassen. Einer der Franzosen entgegnete mit Bezug darauf, daß er den Hals des toten Pferdes umschlungen gehalten hatte, ob er etwa dem Gaul die Sterbesakramente gereicht habe, und ein andrer sagte, es gehe sie nichts an, wer er sei, übrigens sei ein Priester im Lager Garibaldis schlimmer als der Teufel, er sei ihr Gefangener und müsse ihnen folgen. Da er einsah, daß jeder Widerstand und jedes Widerwort vergeblich sein würde, fügte er sich schweigend; er wurde von den Franzosen mit absichtlicher Roheit behandelt und wäre vielleicht erschossen worden, wie sie es später mit einem Geistlichen vor der Kirche Santa Maria del Rosario machten, der sich zur Republik hielt, wenn nicht eine beträchtliche Anzahl Franzosen in die römische Gefangenschaft geraten wären, die sie durch eine namhafte Persönlichkeit, wie Ugo Bassi war, auszulösen dachten.
Ein absonderlicher Fang war Nino Bixio geglückt; er war nämlich bei der Verfolgung der flüchtenden Franzosen auf eine abseits gelegene, von dem französischen Oberst Picard besetzte Meierei gestoßen, der nicht ahnte, daß die Hauptmasse seines Heeres bereits im Rückzuge begriffen war. Nino Bixio, der keinen Feind in fester Stellung mehr zu finden vermutet hatte und seinen Truppen um eine gute Strecke voraus, also ganz hilflos war, erschrak heftig, als er sich ohne Rettung der Uebermacht preisgegeben sah; aber der Schreck äußerte sich bei ihm als Wut, mit der er auf den französischen Oberst zusprang, ihn am Kragen faßte, tüchtig schüttelte und anschrie, er solle sich ergeben. Oberst Picard hatte das Aussehen eines Wüterichs, war aber ein unentschlossener, leicht zu erschütternder Mann, der sich seine Lage und das Benehmen des rasenden Italieners nicht zu erklären wußte und in der Verlegenheit seinen Soldaten gebot, die Waffen zu strecken. Dem Bixio brach der Angstschweiß aus, als er sich von fünfzig Gefangenen umringt sah; zu seinem Glück erschien aber jetzt eine Abteilung Soldaten, die ihm gefolgt waren, nahmen die Franzosen in ihre Mitte und führten sie in die Stadt.
Als Garibaldi von der Verfolgung des abziehenden Feindes zurückkam, war der Janiculus voll von Menschen, die das Gerücht des Sieges herbeigelockt hatte. Er machte sich Bahn durch das Gedränge, um von der Bastion aus, die den weitesten Blick ins Land gab, die Bewegungen des französischen Heeres zu beobachten, und das Volk, das ihn erkannte, wich ehrerbietig zurück; doch zuckte sein Name, von einem zum andern geworfen, durch die erregte Menge und schlug plötzlich aus der Glut unzähliger Herzen wie eine Flamme in die Luft. Da er dem freien Felde zugekehrt stand, wendete er sein Pferd, um die Begrüßung anzunehmen, worauf das Rufen: »Heil Garibaldi! Schwert Italiens! Stern Italiens!« sich erneuerte. Die hellen, stürmischen Glocken Roms fingen in diesem Augenblick zu läuten an, anschwellend wie eine Flut, die mit seinem triumphierenden Namen zum Himmel stieg. Auf den Mauern, auf den Geschützen, auf Dächern und Bänken, überall waren Menschen. Garibaldi sah Soldaten seiner Regimenter, lombardische Bersaglieri, die nicht hatten mitkämpfen dürfen, Männer, Frauen und Kinder, die Hüte und Tücher schwenkten; auch die Gleichgültigen und die Vorsichtigen, die sich zurückgehalten hatten, weil sie einen guten Ausgang der Sache nicht für möglich hielten, kamen auf die Nachricht von der Flucht der Franzosen herbeigeeilt. Indem sie seinen Namen riefen, staunten sie auf den wundervollen Mann, aus dessen Händen sie das freie Vaterland empfangen sollten; er stand ehern gegen den feurighellen Abendhimmel, nur sein weißes Pferd bewegte den hohen Hals auf und nieder und schnaubte leise. Der Platz, auf dem er sich befand, war gegen die Stadt zu von Akazien umgeben, die blühten und deren süßer Geruch seine tiefste Seele erfüllte zugleich mit dem starken Bewußtsein, daß er Italien machen werde und daß das Volk um ihn her es wisse und auf ihn baue; ja, auf einmal schien es ihm, als sei er weit fort, einsam auf rollendem Meere, und als sei das übermenschliche Werk lange, lange schon vollendet, und er frei, ganz durchdrungen von dem schwebenden Geiste getaner Taten.
Als der Jubel der Menge nachließ, richtete er sich auf, blickte um sich und sagte: »Soldaten! Eure Tapferkeit hat den Sieg über die tüchtigste Armee Europas davongetragen: ich danke euch! Heute, Heer und Volk, habt ihr Rom mit Blut in Italiens Fleisch eingegossen. Wehe dem, der eins vom andern reißen wollte!« Dann, da er grüßte und mit einigen Offizieren dem Vatikan zu ritt, löste sich die zusammengedrängte Menge, und von der Anhöhe stürzte sich der Jubel des Sieges hinunter und überflutete Rom. Er wälzte sich durch die Gassen und über die Hügel wie ein Schwarm von Bacchanten, deren trunkener Schrei von den schwarzen Ruinen widerhallt und deren goldene Becken glühend wie Schwertergeklirr durch die laue Dämmerung dröhnen.
Luciano Manara, der von den Galerien der Peterskirche den Gang des Kampfes verfolgt hatte, suchte Garibaldi auf und fand ihn, auf der Lafette einer Kanone sitzend, im Gespräch mit dem Obersten der Artillerie, Ludovico Calandrelli; es war nämlich vorgekommen, daß den Feind verfolgende römische Soldaten von den Geschossen der eignen Geschütze getroffen worden waren, wie es sich zeigte, ohne Calandrellis Schuld infolge des zwiespältigen Oberbefehls, der einheitliches Handeln erschwerte. Manara näherte sich und sagte zu Garibaldi, er befürchte, seine Achtung durch sein Benehmen am vergangenen Tage eingebüßt zu haben, Garibaldi möge jene Begegnung vergessen; es sei sein Wunsch, daß es ihm trotz des heutigen Sieges noch vergönnt sein möge, mit seinen Truppen unter Garibaldi zu fechten, damit er sähe, daß, welches ihre Gesinnung auch sein möchte, sie tapfer zu kämpfen und zu sterben wüßten. Garibaldi reichte ihm die Hand mit dem Lächeln, das, ohne daß er es wußte, auch seine Gegner bestrickte, und sagte: »Das weiß ich und möchte das letztere nicht sehen müssen. Meine Achtung konntet Ihr, Hauptmann Manara, nicht verlieren: man soll die Menschen nicht nach ihren Worten, sondern nach ihren Taten beurteilen.« Dann sprach er in froher Erregung von seiner Hoffnung, den Franzosen eine völlige Niederlage zu bereiten und das erprobte Heer gegen Italiens Erzfeind, Oesterreich, wenden zu können. Der Zwist mit Frankreich sei nur etwas Zufälliges und Vorübergehendes, das Werk einer ränkevollen Partei, die bald gestürzt werden würde. Das Notwendige sei, daß Mailand befreit und Oesterreich über die Alpen zurückgeworfen werde. »Das wäre möglich?« rief Manara aus, indem er Garibaldi ungläubig, fast erschrocken ansah. »Wie denn?« fragte dieser erstaunt. »Dachtet Ihr, Mailand sollte allezeit in dieser Knechtschaft bleiben?« – »Nein,« antwortete Manara und lächelte traurig; »aber ich habe mich gewöhnt zu denken, daß ich den Tag der Befreiung nicht sehen werde.« Garibaldi sprang ungeduldig auf, indem er ausrief: »Soll denn immer der größte Ruhm der besten Söhne Italiens ein tapferes Sterben sein? Leben und leben wollen müßt Ihr! In Euern Jahren glaubte ich mich noch unsterblich!« – »Ihr seid es vielleicht,« lachte Manara und fuhr ernster fort: »Was mich entnervt hat, waren nicht die Entbehrungen und Leiden dieses Jahres, sondern die Einsicht in unsre Ohnmacht. Unsre Kette zerreißen wie ein wildes Tier, das haben wir können, nicht unsers Feindes Herr werden, weil wir es unser selbst nicht sind.« Garibaldi schwieg und sann eine Weile, dann sagte er ruhig: »Wer unterliegt, scheint immer unrecht zu haben; mich soll das nicht irremachen. Wenn meine Mutter oder meine Brüder und Kinder im Elend sind, grüble ich nicht, ob sie es verschuldet haben, sondern versuche ihnen zu helfen und helfe ihnen hundertmal, wenn sie sich hundertmal wieder verderben, weil ich sie liebe.« Nach einer Pause sagte Manara: »Ich möchte so fühlen und handeln können wie Ihr, und wenn ich Euch ansehe und mit Euch spreche, scheint mir fast, ich könnte es.«
Garibaldi sah es als eine Gunst des Schicksals an, daß er an dem Tage, wo Montaldi gefallen war, zwei Männer fand, die diesem an militärischer Begabung und Hochherzigkeit gleichkamen, nämlich außer Manara den Reiterführer Angelo Masina aus Bologna, der sich bei dem letzten, den Ausschlag gebenden Angriff hervorgetan hatte. Er hatte sich in Bologna den Namen eines Patrioten, in Spanien Kriegsruhm erworben, war infolge der päpstlichen Amnestie in die Heimat zurückgekehrt und hatte, als äußere Feinde die Republik bedrohten, aus seinem eignen bedeutenden Vermögen fünfzig Reiter ausgestattet und nach Rom geführt. Er pflegte im Feuer der Schlacht so energisch zu leben, daß, wer ihn sah, meinte, Gefahr und Anstrengung seien das Element, in dem er sich heimisch fühle und sein ganzes Wesen könne spielen lassen, zwischen den Schlachten aber sich ganz der Muße des friedlichen Lebens hinzugeben, und glich dann einem weichlichen Schwelger, den weder Pflicht noch Ehre von seinem Lotterbett würde reißen können. Sowie er Garibaldi sah, entschied er sich für ihn und hing ihm an, wie wenn er durch Eideskraft gebunden wäre; denn während er die Frauen ebenso schnell vergaß, wie er ihnen häufig und in ehrlicher Meinung ewige Liebe schwur, schloß er sich Männern selten, dann aber unverbrüchlich an und hatte wenige Ueberzeugungen, an denen er niemals irre wurde. Durch diesen Mann fühlte sich Garibaldi glücklich bereichert; es war ihm, als hätte er in ihm eine neue, vernichtende Waffe gefunden, mit der er gegen Oesterreich kämpfen könnte.
Beim Einbruch der Nacht waren die Höhen still und menschenleer geworden: die Soldaten füllten die Schenken der Stadt und erzählten, was sie getan und erlebt hatten. Garibaldi ging nach der Kirche San Pietro in Montorio, um den Leichnam Montaldis zu sehen, der dort lag. Der alte Ripari hatte ihn erwartet und zeigte ihm traurig und stolz die neunzehn Wunden, mit denen der Tapfere gefallen war; sein Gesicht war klar und unentstellt. Lange betrachtete Garibaldi den schönen schlanken, festen Körper, der das Siegel des Todes wie einen hohen Orden trug, in dessen Besitz er zum erstenmal die Augen schließen und in seiner eignen Seele ruhen möchte. Dann hieß er den Arzt heimgehen und setzte sich zu dem Mohren, der ihn auf der zur Kirche führenden Treppe erwartete, um mit ihm die Totenwache zu halten. Es wollte ihm nicht in den Sinn, daß er den Mann, der zwanzig Schritte von ihm lag, nicht wecken konnte, damit er ihm den Kummer verscheuche; denn er hatte ihn nie krank, nie müde, nie verzagt oder hilflos gesehen. Während die andern Licht, Kraft und Hoffnung aus ihm, Garibaldi, sogen, hatte Montaldi seiner nicht bedurft, außer daß er ihn liebte; er hatte bei keinem andern jemals Zuflucht gesucht, als bei sich selbst, auch bei Gott nicht. Keine Gefahr war ihm zu groß, keine Arbeit zu schlecht gewesen; er hatte die Seele des strömenden Wassers, das Mühlen und Schiffe und Fabriken treibt und mit Schaum und sprühenden Tropfen, den Ueberschuß seiner Kraft verspielend, über die Räder stürzt.
In den Häusern unten ging Licht an Licht aus, und die festliche Stadt flammte prahlerisch gegen die Sterne. Garibaldi sah es ohne Bewußtsein: er dachte an die wilde Weite der Neuen Welt und den riesigen Wurf ihrer zügellosen Schöpfung, wo er und Montaldi sich in verwegener Jagd die Augenblicke des ungebändigten Lebens fangen mußten. Er dachte an silberne Nächte, wo sie ohne Weg, ohne Nahrung, allein mit den Gefahren der Wildnis, doch festen Herzens durch die Steppe geritten waren, zwei feurig lebendigen Welten gleich, die durch die Unendlichkeit schwärmen; an eine Fahrt, die sie mit meuternder Mannschaft über das Meer machten, als wären sie im Käfig mit Raubtieren, die gähnend den Schweif fegen, in Kreisen den Menschen umschleichen und sich auf ihn stürzen, sowie sein Blick, der sie bändigt, die Spannkraft verliert. Er hätte es auch ohne ihn bestanden, aber mit ihm wurde das Mißgeschick ein Abenteuer und selbst der Verlust ein Anlaß, sich auf eigne Schätze zu besinnen.
Mit Aghiar tauschte er Erinnerungen aus und hörte ihn die Taten und Eigenschaften des Toten loben: Er war wie ein Palmbaum mit glattem Stamme, der im Sturme sich singend biegt, aber die Blätter und Zweige festhält, und wenn der Sturm sich legt, dasteht wie zuvor, ohne einen Riß in der Rinde, als wäre der Himmel heiter gewesen. Sein Herz war kühl wie die Quelle des Gebirges, sein Haß und sein Schmerz waren stark und schnell, die Vergangenheit gärte nicht in seiner Brust. Er liebte nichts wie die Freiheit; der Tod hat ihn gefangen, aber er wird sich losreißen und auf glänzendem Schiff die weiten Meere jenseits des Himmels befahren.
Eine tiefe Traurigkeit kam über Garibaldi; es schien ihm, als könne er diesen Freund nicht verschmerzen, obwohl ihm noch viele andre blieben und obwohl er schon manchen Verlust verwunden hatte. Auch Gaëtano Sacchi hatte die kriegerischen Tage Amerikas mit ihm geteilt, er war tapfer, treu und verschwiegen, ein eiserner Ritter für ihn und Italien; der junge Medici scheute keine Gefahr, auch er war edel geartet, unternehmend und willig, den Weg der Zukunft zu gehen; aber sie hätte er nicht vermißt wie Montaldi. Dieser nahm seine Jugend mit weg, die grenzenlose Zeit der Vorbereitung und Hoffnung. ›Diese Nacht,‹ dachte er, ›soll dir und unsrer Jugend gewidmet sein, dann gehe du und ringe mit den Geheimnissen des Todes, und ich will Schlachten des Lebens schlagen; wenn unsre Geister sich je begegnen, sollen sie sich ohne Wehmut grüßen.‹
Er saß träumend an die dunkle Schulter des Mohren gelehnt, bis den Osten das Licht erregte, dann suchten beide einen kurzen Schlaf in dem kleinen Gasthof, den Garibaldi bewohnte.