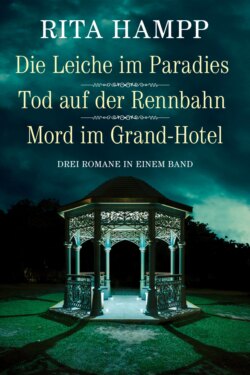Читать книгу Die Leiche im Paradies / Tod auf der Rennbahn / Mord im Grand-Hotel - Drei Romane in einem Band - Rita Hampp - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DREIZEHN
ОглавлениеLea brauchte eine Weile, um den Satz zu verdauen. Sie blieb einfach sitzen und ließ die Kollegen abziehen. Sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen.
Völker am Tattag in der Wohnung? Mit allem hatte sie gerechnet, nur damit nicht. Aber wenn Gottlieb Laborergebnisse hatte, dann gab es daran nichts zu rütteln. Dann war Völker der Mörder. Und sie hatte sich mit ihren Verdächtigungen gegen Wiesinger, Nowak & Co zum Narren gemacht. Wie hatte sie sich nur so irren können? Wieso hatte sie Völker jedes Wort geglaubt? Weil sie es glauben wollte? War sie so naiv geworden? Oder war es der Phantasie einer angehenden Schriftstellerin zu verdanken, dass sie dieses Märchen vom Mordkomplott schließlich selbst geglaubt hatte und nichts anderes mehr hatte zur Kenntnis nehmen wollen? Sie konnte sich ohrfeigen dafür.
»Alles in Ordnung?« Gottlieb stand vor ihr und beugte sich zu ihr herunter, wie ein rührender Teddybär mit lieben, sanften, braunen Augen.
Lea schüttelte sich. Wie kam sie nun wieder auf solche Gedanken. Sie musste ja komplett verrückt sein.
»Gute Dramaturgie«, quetschte sie heraus. »Die Überraschung ist Ihnen gelungen.«
Er lächelte kurz und freudlos. Von Triumph war nicht viel zu spüren. Dabei hätte er doch allen Grund gehabt, sich auf die Schulter zu klopfen. Komischer Kauz. Jetzt hatte er den spektakulärsten Mordfall der Stadt aufgeklärt, und trotzdem konnte er sich nicht darüber freuen?
Überhaupt, warum stand er hier noch herum und beugte sich über sie. Diese Fürsorge war ja schrecklich. Er benahm sich schon wie Justus.
Lea mühte sich vom Stuhl hoch.
»Also, dann werde ich mal Ihren Knüller zu Papier bringen«, murmelte sie.
Doch Gottlieb hielt sie fest. Seine Hände waren warm und sanft. »Völker will Sie sehen«, sagte er.
*
Entrüstet starrte Marie-Luise Campenhausen den Telefonhörer an. Frau Weidenbach hatte einfach abgeschaltet. Was waren denn das nur für Manieren heutzutage. Das hätte sie gerade von ihr am allerwenigsten erwartet.
Im Gegenteil. Sie hätte gedacht, dass die Journalistin sofort zu ihr eilen würde, und sie hatte sich ausgemalt, dass sie beide bei einem Tee einen Plan aushecken könnten, wie sie Wiesinger endgültig überführen könnten. Stattdessen hörte sie nun, alles sei ein Irrtum gewesen. Das war doch unmöglich. Marie-Luise wusste doch, was sie eben mit eigenen Ohren gehört hatte: Wiesinger machte unsaubere Geschäfte. Sie konnte es beweisen, und sie wusste sogar, mit wem er unter einer Decke steckte.
Dabei war er am Anfang schrecklich zugeknöpft gewesen.
»Wie sind Sie gerade auf mich gekommen?«, hatte er sofort gefragt, als er Platz genommen hatte. »Eigentlich nehme ich keine neuen Mandanten mehr an. Ich habe einen festen Stamm, den ich guten Gewissens nicht erweitern kann. Meine Mandanten sind einen gewissen Standard gewohnt, und sie bekommen von mir nur die beste Arbeit. Ich bin ausgelastet.«
Komm schon, hatte Marie-Luise gedacht, dann wärst du doch nicht hier. Du wirst es dir gleich anders überlegen. Umständlich war sie aufgestanden und aus dem Raum gehumpelt. »Machen Sie es sich ruhig bequem, Herr Wiesinger, ich koche uns schnell ein Tässchen Tee. Und lassen Sie sich bitte von Mienchen nicht stören. Sie hatte vor kurzem einen Unfall und braucht jetzt mehr Liebe als sonst. Einfach ein bisschen streicheln, das mag sie. Oder Sie ignorieren sie, das ist auch in Ordnung.«
Wenig später strich ihr Mienchen in der Küche um die Beine. Sie beugte sich zu der Katze und streichelte sie, dann gab sie ihr etwas zu fressen und ging mit dem Tee ins Wohnzimmer zurück.
Wiesinger stellte mit einer schnellen Bewegung die kleine bunte Tasse zurück auf den Kaminsims. »Hübsch haben Sie es hier«, sagte er freundlich. »Man merkt, hier wohnt jemand mit Geschmack.«
Marie-Luise lachte. »Ach was, das sind alles Erbstücke und zusammengetragene Erinnerungen. Hier, der kleine Wandteppich: chinesische Seide aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Hat mein lieber Willi mir mitgebracht, als er ein Objekt in China besichtigte.«
»Ihr Mann reist gerne?«
»Nein, er hatte schreckliche Flugangst. Ach, es ist schon so lange her ...«
Wiesinger sah sie mitfühlend an, sagte aber nichts. Das war geschickt. Marie-Luise wusste nicht, wie sie weitermachen sollte. Also seufzte sie erst einmal und ließ sich auf das kleine Sesselchen fallen. Mit einem Satz war Mienchen auf ihrem Schoß und schnurrte, als Marie-Luise sie zu streicheln begann. »Der arme Willi«, begann sie.
»Sie meinen, er ist ...?«
»Ja, vor zwanzig Jahren. Dabei war er erst seit zwei Jahren im Ruhestand. Das war ungerecht. Er hatte sich so auf die Zeit als Pensionär gefreut.«
»Darf ich fragen, was Ihr Gatte von Beruf war?«
»Er war der letzte Inhaber des Bankhauses Campenhausen & Sohn in Frankfurt. Wir selbst blieben leider kinderlos, und so hat er zum Schluss verkaufen müssen. Eine schwere Stunde, nicht nur für ihn.« Sie machte eine Pause, um die Nachricht wirken zu lassen und Wiesinger Zeit zu geben, insgeheim die Millionen zusammenzuzählen, die bei ihr zu holen waren.
»Aber das Leben geht weiter«, fuhr sie schließlich fort. »Und eigentlich geht es mir doch sehr gut. Ich brauche mir finanziell keine Sorgen zu machen. Nur manchmal denke ich, es wird mir alles ein bisschen viel. Dieses Mietshaus hier und das Ferienhaus in Florida und die Aktien und Fonds – manchmal habe ich Angst, ich schaffe das nicht mehr, so ganz allein.«
»Sie haben doch bestimmt Verwandte, die Ihnen unter die Arme greifen.«
»Nein. Niemanden. Ich will aber nicht jammern, Herr Wiesinger. Das liegt mir wirklich fern. Nur – mit über siebzig sollte man sich allmählich Gedanken darüber machen, nicht wahr, ehe man noch ganz verdreht wird im Kopf.«
Mit spitzen Fingern nahm Wiesinger eine Praline. »Gedanken? Worüber?«
»Nun, ich war letzte Woche in der Seniorenresidenz Imperial. Frau Jablonka hat mir eine interessante Wohnung gezeigt und mir von Ihnen erzählt. Sie hatte Recht, es böte sich wirklich an, endlich Nägel mit Köpfen zu machen, und da wären Sie genau der Richtige.«
Wiesinger blieb auf der Hut und lutschte andächtig an seinem Konfekt. Er nickte ihr jedoch aufmunternd zu. Das machte er gut. Keines seiner Opfer würde später behaupten können, er habe sie zu irgendetwas gedrängt.
Aber Marie-Luise beschloss, es ihm nicht so einfach zu machen. Das Tonband lief. Was würde es für einen Eindruck machen, wenn sie den Mann quasi zu einer Gaunerei anstiften würde?
Sie begann, die Wohnung im Imperial in den schillerndsten Farben zu beschreiben.
Irgendwann griff Wiesinger ein. »Sie sagten, Sie wollten Nägel mit Köpfen machen, was meinen Sie damit? Wie kann ich Ihnen dabei helfen?«
»Wie Sie wissen, bin ich allein. Wenn ich sterbe – also ich weiß nicht, wem fällt dann all das hier zu, was mein Willi vermacht bekommen und weiter aufgebaut hat? Dem Staat?«
»Wenn Sie keine Erben benennen, ja.«
»Das ist doch allerhand. Was wird denn dann aus dem Haus und meinen Mietern? Und aus meinem Schmuck. Und den Stichen. Sehen Sie sie an. Willi hat so viel Geld dafür bezahlt.«
Wiesinger rieb sich das Kinn. Seine Augen huschten über die Wände, den Kamin, die Teppiche, ihre Perlenkette und die Brillantbrosche, die sie extra angelegt hatte. »Es gibt verschiedene Möglichkeiten«, meinte er dann vorsichtig.
Marie-Luise beugte sich vor. »Welche?«
»Nun, zunächst einmal könnten Sie Ihr Vermögen in eine gemeinnützige Stiftung umwandeln. Das schafft etwas Dauerhaftes, was noch weit nach Ihrer Zeit hinaus wirkt. Sie könnten bei der Neugründung über dreihunderttausend Euro steuerlich absetzen. Das lohnt sich. Sie brauchen mir nur zu sagen, welchen Zweck die Stiftung haben soll, den Rest übernimmt mein Büro für Sie, also die Projektplanung, das Werben für Spenden, Erstellen von Dankesbriefen, die Abstimmung mit dem Finanzamt ...«
»Das hört sich an, als wäre ich mit einem Schlag alle Sorgen los. Und was würde das kosten?«
»Nun, üblicherweise fünf Prozent der jährlichen Ausschüttungssumme.«
Marie-Luise fiel es schwer, Zustimmung zu heucheln. Sie hatte sich längst über Stiftungen informiert und wusste, dass ein Steuerberater höchst selten derartige Aufgaben übernahm. Sie hatte Informationsmaterial von einer gemeinnützigen Bürgerstiftung vorliegen, die die Übernahme solcher Dienste anbot, allerdings nicht gegen üppiges Honorar, sondern rein zum überprüften Selbstkostenpreis. »Welche Möglichkeiten gäbe es außerdem?«
»Hm, Sie wissen wirklich niemanden, dem Sie Ihr Vermögen oder wenigstens einen Teil vererben wollen?«
»Vielleicht einer meiner Mieterinnen, die sich so nett um Mienchen gekümmert hat, als sie angefahren wurde. Können Sie sich vorstellen, was für ein Schreck das für mich gewesen ist? Mein Mienchen, blutend und leblos auf der Straße, und der Kerl fährt einfach weiter? O Gott, o Gott. Ohne meine Mieterin hätte ich das nicht überstanden. Ja, sie hat wirklich eine Belohnung verdient.« Marie-Luise konnte an Wiesingers Miene ablesen, dass sie mit dieser emotionalen Schilderung genau seinen Geschmack getroffen hatte.
»Nun, diese Frau sollte allerdings möglichst zeitnah Geld bekommen. Sie könnten ihr eine Schenkung machen, sagen wir zwanzigtausend Euro, die können Sie steuerfrei schenken. Sie können ihr natürlich auch mehr geben, dann aber bitte in bar, nicht über die Konten. Das überlasse ich Ihnen, das will ich auch gar nicht wissen. Oder Sie bezahlen ihr einen Luxusurlaub, ohne dass der Fiskus mitverdient. Da hätte ich ein paar Tricks für Sie. Aber das wäre ja nur ein Bruchteil Ihres Vermögens.«
»Richtig. Was mache ich mit dem Rest? Wissen Sie, am liebsten würde ich auch meine Immobilien verkaufen. Sie bereiten mir so viel Mühe. Wenn ich ins Imperial zöge, würde ich gerne vollkommen frei sein und das Leben noch einmal richtig unbeschwert genießen. Nicht mehr das tägliche Einkaufen und Kochen, keine Abrechnungen und Mieterwechsel, keine Sorgen über fallende Aktienkurse und auch keine Gedanken mehr darüber, was wird, wenn ich nicht mehr bin – das wäre herrlich.«
Wiesingers Gesicht leuchtete. »Solche Fälle sind meine Spezialität. Sie können sich bei den Bewohnern im Imperial gerne nach mir erkundigen. Frau Jablonka hat Ihnen ja sicherlich ebenfalls einiges über meine Referenzen berichtet. Ich würde an Ihrer Stelle, was immer Sie entbehren können, abstoßen. Das Mobiliar hier ist ja wirklich erlesen und kostbar. Das dürfen Sie auf keinen Fall in falsche Hände geben, nur weil Sie umziehen wollen. Ich werde mit Kasimir Löbmann reden, dem Antiquitätenhändler in der Sophienstraße. Der macht Ihnen ganz gewiss einen guten Preis. Dafür verbürge ich mich. Nun die Häuser, besonders dieses hier. Frau Jablonka hat Ihnen bestimmt berichtet, dass das Büro Nowak sehr eng mit mir zusammenarbeitet. Ich würde die Verträge aufsetzen und überprüfen und die Geldübergabe koordinieren. Also, ich kann Ihnen garantieren, dass alles hundertprozentig zu Ihrer Zufriedenheit abgewickelt werden wird. Gerade bei Immobilien muss man ja heutzutage vorsichtig sein, nicht wahr?«
Marie-Luise konnte nicht anders, als stumm zuzustimmen.
»Für Herrn Nowak lege ich meine Hand ins Feuer. Am besten, Sie geben mir alle Unterlagen mit. Dann sichte ich sie und kann mir eine entsprechende Geldanlage für Sie überlegen. Sie wollen sicherlich jederzeit an das Geld herankommen, aber Zinsen soll es ja auch abwerfen, richtig?«
Wieder konnte sie nur wortlos nicken.
»Für die Zeit, äh, danach müssten wir uns noch Gedanken machen. Stiftung wäre nicht schlecht, aber ich könnte Sie sehr gut verstehen, wenn Sie das im Moment noch offen lassen wollen. Sie sind ja im besten Alter. Wer weiß, was das Leben Ihnen noch bietet, nicht.«
»Nun, aber wie schnell ist etwas Schlimmes geschehen. Wenn ich an mein Mienchen denke – das hätte auch mir passieren können.«
Wiesinger nahm ein Schlückchen von dem inzwischen kalt und bitter gewordenen Tee. »Köstlich«, rief er und lächelte sie besonders freundlich an. »Wir könnten alternativ einen Erbvertrag aufsetzen. Wir machen die Papiere fix und fertig, samt Ihrer Unterschrift und unserem Stempel. Alles, bis auf den Namen des oder der Begünstigten. Den können Sie jederzeit ganz kurzfristig einsetzen, zur Not reicht es, mich anzurufen, und ich erledige das. Wie hört sich das an?«
Ich hab dich!, jubelte Marie-Luise innerlich. So machte er das also. Ehe man sich’s versah, hatte man einen gültigen Erbvertrag blanko unterschrieben, und er setzte seinen eigenen Namen aufs Papier.
»Ist das nicht leichtsinnig?«
»Aber Frau Campenhausen, nicht doch. Bei mir sind die Papiere bestens aufgehoben. Stellen Sie sich vor, Sie würden einen Universalerben ernennen und der wüsste vorzeitig von seinem Glück.«
»Sie meinen, der würde mich sofort abmurksen, um an mein Geld zu kommen?«
»Vielleicht nicht gerade abmurksen. Aber entmündigen. Sie glauben gar nicht, wie schnell das heutzutage geht. Da habe ich schon die tollsten Sachen erlebt. Was meinen Sie, wie schwer es ist, einen Richter davon zu überzeugen, dass man mit achtzig noch topfit im Kopf ist. Der fragt Sie zum Beispiel, wie groß die Entfernung zwischen Köln und Kabul ist, und wenn Sie das nicht wissen ...« Er machte eine bedeutungsvolle Kunstpause.
Marie-Luise ließ ihn den Faden weiterspinnen, obwohl sie vor zwei Jahren im »Bellevue« eine juristische Vortragsreihe besucht hatte und genau wusste, dass er ihr gerade einen dicken Bären aufband. Entmündigungen gab es dank des neuen Betreuungsrechts schon seit vielen Jahren nicht mehr. Aber sie waren immer noch das Schreckgespenst vieler uninformierter Senioren. Und mit dieser Angst ließ es sich offenbar vortrefflich spielen.
Er setzte noch eins drauf. »Oder kürzlich erst, da hatte einer meiner Klienten seinen letzten Willen fast in letzter Sekunde geändert und war dann friedlich verstorben. Seine bisher eingesetzte Erbin kämpfte wie eine Besessene, um doch noch an das Geld zu kommen. Sie kam in mein Büro und machte mir die Hölle heiß. Das Testament sei gefälscht, schrie sie, sie werde vor Gericht gehen und so weiter. Also, wenn ich nicht alle Unterlagen gehabt hätte und vom Verstorbenen auch noch eine ansehnliche Summe auf ein Treuhandkonto überwiesen bekommen hätte, hätte der wahre Erbe ihn nicht einmal anständig beerdigen können, weil er an das Geld nicht herangekommen wäre und selbst keins hatte.«
Marie-Luise horchte auf. Ob er damit wohl auf den Fall Mennicke anspielte? War das für ihn nicht viel zu gefährlich?
»Meine Güte«, tat sie beeindruckt, »was es alles gibt. Sie würden also auch für einen solchen Fall vorsorgen? Sie raten mir, einen größeren Geldbetrag über Sie anzulegen?«
»Treuhänderisch, versteht sich.«
»Natürlich. Wie in dem Fall, den Sie eben erwähnten. Ging es da nicht um eine berühmte Persönlichkeit der Stadt?«
Wiesinger schluckte, als habe er eine heiße Kartoffel im Hals. Er sah auf die Uhr.
»Frau Jablonka hat erwähnt, dass sie Sie kürzlich jemandem sehr Angesehenen vermittelt hat«, plapperte Marie-Luise mit möglichst ehrlicher Miene. »Es ist wirklich sehr beruhigend zu wissen, wie für einen gesorgt wird, wenn man selbst nicht mehr so kann, wie man will.«
Wiesinger wurde das Thema offenbar zu heiß. Er stand auf und verbeugte sich. »Ein entzückendes Gespräch, Frau Campenhausen. Ich kann Ihnen zusichern, dass ich mein Bestes tun werde, damit Sie zufrieden sind.«
Marie-Luise wusste, wann es genug war. »Ja dann, auf gute Zusammenarbeit. Ich schicke Ihnen nächste Woche meine Unterlagen. Es wird eine Weile dauern, bis ich die Ordner gesichtet habe.«
»Aber das kann ich doch für Sie übernehmen, Frau Campenhausen. Geben Sie mir einfach alles mit.«
Genau das hatte sie vorausgesehen. So setzte er also die alten Leute unter Druck. Die meisten wagten doch aus Höflichkeit schon gar nicht zu widersprechen. Oder es fiel ihnen, wie ihr jetzt, kein Grund ein, ihn davon abzuhalten.
»Das ist sehr nett von Ihnen, Herr Wiesinger. Aber Sie sehen ja, wie mein Mienchen humpelt. Ich habe in einer halben Stunde einen Termin beim Tierarzt. Sonst hätte ich Ihr Angebot gerne angenommen. Wir machen es so, ich melde mich bei Ihnen.«
Säuerlich stimmte Wiesinger zu und verließ sie. Noch im Treppenhaus hörte sie sein Feuerzeug klicken.
Aufatmend lehnte sie sich gegen die Wohnungstür. Sie konnte sich gut vorstellen, wie es nun weiterging. Dieser Löbmann und Nowak würden erscheinen, sie würden sie unter Zeit- und Entscheidungsdruck setzen. Wenn sie nicht mehr ein noch aus wüsste, würde Wiesinger erscheinen und anbieten, alles für sie zu regeln. Sie brauchte nur noch Ja und Amen zu sagen.
Sie konnte es den Senioren, die auf diese Masche hereingefallen waren, nicht einmal verdenken. Wiesinger trat so souverän und glaubwürdig auf wie ein Pfarrer.
Sie freute sich schon auf die Fortsetzung. Wie würde dieser neue Mann in der Geschichte, Antiquitätenhändler Löbmann, ihre Wohnung wohl einschätzen? Und was würde Nowak tun, um sie über den Tisch zu ziehen? Beim nächsten Mal würde sie das Tonband nicht mitlaufen lassen, sondern doch lieber Lea Weidenbach als Zeugin dazuholen. Die würde dann ihre Aufmacher schreiben können, von denen sie immer träumte, und den drei Männern würde daraufhin das Handwerk gelegt werden. Und alles, weil sie so eine gute Kriminalistin war.
Ja, sie war richtig stolz auf sich gewesen, nachdem Wiesinger weggefahren war und sie das Tonband abgestellt hatte. Sie hatte es nicht erwarten können, der Journalistin von ihren Erlebnissen zu berichten. Und da unterbrach Frau Weidenbach sie mitten im Satz, redete von einem Irrtum und schaltete ihr Handy ab? Das war wirklich allerhand!
*
Lea zerriss es fast vor Nervosität. Sie musste ihren Aufmacher schreiben, sie musste danach unbedingt Frau Campenhausen beruhigen und sie wohl oder übel davon überzeugen, dass ihr Verdacht falsch gewesen war. Eine Unterhaltung mit Uli Völker war das Letzte, wozu sie jetzt Zeit und Lust hatte.
Völker hatte sie belogen. Nie wieder würde sie auch nur ein Wort aus seinem Mund für bare Münze nehmen. Was wollte er denn noch von ihr?
Überhaupt: ein Interview mit einem mutmaßlichen Mörder? Das war nicht ihr Stil und nicht die Aufgabe einer Lokalzeitung. Sie konnte zwar schreiben, dass er die Vorwürfe leugnete, aber sie konnte unmöglich seine Version der Vorfälle bringen. Ob Völker nun schuldig oder unschuldig war – das mussten die Gerichte klären, und genau dann würde sie wieder über den Fall berichten.
»Sagen Sie Völker, ich besuche ihn in seiner Zelle, wenn es mal in meinen Terminkalender passt«, erwiderte sie Gottlieb.
Der sah belustigt auf sie herunter. »Sie sind ja richtig sauer. Sie haben ihm geglaubt, was? Und jetzt fühlen Sie sich hintergangen und haben eine Stinkwut auf ihn. – Soll ich Ihnen was verraten? In diesem Punkt liegen wir gar nicht so weit auseinander.«
Dann wurde er ernst. »Tun Sie mir trotzdem den Gefallen und sagen Sie ihm das selbst. Ich habe ihm versprochen, dass Sie kommen, und habe damit gegen alle Dienstvorschriften verstoßen.«
Warum machte Gottlieb so etwas? Als guter Kriminalbeamter hätte er Völker diese Bestimmungen doch einfach um die Ohren schlagen und ihn in den nächsten Streifenwagen Richtung Untersuchungsgefängnis verfrachten können. Aber nein, stattdessen hatte er ihr dieses Treffen eingebrockt. Hatte er etwa Mitleid mit dem Kerl?
Immer noch wütend, aber auch verwirrt, stapfte sie hinter Gottlieb her durch die Flure und das Treppenhaus des Betonklotzes, in dem der große Konferenzraum und die übrigen Dienststellen der Polizei außer Gottliebs Soko untergebracht waren. Am Ende eines Gangs blieben sie vor einer Stahltür stehen. Gottlieb öffnete auf Augenhöhe eine Klappe und schaute hindurch, dann schloss er auf. »Der Rucksack muss draußen bleiben«, gebot er ihr, »Block und Stift können Sie natürlich mitnehmen.« Dann wandte er sich an den Inhaftierten. »Eine halbe Stunde, Herr Völker, und das ist schon erheblich mehr, als ich eigentlich verantworten kann.«
Dann ließ er sie allein und schloss von außen ab. Lea schluckte. Es war bedrückend, plötzlich in einem vergitterten Raum zu sitzen und auf eine Tür zu starren, die von innen keine Klinke hatte.
Völker sah schlecht aus. Er saß zusammengesunken auf der Pritsche. Offenbar hatte er geweint. Er trug keinen Gürtel, keine Uhr und keine Schnürsenkel mehr.
»Die haben Angst, ich bring mich um«, sagte er, ihrem Blick folgend. »Wenn ich es nur könnte! Aber selbst das schaffe ich nicht. Dabei ist mein Leben längst vorbei.«
Lea war viel zu aufgebracht, um auf sein Selbstmitleid einzugehen. »Was fällt Ihnen ein, mich so zu hintergehen!«, raunzte sie ihn an und setzte sich, da es keinen Tisch und keinen Stuhl in dem Raum gab, neben ihn auf die Pritsche. Er roch nach Erbrochenem. Sie rückte ein Stück von ihm ab.
Völker drehte sich ihr zu. Er sah wirklich völlig erledigt aus. »Sie glauben das doch nicht, oder? Trauen Sie mir wirklich zu, dass ich meiner Trixi auch nur ein Haar gekrümmt habe?«
»Sie können mir nichts vormachen. Klar kommt so etwas vor. Alkohol, Eifersucht, Geldnot – ich habe schon viel gesehen. Außerdem sind die Beweise eindeutig. Sie waren in der Wohnung. Menschenskind, warum haben Sie das nicht vorher gesagt?«
»Dann hätte man mich doch sofort verhaftet. Nicht die Beweise sind eindeutig, sondern die Schlüsse, die man aus ihnen zieht. Soll ich Ihnen sagen, wie es wirklich gewesen ist?«
»Ich will es gar nicht wissen. Was meinen Sie, was für Lügengeschichten ich mir schon habe anhören müssen.«
»Lügengeschichten? Genau. Sie sind nicht besser als die Polizei. Sie meinen doch auch, dass ich lüge. Ihr alle habt mich längst als Mörder abgestempelt. Das ist die reinste Vorverurteilung.«
Das saß. Vorverurteilung – ein schlimmer Vorwurf für eine Journalistin. Ihr ganzes Berufsleben hatte sie sich bemüht, objektiv bis zum Urteil zu sein. Aber in diesem Fall war es verdammt schwierig. Der Fingerabdruck ließ doch gar keinen anderen Schluss zu, wenn man halbwegs bei Verstand war.
Trotzdem kroch ein ungutes Gefühl in ihr hoch. Hatte er vielleicht Recht? Zog sie die falschen Schlüsse? In Gerichtsverfahren ging es ihr oft so, dass sie wie in einer Achterbahn mal dem Staatsanwalt, mal dem Verteidiger glaubte, weil beide scheinbar unschlagbare Argumente hatten, bis die Gegenseite diese wiederum widerlegte. So war sie oft bis zum Urteilsspruch regelrecht zerrissen, und sie war mehr als einmal froh gewesen, kein Richter sein zu müssen, sondern einfach nur so neutral wie möglich über das Hin- und Herwogen der Argumente berichten zu dürfen.
Spielte sie sich jetzt nicht als Richterin auf? Wo war ihre Neutralität geblieben? Sie setzte sich kerzengerade hin und schlug ihren Notizblock auf.
»Also gut, schießen Sie los. Aber machen Sie es kurz. Sind Sie am Mordtag in Baden-Baden gewesen? Wenn ja, warum?«
Er rang seine Hände. »Ich habe mich ganz spontan entschieden.
Sie wissen ja, dieser Brief von meinem Anwalt. So wollte ich das nicht. Ich konnte mir gut vorstellen, wie Trixi der Brief getroffen hatte.«
»Kürzer.«
»Ich kam Nachmittag am Bahnhof an ...«
»Woher hatten Sie das Geld für die Fahrkarte?«
»Von Piet.«
»Weiter.«
»Ich habe mir erklären lassen, wo Trixi wohnte. Es war ein langer Fußmarsch, und es war heiß. Trixi war nicht zu Hause. Da bin ich in die Bierkneipe in der Rheinstraße gegangen ...«
»Wann haben Sie Trixi getroffen?«
»Die Bushaltestelle liegt in Sichtweite der Kneipe. Ich habe sie aussteigen sehen, habe gezahlt und bin ihr gefolgt. An der Haustür habe ich sie eingeholt.«
»Hat Sie jemand zusammen gesehen?«
»Ich glaube nicht.«
»Frau Hefendehl müsste Sie gesehen haben. Erdgeschoss, gleich neben dem Eingang.«
»Da waren alle Rollläden zu. Es war, wie gesagt, sehr heiß, und die Sonne knallte auf diese Hausseite. Ich glaube, im ganzen Haus waren die Rollos unten.«
»Weiter. Wie hat Trixi reagiert?«
»Sie wollte nicht mit mir reden.«
»Und?«
»Nichts. Ich musste das akzeptieren.«
»Quatsch.«
»Nein, ganz ehrlich. Sie bat mich, sie in Ruhe zu lassen. Wenn ich wolle, stimme sie der Scheidung zu. Ich solle einfach nur abhauen.«
»Was haben Sie ihr eigentlich getan, dass sie so reagierte? Erst ging sie wortlos weg, dann fertigte sie Sie nach über einem Jahr so vor der Haustür ab. Was ist bei Ihnen vorgefallen zwischen Weihnachten und Silvester 2002?«
»Nichts.«
»Es muss einen Grund gegeben haben.«
»Ich schwöre, es gibt keinen.«
»Ich glaube Ihnen kein Wort.«
»Na ja. Sie hat mir schon Vorhaltungen gemacht. Immer dieselben eben. Ich habe irgendwann gar nicht mehr hingehört.«
»Welche Vorhaltungen?«
»Dies und das.«
»So hat das keinen Sinn. Ich rufe jetzt Herrn Gottlieb und gehe.«
»Nein, bitte. Ich gebe es ja zu. Aber, Gott, ich schäme mich eben. Es ging um Alkohol. Immer um den Alkohol. An dem Tag vor der Haustür auch. Dabei hatte ich nur zwei Bierchen, ich schwör’s! – Aber sie sagte: ›Lass mich in Ruhe, du hast getrunken!‹.«
»Und wie kam dann Ihr Fingerabdruck in die Wohnung?«
»Ich musste dringend, und ich wollte nicht vorm Haus.«
»Hat sie Sie deshalb mit in die Wohnung genommen?«
»Genau. Ohne ein einziges weiteres Wort. Ich bin ins Bad, anschließend Hände gewaschen, raus und weg. Sie stand die ganze Zeit mit zusammengepressten Lippen und verschränkten Armen an der Tür und spießte mich mit ihren Blicken auf. Ich wollte noch einmal versuchen, ihr alles zu erklären, aber sie würgte mich beim ersten Wort ab. Ein Blick, eine Kopfbewegung, das genügte. Da wusste ich, dass alles verloren ist. Ich merkte, dass ich gleich losheulen würde, und bin deshalb abgehauen. Ich hab gleich den nächsten Zug zurück genommen, siebzehn Uhr dreiunddreißig. Um elf war ich im Killiwilly.«
»Trixi wurde abends zwischen neunzehn Uhr und Mitternacht ermordet. Da waren Sie, wie Sie sagen, im Zug. Kann das jemand bezeugen? Der Schaffner? Ein Fahrgast? Haben Sie mit jemandem ein Bier getrunken? Haben Sie die Fahrkarte noch?«
Völker schüttelte den Kopf. »Glauben Sie mir trotzdem?«
Gute Frage. Die Geschichte klang so verrückt, dass sie schon wieder wahr sein konnte. Hatte er tatsächlich diesen Zug genommen und nicht einen in der Nacht, nachdem sie mit Trixi telefoniert hatte? Vielleicht stimmte die Story ja nur in Teilen, oder er hatte sie lediglich um ein paar Stunden vordatiert?
Die Leiche war allerdings nachweislich erst nach Mitternacht an den Fundort geschafft worden. Zu viele Zeugen hatte vorher noch im Paradies ihre Hunde ausgeführt und dazu den Spielplatz überquert. Das hatte sie herausgefunden, als sie Franz die Nachbarn hatte befragen lassen. Außerdem: Wie sollte Völker die Leiche dorthin geschafft haben? Mit dem Taxi wohl nicht, und auch nicht zu Fuß. Leihwagen? Komplizen? Lea schwirrte der Kopf.
»Sie brauchen einen guten Anwalt«, sagte sie schließlich.
Völker sah zu Boden. »Hat keine Eile. Der wird mir genauso wenig glauben wie Sie und Gottlieb.«
»Da könnten Sie Recht haben«, entfuhr es Lea, obwohl sie zumindest in Würzburg bestimmt zehn Anwälte hätte benennen können, die ihrem Mandanten bedingungslos alles glaubten, was er sagte. Selbst sie war ja halbwegs bereit, ihm seine Version abzunehmen, wenngleich es schwer fiel.
Sie versuchte es noch einmal anders herum. »Wussten Sie von Trixis Testament?«
Völker schüttelte wortlos den Kopf.
»Oder dass Trixi eine Erbschaft erwartete?«
»Von Mennicke?«
»Davon wussten Sie? Wieso haben Sie nichts davon erzählt?«
Uli Völker seufzte. »Ich war so entsetzt, als ich erfuhr, dass man Trixi kurz nach meinem Besuch tot aufgefunden hatte. Da glaubte ich, jegliche Verbindung nach Baden-Baden leugnen zu müssen, um nicht ins Visier der Polizei zu geraten. Außerdem war es doch schon so lange her.«
»Wie haben Trixi und Mennicke sich kennen gelernt?«
»Ich war damals Nachtportier im Hotel Merkur, Trixi Zimmermädchen, und dann kam eines Tages Mennicke angereist. Ich glaube, sie hat in ihm ihren Vater gesehen. Den hat sie schrecklich vermisst, das hatte sie mir oft gesagt. Jetzt war also der alte Mennicke da, ganz alleine, aufgeschlossen, nett, spendabel. Sie pusselte jedenfalls ständig um ihn herum, zeigte ihm die Stadt, nahm ihn mit in die Stadtbibliothek, in der sie sich ja bestens auskannte, lieh sich auf seine Rechnung ein Auto und kutschierte ihn zum Wörlitzer Park. Ich sah sie gar nicht mehr. Nur spätabends, wenn sie zusammen in der Lobby saßen, Rotwein tranken und wie die Hühner kicherten.«
»Ging es damals auch um Geld?«
»Nein, davon war nie die Rede. Sie hatte ihn wirklich gern.«
»Aber Sie glauben, dass Trixi möglicherweise damit rechnete, in Mennickes Testament bedacht zu werden?«
»Sie hatte Weihnachten gesagt, dass mit der Wohnung alles in Ordnung kommen würde. Als ich später erfuhr, dass sie nach Baden-Baden gegangen war, wurde mir einiges klar: In den vergangenen Monaten hatte sie mir ein paar Mal Geld überwiesen, das muss sie von Mennicke bekommen haben. Vielleicht spekulierte sie tatsächlich auf eine Erbschaft. Dann hätte sie diese schreckliche Alptraum-Wohnung ablösen können, und wir hätten keine Sorgen mehr gehabt.«
»Obwohl sie weggegangen war und längst woanders lebte? Warum sollte sie?«
»Sie hielt immer, was sie versprochen hatte.«
Lea musste gegen ihren Willen lächeln. »Jetzt drehen wir uns im Kreis. Warum haben Sie denn dann die Scheidung eingereicht? Das macht doch keinen Sinn.«
»Weil die Scheidung alles geregelt hätte und das Sozialamt mir im Nacken saß. Trixi hatte offensichtlich laufende Einnahmen, ich keinen Pfennig. Die Wohnung lief zwar auf meinen Namen, aber eigentlich war sie dafür verantwortlich, dass wir sie gekauft haben. Wir hatten keine Gütertrennung. Ich dachte, im Zuge des Scheidungsverfahrens würde sie schwarz auf weiß dazu verdonnert werden, die Wohnung abzubezahlen. So hat es mir jedenfalls der Anwalt erklärt. Vielleicht hätte ich sogar Unterhalt bekommen.«
»Noch einmal, Hand aufs Herz: Wussten Sie von dem Testament?«
Völker liefen Tränen über die Wangen. »Gottlieb hat es mir gezeigt. Ja, so war sie. Eben noch giftig wie eine Klapperschlange, und im nächsten Atemzug so etwas!«
Er schluchzte leise und flüsterte etwas, das Lea nicht verstand. Nur die letzten Worte waren etwas klarer. Sie klangen wie »verdammt süßes Luder«.
Wie ein kleines Kind wischte er sich mit dem Handrücken über das Gesicht und versuchte dann ein Lächeln. Es fiel schief aus. »Sieht nicht gut für mich aus, was?«
»Keine Ahnung. Ich weiß ja selbst nicht, was ich glauben soll«, gestand Lea. »Aber trotz allem tun Sie mir Leid!«
Sie stand auf und wollte gehen, doch Völker zog sie auf die Liege zurück. »Ich bin unschuldig. Helfen Sie mir, bitte!«, flüsterte er, als könnte jemand mithören.
»Wie denn?«, flüsterte Lea zurück.
»Suchen Sie weiter nach dem Beweis, von dem Sie mir berichtet haben. Vielleicht finden Sie ja in Trixis Sachen doch etwas, das mich entlastet. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, die Sie bis jetzt übersehen haben. Räumen Sie ihre Wohnung für mich. Nehmen Sie außer den gemieteten Möbeln alles mit, ich schenke es Ihnen. Aber sehen Sie noch einmal alles gründlich durch. Finden Sie etwas!«
Lea dachte an die Videos und die Bücher, dann aber auch, wie viel Zeit es kosten würde, die Kisten zu packen. Ganz zu schweigen von der Frage, wohin sie die Sachen schaffen sollte. Schon allein die Kiste mit Trixi Völkers Souvenirs ... Andererseits – vielleicht hatte sie tatsächlich etwas übersehen?
Völker sah ihr die widersprüchlichen Gefühle offenbar an. »Bitte, Frau Weidenbach«, flüsterte er. »Sie haben mir doch gesagt, dass Sie die Letzte waren, mit der Trixi gesprochen hat.«
Und schon meldete sich das schlechte Gewissen zurück. »Abgemacht«, sagte Lea schnell, ehe sie es sich anders überlegen konnte, »ich tue es, Trixi zuliebe.«
»Da wäre noch etwas.«
Jetzt kam der Pferdefuß. Sie hatte es ja fast geahnt. Sehr skeptisch neigte sie den Kopf.
»Ich habe keine Ahnung, wie lange die mich hier in Untersuchungshaft behalten. Ich darf solange meine eigene Kleidung tragen. Dafür brauche ich Wäsche aus meiner Wohnung. Außerdem muss das Sozialamt Bescheid wissen, meine Bank, die Post muss ich mir nachsenden lassen.«
»Das kann doch der Sozialarbeiter für Sie erledigen.«
Völker machte ein unglückliches Gesicht. »Das haben mir die hier auch schon gesagt. Aber dann wüsste gleich jeder zu Hause, dass ich im Gefängnis bin. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein Fremder meine Wäsche durchwühlt und dabei vielleicht meine Portraits von Trixi anfasst oder durcheinander bringt ...!«
»Was ist mit Ihrem Freund Piet?«
»Der steht von früh bis spät in der Kneipe. Bitte! Es wäre ja kein großer Aufwand, nur ein Tag. Und vielleicht fällt Ihnen ja dort etwas auf, das zu Trixis Komplott-Theorie passt. Vielleicht hat sie schon länger Verdacht gehegt und ist überhaupt nur deswegen nach Baden-Baden gefahren, um den alten Mennicke zu warnen oder zu beschützen.« Plötzlich blühte Völker auf. »Ja, genau, so könnte es gewesen sein. Das fällt mir jetzt erst ein. Bitte, Sie müssen noch einmal in die Wohnung und alles durchsehen. Ich flehe Sie an. Finden Sie Trixis Mörder. Beweisen Sie, dass ich unschuldig bin.«
Hatte sie eine Wahl?
»Also gut. Geben Sie mir die Schlüssel.«
»Die hat man mir vorhin abgenommen. Aber Herr Gottlieb gibt sie Ihnen bestimmt. Da fällt mir noch etwas ein: Bei Trixis Schlüsseln gibt es einen, mit dem ich nichts anfangen kann. Ein doppelseitiger Bartschlüssel. Ich habe ihn überall probiert, Briefkasten, Keller, Fahrradraum, Tiefgarage. Nichts. Keine Ahnung, wozu Trixi den gebraucht hat.«
Schlagartig erwachte Leas Neugier. Ein doppelseitiger Bartschlüssel? Das klang nach einem Tresor. Das ideale Versteck für die Beweise! Merkwürdig, in Trixis Unterlagen hatte sie keine Andeutungen auf die Anmietung eines Banksafes gefunden. Oder war es ein Bahnhofschließfach?
Draußen im Gang hallten schwere Schritte, dann klirrten Schlüssel. Die Luke in der Tür öffnete sich, und Gottlieb sah hindurch. »Interviewzeit beendet.«
»Fünf Minuten noch, wir sind gleich fertig.«
»Zwei.« Damit schloss sich die Klappe wieder.
Lea riss einen Zettel aus dem Notizblock. »Ich brauche Vollmachten für alles: für Ihre Bank, für die Post, für das Sozialamt, für Trixis Wohnung. Und natürlich für die Polizei. Ich hoffe, die rücken die Schlüssel wirklich an mich heraus.«