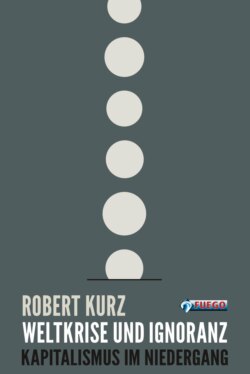Читать книгу Weltkrise und Ignoranz - Robert Kurz - Страница 4
ОглавлениеDIE AUFHEBUNG DER GERECHTIGKEIT
Realitätsverlust und Krise der demokratischen Ethik
I.
In den 60er und 70er Jahren, als die Welt der linken Gesellschaftskritik noch in Ordnung war, erschien die marktwirtschaftliche Logik in ihrer ganzen menschlichen Erbärmlichkeit als angreifbar. Ausgehend vom humanistischen Bild eines »eigentlichen« und »wahren« Menschen, der zu »verwirklichen« sei, verfielen die marktwirtschaftliche Lebensweise und ihre Existenzbedingungen in Gestalt des Konsum- und Fachidiotismus, der Entsolidarisierung und Persönlichkeitsdeformation durch das »Zwangsgesetz der Konkurrenz« (Marx), der Ausbeutung der Dritten Welt und des neokolonialen Völkermords einer massiven Kritik. Dargestellt wurde die negative Empfindung vor allem in ethisch-moralischen Kategorien. Das Marktsystem schien auf allen seinen Daseinsebenen »Ungerechtigkeit« zu generieren.
Diese Kritik fokussierte sich praktisch vor allem in politischen Begriffen. Zwar bildete die Marxsche Ökonomiekritik das theoretische Bezugssystem, aber eigentlich eher im Status einer Hintergrundannahme. Soweit man »ökonomisch« operierte, geschah dies ganz positivistisch mit den Zentralkategorien des kritisierten Marktsystems selbst, also in den Formen von Ware und Geld, Wert und Preis, Lohn und Gewinn. Nicht gegen die Basisformen als solche war man kritisch, sondern gegen die Art ihrer »Anwendung«. Und eben deswegen wurde die Kritik wesentlich als politische formuliert, als »Primat der Politik« (und zwar einer anderen, alternativen, humanen Politik) gegenüber den Marktkategorien. Die Aufhebung des marktwirtschaftlichen Übels wurde nicht gedacht als Aufhebung seiner eigenen Formen, sondern als deren Unterwerfung unter eine sozialistische politische Subjektivität.
Das diskursive Kraftfeld dieser politisch transformierten Kritik des Marktsystems war nicht der Marxsche Begriff des Warenfetischs, sondern der Begriff der Demokratie. Wie die »Ungerechtigkeit« der Marktwirtschaft letztlich durch eine externe Anwendungssubjektivität (»Verfügungsgewalt« der Kapitalisten) erzeugt schien, so sollte sie durch eine antipodische externe Subjektivität der Demokratie beseitigt werden. Demokratie wurde gedacht als Idee der menschlichen Selbstbestimmung, als solidarische und gemeinschaftliche Regulation der Gesellschaft durch einen emanzipatorischen politischen Willen. Der kapitalistische Privateigentümer erschien demgegenüber als autokratischer und unsolidarischer Selbstherrscher. Kapitalismus und Demokratie wurden als gegensätzlich begriffen; entweder als absolute Unvereinbarkeit oder als antagonistische Kompromißstruktur »zwischen Demokratie und Kapitalismus durch staatliche Interventionen« (Habermas). Die politische Demokratie der westlichen Gesellschaften figurierte als positive Errungenschaft, der »demokratische Verfassungsstaat« als »Erbe der bürgerlichen Emanzipationsbewegungen« (Habermas). Dieser »demokratische Sektor« endete jedoch nach Auffassung der Kritiker an den Toren der kapitalistischen Betriebe. Demokratisierung der Ökonomie und aller gesellschaftlichen Institutionen war daher das Zauberwort, mit dem man die »Gerechtigkeit« glaubte aufschlüsseln zu können.
Die Demokratisierung der Ökonomie sollte in Gestalt einer planmäßigen Lenkung der Ressourcen eine »gerechte Verteilung« des weiterhin in marktwirtschaftlichen, warenförmigen Basisformen produzierten Reichtums bewirken. Die westlichen linken Gesellschaftskritiker befanden sich mit dieser Argumentationsstruktur in einer eigentümlichen Schieflage gegenüber den staatssozialistischen Formationen des Ostens. Diese schienen in Gestalt der Planwirtschaft ein wesentliches Erfordernis der sozialen Emanzipation realisiert zu haben. Jedoch wurden die vermeintlichen »sozialistischen Wirtschaftsgrundlagen« böse konterkariert durch einen erheblichen Mangel an Demokratie. Dieses bedauerliche Defizit war angeblich entweder den »schwierigen Bedingungen« (so die eher apologetische Lesart) oder einer »asiatischen Erblast« (Bahro, Dutschke, neuerdings wieder Michael Schneider) oder schlicht der »falschen Ideologie« des Bolschewismus geschuldet. Und die zu verordnende Kur konnte natürlich ebenfalls nur die Demokratisierung sein, aber eben andersherum: war im Westen die politische Demokratie erreicht oder wenigstens weit fortgeschritten und mußte durch Erweiterung auf die Ökonomie vollendet werden, so galt es im Osten umgekehrt, die planwirtschaftlichen »sozialistischen Wirtschaftsgrundlagen« zu erweitern und zu vollenden durch die umfassende politische Demokratie. So wäre denn durch einen jeweils spezifischen, hinsichtlich der beiden Systeme seitenverkehrten Impuls der Demokratisierung auf dem gemeinsamen Weg zur »Gerechtigkeit« voranzuschreiten gewesen.
Der rabiate Zusammenbruch des Staatssozialismus hat dieses Gesamtkonstrukt von edler Einfalt und stiller Größe bis auf die Knochen blamiert. Alle sozialen und ökologischen Übel des Marktsystems sind nicht nur weiterhin voll wirksam, sie haben sich sogar bis zur Unerträglichkeit gesteigert. Aber gleichzeitig wurde die gemütliche ideologische Möblierung der linken Gesellschaftskritik in Trümmer gelegt. Die Vermittlung der demokratischen Ethik durch ein (im engeren oder weiteren Sinne sozialistisches) »Primat der Politik« gegenüber den Marktkategorien in Gestalt von Planungsinstanzen scheint endgültig falsifiziert und der Weg zur »Gerechtigkeit« genau andersherum zu verlaufen, als es die diversen sozialistischen Demokraten sich immer vorgestellt hatten. Nicht Demokratie und Sozialismus gehören offenbar zusammen, sondern Demokratie und Kapitalismus. Die Bewegungen und Ansätze einer Demokratisierung in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion haben sich nicht mit den planungsökonomischen »sozialistischen Wirtschaftsgrundlagen« verheiratet, sondern entstanden im Gegenteil geradezu aus deren Zusammenbruch; und ihrem eigenen Selbstverständnis nach wollen sie nichts anderes als die Entfesselung der »Marktkräfte« gegen alle planungsbürokratischen Hemmnisse. Ausgerechnet die politischen Planungskompetenzen gegenüber den Marktkategorien, die der linken Gesellschaftskritik immer als das Mittel einer »Verwirklichung« demokratischer Ethik erschienen waren, werden nun selber als eine im höchsten Grade ungerechte und undemokratische Vergewaltigung der persönlichen Marktfreiheit und ihrer angeblich segensreichen sozialen Gerechtigkeitswirkungen empfunden. Das zähnefletschende Schreckbild des undemokratischen, absolutistisch »verfügungsgewaltigen« Kapitalisten erscheint plötzlich umgedreht als eine Art demokratische Heiligenfigur des »schöpferischen Unternehmers« (Schumpeter), den es gerade im Namen der Gerechtigkeit zu hegen und zu pflegen gelte.
Man sollte sich aber nicht täuschen lassen von diesem aufgeregt dahinwogenden ideologischen Verwirrspiel. Die wilden Polsprünge können nicht verheimlichen, daß es sich um eine Umpolung innerhalb ein und desselben Bezugssystems, d.h. innerhalb ein und desselben historischen Kontinuums moderner warenproduzierender Systeme handelt. Es wird immer noch mit den alten kategorialen und ideologischen Requisiten das alte Spiel weitergespielt. Alles ist noch da wie gehabt: ein abstrakt-allgemeines Menschenbild außerhalb der Geschichte, die Idee der Gerechtigkeit, die Demokratie, die Marktkategorien und die Politik. Was sich geändert hat, ist die Bewertung dieser Requisiten. An die Stelle der emphatischen »Verwirklichungs«-Idee eines »wahren« Menschen tritt die genauso abstrakt-anthropologische Annahme eines in seiner ahistorisch verewigten Warenförmigkeit »unvollkommenen« Menschen, der in dieser leider gelegentlich ein wenig turbulent werdenden Form eben angenommen werden müsse. Indem die politische Demokratie als identisch mit der Marktfreiheit erscheint, verfällt der politische Planungsanspruch gegenüber den ökonomischen Kategorien als subjektive Hybris der Kritik. Die demokratische Ethik soll sich nun nicht mehr auf dem Umweg über das »Primat« politischer Planungsansprüche verwirklichen, sondern als »Wirtschaftsethik« direkt in den Marktkategorien selbst. Die Politik könne nur noch bescheiden den wirtschaftsethischen Imperativ der demokratischen Marktfreiheit durch Rahmenbedingungen unterstützen; und auch die defensiv und an sich selbst irre gewordene linke Kritik vertritt den Anspruch der Regulation nur noch kleinlaut in homöopathischer Verdünnung. Damit ist das Denken über den Zusammenhang von Ethik, Ökonomie und Politik wieder dort angelangt, wo es in der Moderne seinen Anfang genommen hatte: bei Adam Smith und seiner Feier der »invisible hand«. Die Preisgabe des politisch-planungsökonomischen Subjektanspruchs gegenüber den ökonomischen Kategorien paßt gut in eine Zeit, die sich philosophisch den Subjektanspruch als gesamtgesellschaftlichen überhaupt schon seit längerem abgeschminkt hat.