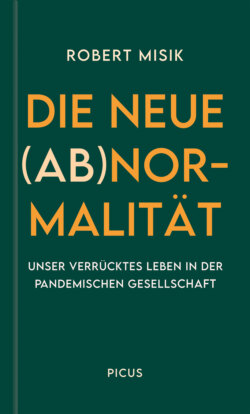Читать книгу Die neue (Ab)normalität - Robert Misik - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
STILLE
ОглавлениеWenn die Normalität dem Abnormalen weicht, wird auch sichtbar, was sonst nicht auffällt und wir sehen unsere Welt mit anderen Augen. Was wir in diesem Jahr erlebt haben, wird uns für immer begleiten. Mindestens als Erfahrung. Es ist im Wortsinn »Ereignis«, also etwas, das unsere Erfahrungswelt in ein Davor und ein Danach trennt.
Der 2. November 2020 war ein ausnehmend warmer Herbsttag. Es hatte knapp zwanzig Grad. Tausende strömten noch einmal in die Gastgärten in der Wiener Innenstadt. Ich spazierte durch die Altstadt, grüßte einige bekannte Gesichter, sogar Richard Lugner lief mir über den Weg, der Clown und Baumeister. Dann setzte ich mich zu Freunden, die vor einer Bar an Klappstühlen feierten, und trank zwei Glas Rotwein. Es waren die letzten Stunden vor dem neuerlichen Lockdown, ein letztes Mal konnte man mit Leuten sprechen, denen man zufällig begegnete, oder sich mit Freunden in einem Lokal verabreden. Es hatte etwas Ausgelassenes. Ja, auch etwas Verrücktes. »Es ist wie eine Art ›Letzter Walzer‹, bevor das Schiff untergeht«, schrieb ich einer Freundin per SMS. Aus Gründen, die ich selbst nicht recht verstehe, beschloss ich knapp vor acht Uhr, nach Hause zu fahren. Nur wenige Minuten nachdem ich von meinem Stuhl aufgestanden war, startete fünfzig Meter weiter ein Dschihadist mit Kalaschnikow-Nachbau und Handfeuerwaffe seinen Terroranschlag, tötete Feiernde vor Lokalen, erschoss eine junge Kellnerin. Die Stadt war in Panik, der letzte Tanz wurde zum Albtraum, die Feiernden verbrachten den Abend zusammengekauert in Kellern und Hinterhöfen, bis die Polizei Entwarnung geben konnte. Als ich am darauffolgenden Abend durch die Stadt spazierte, hatte sie den Anschein eines Katastrophengebiets seltsamer Art. Alles war noch da, aber kein Mensch zu sehen. Der doppelte Schlag aus Lockdown und Terrorschock hatten über Nacht alles verfremdet. Man konnte kilometerweit gehen, ohne einem Menschen zu begegnen. Alle zehn Minuten kroch leise ein Auto an mir vorbei. Einmal kam mir eine Straßenbahn entgegen. Sie war ohne Passagiere unterwegs. Man denkt dabei an Bertolt Brechts Konzept vom Verfremdungseffekt, der Aufmerksamkeit und Bewusstsein lenkt, indem er verstört, ein machtvoller künstlerischer Effekt.
Ich erinnerte mich daran, wie ich vor zehn Jahren in New York war, als Hurricane »Sandy« über den Südzipfel von Manhattan fegte und am nächsten Morgen über dieser Stadt eine verstörende Stille lag. Damals habe ich in meine »New York Diaries« geschrieben:
Die Ruhe vor dem Sturm ist nichts gegen die Ruhe nach dem Sturm. Es ist ein bizarres Bild, das Downtown Manhattan am Dienstagmorgen bietet: Alles, was südlich der 34. Straße liegt, Chelsea, Greenwich Village, das Bobo-Viertel Tribeca und der Finanzdistrikt ganz im Süden ist eine eigentümliche Katastrophenzone. Man kommt praktisch nur zu Fuß voran, überall flattern die gelben Bänder herum, wie man sie aus den Krimis kennt: »Crime Zone«. Keine Durchfahrt. Kein Strom, das Funktelefonnetz ist ohnehin down. Es hängt eine seltsame Stille über der Szenerie, die diese Stadt sonst nicht kennt. Weg ist der ewige Lärm der Klimaanlagen, die normalerweise in den New Yorker Himmel röhren. Höchstens brummt irgendwo einmal ein Notstromaggregat, hin und wieder fährt ein Polizeioder Feuerwehrauto mit eingeschalteter Sirene durch die Stille.
Auf der 5th Avenue, einer der teuersten Einkaufsstraßen der Welt, liegen Holzlatten und Eisenstreben zu einem pittoresken Riesenmikado aufgetürmt. Schwer zu sagen, was das einmal war, bevor hier Hurricane »Sandy« durchwehte und die Flutwelle vom Meer her hochdrückte. Wohl am ehesten ein Baugerüst. (…) In den U-Bahn-Stationen steht immer noch das Wasser, in den Autotunnels, die Manhattan mit den anderen Stadtteilen verbinden, steht es bis knapp unter die Decke. In dem Moment ist es schwer vorstellbar, dass hier demnächst wieder so etwas wie Normalbetrieb einzieht.
Aber über der gesamten Szenerie hängt eine Atmosphäre lässiger Gemütlichkeit. Die Leute schlendern gelassen durch ihre Viertel und begutachten, was »Sandy« angerichtet hat. Eilig hat es heute keiner. Fast ist es so, als hätte der Hurricane die Leute dazu gezwungen, es einmal einfach ruhig anzugehen.
Nur ganz im Süden, am Battery Park, wo Hudson und East River aufeinandertreffen und die Stadt den Gezeiten ausgesetzt ist, peitschen die Wogen noch immer an den Pier. Hin und wieder schwappt eine Welle an Land. Vor ein paar Stunden stand hier alles noch vier Meter unter Wasser.
Manhattan ist in diesem Moment zweitgeteilt. Unterhalb der 34. Straße ist Ausnahmezustand. Notstand. Das Leben steht still. Oberhalb der 34. Straße ist fast alles einigermaßen normal. Wer die Nacht nördlich dieser Linie verbrachte, war auf der sicheren Seite. Wer sie südlich der Linie verbrachte, war in einer anderen Welt. Es ist irgendwie fast so, wie wenn in Bangladesch Katastrophe ist und wir in Wien vor dem Fernseher sitzen. Dann wissen wir, irgendwo geht es Leuten gerade sehr übel, aber wir sind weit weg, haben damit nichts zu tun. So ähnlich war das in dieser Nacht auch in New York, bloß dass Normalzone und Katastrophenzone nur durch drei, vier Wohnblocks getrennt waren. Es war ein beeindruckendes Schauspiel, die Windböen über den Wolkenkratzern. Der Sturm tanzte über der Stadt und trat ihr gelegentlich auf die Finger.
Auch die Katastrophe hat ihre Romantik und das Desaster ist für aufmerksame Beobachter Material. Sie zeigt eine Wirklichkeit, die wir normalerweise übersehen. Sie verändert auch die Wirklichkeit, und wir sehen genauer hin. Heroismus des Sehens, um Susan Sontag zu paraphrasieren, die den Heroismus des fotografischen Sehens »in der Fähigkeit zu Entdeckung von Schönheit … in dem, was jedermann sieht« verspürte.
»Stadt steht still«, schreibt Florian Illies in der Zeit über Berlin, die Stadt sei um ihre Existenzgrundlage gebracht, nämlich um ihre »Besessenheit für das Jetzt«, um die Hektik, um die Eile. Die Partyzone hat jetzt große Pause, stattdessen »schieben sich im Schneckentempo die gelben und braunen Lieferwagen der Paketdienste durch die Straßen und beliefern jedes Haus mit kühnen Kartonbergen, als sei täglich Weihnachten«. Das Einzige, was hier jetzt noch zack, zack geht »ist der Rachenabstrich«.
Epidemien, Pandemien, Seuchen sind, wie Laura Spinney in ihrer großen Untersuchung über die Spanische Grippe schreibt, »im gleichen Maße ein soziales Phänomen wie ein biologisches Phänomen«.
Wie wir eine Pandemie überhaupt wahrnehmen, hängt von gesellschaftlichen Umständen ab. Sie hat gesellschaftliche Auswirkungen, so wie sie biologische Auswirkungen hat. Und Pandemien können Gesellschaften nachhaltig verändern. Und die, die Elementarereignisse durchmachen, bleiben nicht unverändert. Deswegen müssen wir über unser Jahr in der Niemandsbucht dringend nachdenken. Aufschreiben, was da mit uns geschieht. »Jedes Zeitalter bekommt neue Augen«, schrieb Heinrich Heine. Der Sozialcharakter des Nerds, der bisher als eigen und seltsam galt, war plötzlich Normalität. Man hängt den ganzen Tag vor dem Computer und redet manchmal den ganzen Tag mit niemandem. Am tiefsten wird das die »Generation Corona« prägen: Jugendliche, die für ein Jahr um alles gebracht wurden, was zu Jugend dazugehört – ausgehen, Freunde treffen, unvernünftig sein, Menschen kennenlernen, die die Kreise des bisherigen Umfelds erweitern. Distance Learning, das heißt nicht nur auf Distanz lernen, sondern auch die Distanz lernen. Während Erwachsene oft einfach ihr Leben weiter leben können, wollten sie gerade in eines starten und haben nun nichts, worauf sie hinarbeiten können.
Kinder, die jetzt aufwachsen und so klein sind, dass sie sich an eine Normalität nicht mehr erinnern können, sondern längst geprägt sind von einem Jahr Angst, Unsicherheitsgefühl, Ausnahmezustand, Isolation und Gereiztheit der Eltern. »Was macht mit uns, unserer Psyche, unserer mentalen Gesundheit, ein Zustand der permanenten Angespanntheit«, schreibt Elif Shafak. »Die Welt, die wir augenblicklich beleben, ist eine, die unseren Sinn der Verwundbarkeit verschärft.« Man schaltet die Nachrichten ein und hat das Gefühl: »Es ist zu viel, um damit klarzukommen.«