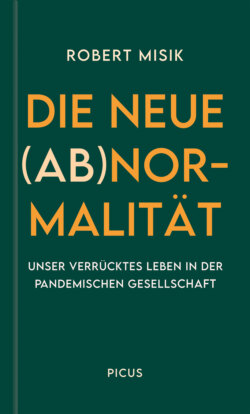Читать книгу Die neue (Ab)normalität - Robert Misik - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ANSTECKUNG
ОглавлениеEs begann mit Meldungen von weit her, steigerte sich zu einem unbekannten Bedrohungsgefühl, und dann der harte Lockdown. Isoliert, daheim, eingesperrt. Die einen in plötzlicher Einsamkeit, die anderen in Angst um den Arbeitsplatz, wieder andere überfordert in Distance Learning und überfordert davon, alles unter einen Hut zu bringen. Andere wiederum wunderten sich, dass die Entschleunigung sich wie Urlaub anfühlte. Aber das war damals noch krass neu und irgendwie auch spannend und außerdem war Frühling. Dann lange Phasen von Lockerungen und scheinbarer Semi-Normalität, ohne dass das Abnormale ganz weggegangen wäre. Immer mehr Unklarheit, was jetzt eigentlich noch »normal« heißen soll. Ein Auf und Ab: Gesellschaft, die sich ihres neuen Solidaritätsgefühls versichert und sich tapfer »Wir schaffen das« sagt, dann wieder Gesellschaft, die es zerreißt, in Disziplinierte und Covidioten, in Blockwarte und Lässige, in alle, die irgendwie sympathisch blieben und in die verschiedenen Formen des Unsympathischen, in die aneinander Interessierten und die Egoisten. Und dann wieder harter Lockdown, da war nichts mehr krass neu und wenig spannend, sondern nur mehr genug – dieses »Es ist dann jetzt genug«-Gefühl –, und kalt war es sowieso und man hockte daheim auf dem Sofa und dachte sich, vielleicht hätte ich im Sommer doch ein paar mehr Leute treffen sollen. Vielleicht doch einmal Party, vielleicht doch einmal Ausgelassenheit. Und dann die Hoffnung, dass das zwar noch nicht bald vorüber ist, aber ein Ablaufdatum hat. Aber ja, jetzt wird geimpft, bald wird geimpft, das Spritzerl hängt am Weihnachtsbaum, danach fängt es mit den Vulnerablen an und dem Krankenhauspersonal, dann Schritt für Schritt der Rest, im Sommer oder spätestens nächsten Winter haben wir es dann überstanden, wer weiß. Dann wird endlich getanzt und gefeiert und nachgeholt, was versäumt wurde, als gäbe es kein Morgen! Immerhin, Hoffnung. Bis dahin: warten. Zeit absitzen, wie die Sträflinge. Wir haben gelernt, unsere Zeit abzusitzen in diesem Jahr. Dem Jahr in der neuen Ab-Normalität, unserem verrückten Leben in der pandemischen Gesellschaft.
Gehen die Inzidenzen nach unten, Inzidenzen, auch so ein Wort, das wir gelernt haben in diesem Jahr, gehen sie also nach unten, die Inzidenzen, dann können wir vielleicht die Abnormität vergessen für einige Augenblicke, Tage, Wochen, gehen sie nach oben, werden unsere Viertel, Städte, Bezirke, Kleinstädte zu roten Zonen und Seuchengebieten, dann ist das Risiko unsichtbar, aber jeder und jede ein potenzielle Gefahr. Der andere, die andere, sie sind plötzlich mit einem Verdacht umgeben. Schließlich könnte doch jeder eine tödliche Gefahr sein. Hustet einer hinter uns in der Trafik, dann sehen wir uns schon mit Beatmungsschlauch im Intensivbett liegen. »Das weckt Ansteckungs- und Berührungsängste, die unmittelbar auf soziale Beziehungen zurückwirken«, sagt die Kulturhistorikerin Ute Frevert, eine Expertin für das Emotionale und die Gefühle im Sozialen. »Wir werden misstrauischer, gehen nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich auf Abstand (…) Der Fremde ist der Gefährder.« Gefragt, ob das nur kühle Beobachtung oder auch Selbstbeobachtung sei: »Aber ja, das Misstrauen gegenüber Menschen, die ich nicht kenne, ist momentan größer.«
Nichts bringt die Verrücktheit dieser Zeit mehr auf den Punkt als der Begriff der »Risikobegegnung«. Die Begegnung, also die soziale Interaktion schlechthin, das Soziale selbst wird mit dem Begriff des Risikos verbunden, um nicht zu sagen: infiziert.
Ansteckung – Englisch: »con-tagion« – und Berührung – »to touch« – haben in vielen Sprachen den gleichen Wortstamm.
Wir erleben einen Kontrollverlust, und das ist für die meisten von uns völlig ungewohnt. Wenn wir das Haus verlassen, spüren wir, dass wir keine Kontrolle über die Gefahr haben, der wir uns aussetzen. Wir bewegen uns vorsichtig, vorausschauend. Fast wie Diebe schleichen wir herum. Stets rechnen wir mit der Gefahr, die die unangenehme Eigenschaft hat, völlig unsichtbar zu sein. Wir haben keine Kontrolle über unsere Gesundheitsrisiken, wir haben noch weniger Kontrolle über unsere künftigen Einkommen. Wir haben noch nicht einmal eine Kontrolle darüber, ob wir künftig unseren Beruf ausüben dürfen. Wir haben eigentlich keine wirkliche Kontrolle darüber, ob und wann und zu welchem Zwecke wir das Haus überhaupt verlassen dürfen. Im Hausarrest individualisiert, haben wir zugleich jede Autonomie eingebüßt.
Wenn alle miteinander verbunden sind, ist die Autonomie eine Chimäre, das spüren wir plötzlich noch mehr als sonst. In komplexen Gesellschaften sind wir immer alle verbunden, aber noch mehr spüren wir diese Verbindung, wenn es Ansteckungsketten sind, die uns aneinanderbinden. In Zeiten der Ansteckung werden wir noch mehr zu einem Organismus, als wir das ohnehin immer sind. Wir halten uns voneinander fern und versuchen doch solidarisch zu sein. Irgendwie: zusammenhalten, indem wir einander aus dem Weg gehen. »Social Distancing«, dieses eigentümliche Wort der Stunde, ein Oxymoron eigentlich, ist auf dumme Weise falsch. Wir halten »physische Distanz« und versuchen, so gut das geht, sozial zu kuscheln. »Es ist ein seltsames Gefühl des Kontrollverlustes, das ich nicht gewohnt bin, aber ich wehre mich auch nicht dagegen«, schreibt der italienische Autor Paolo Giordano.
Ein spannendes Gesellschaftsexperiment, das nur den Nachteil hat, dass wir in diesem Versuch die Beobachter und zugleich die Laborratten sind.