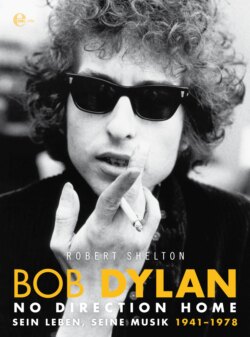Читать книгу Bob Dylan - No Direction Home - Robert Shelton - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»The truth was obscure, too profound and too pure; to live it you had to explode.«[19]
(Die Wahrheit war dunkel, zu tief und zu rein; um sie zu leben, musste man explodieren.)
Dylan
»Jemand musste nach dem aufsteigenden Stern greifen, ich glaube, ich war dran …«[20]
Dylan
Wo soll ich mit seiner Geschichte beginnen? Eigentlich müsste ich eine Filmkamera haben, um die gleißenden Verkettungen der Bilder zu zeigen: Dylan in Chicago, wo er die '74er-Tour begann, die sich zu einer fortwährenden Ovation auftürmte? Oder im Mai 1966 in der Londoner Royal Albert Hall und im Pariser Olympia, wo er der Feindseligkeit des Publikums gegenüber seiner neuen Musik widerstand? Sein Auftritt 1978 vor 250.000 in Blackbushe, England, oder jener andere mit seiner schwarzen Huck-Finn-Kordmütze 1961 in Gerde's Folk City, wo er uns durch seinen intensiven Gesang und seine witzigen Spielchen auf der Bühne elektrisierte? Oder soll ich 1976 anfangen, wie er neben Jack Kerouacs Grab sitzt und eine Huldigung an einen der Schriftsteller improvisiert, die ihm neue Wege eröffnet hatten? Dylan mit Turban im landesweiten Fernsehen 1976, der bedrückt wirkt und von Bedrückung singt? An Sonntagnachmittagen in seiner Heimatstadt Hibbing beim Jammen mit einer wüsten Rockband? Durch den Wahnwitz von New Orleans' Mardi Gras taumelnd, wo er wissen wollte, warum Schwarze nicht in weißen Bars trinken durften? Bei den Folkfestivals in Newport, wo er das Publikum einmal entzückte und dann wieder schockierte? Wie er ein Haus an der Pazifikküste betrachtete, das kein Heim war, oder wie er auf den Straßen von Woodstock Gitarre spielte? Ein großartiger Performer in den verschiedensten Situationen - sein ganzes Leben schien eine Performance zu sein. Vielleicht sollte ich die Kamera zuerst auf eine Collegebude richten, wo sich 1966 gammelnde Studenten räkeln und Blonde On Blonde hören. Oder zehn Jahre später auf dieselben Studenten, nun alle ehrbare Mittelstandseltern, die zum ersten Mal Desire lauschen?
Oder fange ich in der Mitte an, als die turbulenten 60er hinter ihm lagen und die unerforschten 70er eben erst begannen? Fast ein Jahrzehnt, nachdem ich ihn kennengelernt hatte, besuchte er mich im Henry-Hudson-Hotel in der West Side von Manhattan. Ich hatte ihn seit seinem Auftritt beim Festival auf der Isle of Wight 18 Monate zuvor nicht mehr gesehen. Ich hatte in England gelebt und all das ausgesiebt und zusammengefügt, was ich über seine Karriere an Fakten und Wahrheiten jenseits der Fakten besaß. Ich hatte die absolute Wahrheit gesucht, wusste aber, dass ich bestenfalls auf relative Wahrheit hoffen konnte. Ich wollte die Tür zu seinen kreativen Geheimnissen aufsperren. Ich sagte ihm, er habe den Schlüssel, aber das Schloss gehöre nicht ihm. Dylan ist ja oft nicht der beste Erklärer seiner selbst. Er hatte seine Meisterwerke geschrieben, seine turbulente Geschichte stückchenweise in Liedern, Gedichten, Interviews und Diskussionen erzählt. Ich wollte sie zusammenfügen -zum Teil deshalb, weil ich fand, er sei eine viel bemerkenswertere Persönlichkeit, als je ein Romancier sie erfinden kann. Ich hatte Dutzende von Leuten interviewt, die ihn zu kennen glaubten. Kein einziger von ihnen hatte gesagt: »Ich weiß, wer er wirklich ist.« Meistens mussten sie zugeben, nur einen Teil des Bildes zu kennen, und überließen mir dann ein kleines Stückchen Erlebnis, Erkenntnis oder Anekdote, das ich ins Mosaik einfügen konnte. Fast alle, die ich interviewte, hatte so viele Fragen an mich wie ich an sie, einschließlich seiner Eltern und seines Bruders. Ich fühlte mich wie der Reporter in Citizen Kane auf der Suche nach Rosebud. Aber es gab Dutzende Rosebuds.
Als er durch den Korridor des Hotels näherkam, sah er wieder einmal anders aus. Sehr gesund, die Wangen wiesen sogar ein bisschen Farbe auf. Bartkranz, schwere Arbeiterstiefel, Kordhose, ein altes Countryhemd lugte aus seiner Lederjacke. Ich fragte mich, ob das Treffen eher enttäuschend oder so wie immer verlaufen würde - ein paar Scherze, das Gefühl eines bevorstehenden Dramas, ein Hauch Mysterium, ein Anflug von Zorn? Niemand ist für seinen Biographen ein Held, aber auch kein Antiheld. Warum verblüffte mich dieser Mann, den ich so gut kannte, jedesmal wieder? Schließlich stand er jetzt nicht auf der Bühne; warum sollte er also so aufgedreht sein, als ob sich gleich die Vorhänge teilen würden? Wie würde er heute sein - hitzig, unergründlich, angespannt oder scherzhaft? Welches seiner vielen Pseudonyme würde er darstellen - Elmer Johnson, Tedham Porterhouse, Bob Landy, Robert Milkwood Thomas, Big Joe's Buddy, Blind Boy Grunt, Keef Laundry oder Judge Magney? Nach Princeton vielleicht Dr. Bob Dylan?
»Wie geht's dir?« fragte ich, und beim Händeschütteln sagte er mit einem warmen Lächeln: »Ach, ich komm zurecht, glaub ich.« Bob kam in mein Zimmer und begann, jedes Detail darin genau zu untersuchen. »Was wohl in diesem Zimmer alles passiert sein mag«, sinnierte er, als wäre er nie zuvor in einem heruntergekommenen Hotel gewesen. An einer Wand fehlte ein Stück Putz. Er überlegte, ob hier vor Jahren bei einem Krach zwischen Verliebten jemand eine Whiskyflasche oder einen Aschenbecher geschleudert hatte. Bobs ganzes Gesicht sprach von Ruhe und Ausgeglichenheit. Ich erinnerte mich an die Bemerkung seines Bruders: »Er war wie ein Fünfzigjähriger. So ruhig, so friedlich und so würdevoll.« An diesem Morgen sah er aus wie New Morning.
Wir tauschten uns über unsere Wohnorte aus. »Woodstock ist ein schlechter Witz geworden. Die haben sogar Touren dahin veranstaltet. Da sind Leute angekommen, die ein bisschen Erde oder Rasen oder Laub mitnehmen wollten.« Sein »Eden« sei zu einem Zoo geworden, sagte er. Warum war er nach Greenwich Village zurückgekommen? »Das kann ich dir vielleicht sagen, wenn wir nicht mehr im Village leben. Wir sind bloß auf der Durchreise. Manchmal muss man einfach viele Straßen lang gehen, um da anzukommen, wo man hin will. Was zählt, ist, in Bewegung zu bleiben. Oder dann und wann am Straßenrand anhalten und ein Haus bauen. Das ist wohl das Beste, was man machen kann.« Ob es darum gehe, etwas zu finden, wo er sich vor Bekanntheit und Ruhm verstecken könne? »Nein«, antwortete Bob, »ich will mich wirklich vor gar nichts verstecken.« Die Stimme war ganz gelassen, das Sprechtempo passte zu seiner Stimmung. Aber kurz darauf erzählte er mir, er werde wieder belagert: Ein selbsternannter »Dylanologe« hatte systematisch seine Mülltonne nach »Hinweisen« auf den »wahren Dylan« geplündert. »Ja, wirklich«, seufzte Bob. »Ich nehme an, das gehört einfach zum Preis der Berühmtheit dazu. Wir haben die Mülltonne mit Mausefallen vollgestopft und dann mit aller Hundescheiße, die wir auftreiben konnten, aber der hat einfach weiter den Müll durchwühlt.« Nicht jeder Superstar hatte diesen Preis für seinen Ruhm zu entrichten. Warum man ihn immer noch so sehr verehre oder anfeinde? »Die Medien haben das über mich gebracht. Die haben mich so ungeheuer aufgeblasen. Was ich gemacht hab, war ja nur für ein paar Leute, die auf der gleichen Wellenlänge lagen wie ich. Was ich gemacht hab, war eigentlich nichts für ein Massenpublikum. Das Massenpublikum, das war alles ein großer Hype. Ich bin doch nicht der Typ, der in einem Stadion auftritt, war ich auch nie. Da gab's ja den Slogan ›die Beatles, Dylan und die Stones sind die kings‹. Ich hab das nie gesagt. Ich hab mich nie king oder so was genannt. Das haben die Promotion-Leute gemacht. Die Medien waren das. Ich hab den Titel ›king‹ nie abgelehnt, weil ich ihn überhaupt nie akzeptiert habe.« So wirkte das damals auf ihn, ehe er so weit war, mit der '74er-Tour wieder auf den Marktplatz zu gehen. Wenn er die Medien angriff, auf denen er wie auf einer Harfe spielen konnte, hörte man am besten einfach nur zu.
Ich sagte ihm, wie deprimierend es sei, dass immer noch so viel triviales Zeug verhökert würde, nachdem er Intelligenz in die Popmusik gebracht habe. Wie könne denn das Top-Forty-Radio mit so einer erbärmlichen Qualität weitermachen, nachdem er das Gesicht der Popmusik so sehr verändert hatte? Dylan erwiderte: »Wenn man das Gesicht der Popmusik verändert, ändert man nicht unbedingt ihren Stoffwechsel. Den Stoffwechsel hab ich nicht verändert. Ich habe bloß eine Menge neuer Türen aufgestoßen. Aber du wirst zugeben, der Einfluss - mein Einfluss - ist da, überall, sogar in der Country Music. Heute kann man den Klang der Straße fast überall in der Popmusik hören. Der Einfluss ist da.«
Wir redeten über ein paar alte gemeinsame Freunde, mit denen wir nicht mehr viel Kontakt hatten. Ich spürte bei Bob eine Art Heimweh nach den alten Tagen, und später hat er ja versucht, sie mit der Rolling Thunder Revue wieder zu beleben. »Das waren wirklich gute Tage. Das war damals eine Bewegung, eine richtige Bewegung. Aber es war wahrscheinlich die letzte Bewegung. He«, rief er, »das wäre doch ein guter Songtitel, oder?« Ein wenig traurig fasste er zusammen: »Der Traum ist ausgeträumt. Dieses Gefühl ist nicht mehr da. Es ist sinnlos, nach etwas zu greifen, was vorbei ist. Zwischen dem, was die Leute heute machen wollen, und dem, was in den frühen 60ern passiert ist, sehe ich keine Ähnlichkeit. Die frühen Tage im Village waren wunderbar und die in Dinkytown noch mehr. Jetzt ist alles deprimierend. Das Village ist deprimierend. Neon und Ramsch. Heute sieht es so aus, als würden Tausende Jahre Erfahrung in ein einziges Jahr gepresst. Was jetzt abläuft, überrascht mich nicht. Schau dir an, was für Bücher und Platten und Müll die jeden Tag rausbringen. Das ist unglaublich.«
Fand er in den Aktivitäten der Neuen Linken denn nichts, was ihn ermutigte? »Die Neue Linke hat eigentlich keine Politik, kein Programm, keine Philosophie, wenn man's genau nimmt. Eigentlich gibt es keine Neue Linke. Diese Leute, die für den Frieden marschieren, sind bloß am Frieden interessiert, und das macht sie nicht zum Teil von irgendeiner Neuen Linken. Das ist nicht wie die Alte Linke oder das, was wir in den Anfangsjahren hatten. Die Alte Linke hatte ein Programm, eine Politik, einen Standpunkt und so was. Die Alte Linke hatte gute Gründe. Wenn man's genau nimmt, gibt es keine Jugendkultur und keine Neue Linke, und was das Musikgeschäft angeht, ist das nur ein Spielzeug, nicht mehr.«
Was er sagte, klang zynisch, sein Tonfall war es jedoch nicht. Er schätzte nur gelassen die momentane Situation ein. Ich fragte ihn, was er in letzter Zeit gelesen habe - eine Frage, die er früher, nach seiner Ankunft in New York, nicht beantwortet hätte, als er alles las, was er vor die Augen kriegen konnte. Noch in den späten 60ern, als er in Woodstock eine große Bibel aufgeschlagen auf einem Pult liegen hatte, wäre es ihm anmaßend vorgekommen, jemandem davon zu erzählen. (Anfang 1977 fragte das Times Literary Supplement Dylan, neben einer großen Anzahl literarischer Schwergewichte, was er für die unter- bzw. überschätztesten Bücher des Jahrhunderts halte. Beide Fragen beantwortete er spöttisch mit: »Die Bibel.«)
Bob erwiderte: »Zu sagen, was ich gerade lese, ist für mich eine große Verantwortung, weil zu viele das als eine Art Reklame ansehen würden. Einige würden gleich losrennen und anfangen, eben dieses Buch zu lesen, und das will ich nicht auslösen. Das ist schon mal passiert, als ich gesagt habe, dass ich mich für das I Ging interessiere.« Aber dann gab er nach und erzählte, er lese gerade Romane von Isaac Bashevis Singer und Chaim Potok. »Die enthalten für mich heute viel mehr Sinn als all der Maharishi-Kram oder diese indische Mystik.« Bob stand kurz vor einer privaten Reise nach Israel, und wieder konnte er nicht verhindern, dass sie maßlos viel Publicity erhielt. »Vorige Woche war ich bei einer chassidischen Hochzeit«, sagte er, und ich glaube, er wartete auf eine Reaktion von mir. »Das Jüdische kriegt in dieser Stadt immer mehr Gewicht«, sagte er.
Bob wusste, dass ich jahrelang seine alten Freunde kontaktiert hatte, um eine umfassende Biographie zusammenzutragen. Ich erzählte ihm, ich hätte endlich einen guten Freund aus Hibbing aufgestöbert, John Bucklen. Bob lächelte. »Wo zum Teufel hast du den denn aufgetrieben?« Ich sagte, er sei Discjockey in Wisconsin. »John war wirklich ein Kumpel, mein bester Kumpel.« Das letzte Mal, als er ihn gesehen habe, »war ich wahnsinnig in Eile, furchtbar unter Druck. Ich bin zum Klassentreffen nach Hibbing gefahren.« Die 10-Jahre-Feier des High-School-Abschlusses sei ziemlich erhebend gewesen. Er fuhr fort: »Als ich 15 war, hab ich mir gesagt: ›Die behandeln mich hier jetzt ziemlich mies, aber irgendwann komm ich wieder, und dann werden alle angerannt kommen, um mir die Hand zu drücken.‹ Hab ich mir damals wirklich gesagt. ›Ich komm wieder her, und dann werden die zu mir aufschauen.‹ Das hab ich mir damals vorgenommen. Und im Sommer '69 ist es tatsächlich so gekommen. Ich hab da in Hibbing gesessen und musste Autogramme geben, mehr als eine Stunde lang … Ja, Echo war auch da. Du kennst ja Hibbing«, fuhr Bob fort. »Du hast das scheußliche Riesenloch im Boden gesehen, wo die Tagebau-Mine war. Die da oben finden das Loch doch tatsächlich schön. Für die ist das Landschaft, die man vorzeigen kann. Tja, das wird ja jetzt mit dem ganzen Land gemacht. Als ich hingefahren bin, habe ich mir Hibbing eigentlich nicht angeschaut. Ich war nur für die Jahrgangsfeier da. Man muss mich nicht daran erinnern, wie es da ausgesehen hat. Das vergesse ich nie.« Er verzog keine Miene, aber es war, als durchliefe ihn ein Schauer. Ich erinnerte mich an sein Buch Tarantula, in dem er geschrieben hatte, er wolle einen faustischen Pakt mit dem Teufel eingehen, um aus der Wüstenei des mittleren Amerika fortzukommen. »Ich hab diese Höhlungen satt«, schrieb er, und das große Loch von Hibbing war eine Metapher für alle widerwärtigen Hohlheiten, die er um sich her sah.
Wir sprachen über seine Aufnahmen. Ich gab zu, ich hätte es oft bedauert, dass die Bedingungen des Journalismus mich dazu zwangen, einige seiner Alben zu analysieren, ehe ich mit ihnen gelebt hatte. Als wir auf Self Portrait kamen, wurden seine Augen schmal wie immer, wenn er sich angegriffen wähnte. Ich sagte, ich müsse mir dieses kontroverse Album noch einmal anhören. Damals wie heute war Dylan umringt von Raubpressern, Aasgeiern und solchen Autoren, die sich mit Drohungen in sein Leben drängelten, die er aber weder kannte noch respektierte. Hinsichtlich der Ehren, die einige ihm erwiesen hatten, war Bob sichtlich gespalten; jedenfalls verabscheute er die Fließbandproduktion einer Instant-Popkultur, den massenhaften Ausstoß an Postern, Raubpressungen, Pseudobiographien, Artikeln, oberflächlichen Besprechungen. Für ihn war das eine alte Wunde. Ich erinnere an seine Zeilen in den »11 Outlined Epitaphs« von 1964:
I don't like t' be stuck in print starin' out at cavity minds who gobble chocolate candy bars quite content an' satisfied their day complete at seein' what I eat for breakfast the kinds of clothes I like t' wear an' the hobbies that I like t' do[21]
(Ich mag nicht im Druck feststecken hohle Geister anstarren die Schokoriegel mampfen ganz zufrieden und satt ihr Tag vollendet wenn sie sehen was ich frühstücke welche Kleider ich trage welche Hobbys ich habe)
Ich versuchte Dylan zu versichern, dass mein Porträt von ihm seine Würde wahren und ihn als Künstler respektieren wolle. Er kenne mich doch nun lange genug, um mich nicht zu den Reportern zu zählen, die es für einen ehrbaren Broterwerb halten, Prominente zu entblößen. Dylan erwähnte ein paar Leute, zu denen ich Kontakt suchen sollte, etwa Philip Saville, einen englischen Fernsehregisseur, mit dem er einmal gearbeitet hatte. Er nannte auch ein paar Namen aus Minneapolis, und ich fragte, inwiefern die hilfreich sein könnten. Bob lächelte und sagte: »Ist bloß ein Tip.«
Ob er sich zur Drogenfrage äußern wolle? »Welche Sorte Drogen?« gab er zurück. »Ich hatte nie was damit im Sinn, Drogen zu Glamour zu verhelfen. Das waren die Beats, nicht ich. Was harte Drogen angeht, das ist eine Frage des Handels. Der findet statt, und das ist eine üble Szene. Man muss sich aber klarmachen, daß Junk nicht das Problem an und für sich ist. Junk ist das Symptom, nicht das Problem, wie Freud sagen würde.« Ob er mittlerweile sein Porträt im Film Don 't Look Back akzeptieren könne, bei dem er sich lange unbehaglich gefühlt hatte? »Ach, den hab ich vor einem oder zwei Jahren gesehen. Ich seh den jetzt aus einer anderen Perspektive und ärgere mich nicht mehr so darüber wie früher. Ich kann fast behaupten, dass ich ihn mag.«
Diese Milde vom zornigsten der zornigen jungen Männer überraschte mich. In den frühen Jahren in New York hatte er charmant begonnen, wurde dann immer angespannter, misstrauischer und schwieriger. Aber hier saß mir ein maßvoller Mann gegenüber, der sich anschickte, endlich die Verbindungen zu seinem langjährigen Manager Albert Grossman zu kappen. »Er hatte mich für zehn Jahre unter Vertrag, für Anteile an meinen Platten, Anteile an allem von mir. Aber nächsten Monat bin ich da raus. Am Ende musste ich mit ihm vor Gericht. Ich habe mir einen Anwalt genommen und wollte ihn verklagen, aber Albert wollte kein Aufsehen, und deshalb haben wir uns außergerichtlich geeinigt. Viele Leute würden Umwege machen, um Albert plattzumachen, aber ich nicht.« (Dylan hat niemals seine beträchtlichen Medienmöglichkeiten genutzt, um seine Probleme mit Grossman oder Columbia Records zu klären oder mit den Musikverlagen, die bis 1965 einige wichtige Dylan-Copyrights besaßen. Damals wie heute hat vielleicht ein Gespür für Würde, ein Rest Loyalität Dylan daran gehindert, in diesem Zusammenhang seine Wortwaffe einzusetzen. Möglicherweise hat es ihm der bloße Besitz dieser Abschreckungswaffe möglich gemacht, sich von den Ketten und Fesseln eines Vertrags zu befreien, der aus dunkler Vorzeit bis in die Ewigkeit reichte.) Bob erzählte mir auch, dass viele Abschlüsse, die er mit Grossman gemacht hatte, zum Beispiel sein erster Musikverlagsvertrag, sich als besser für Grossman als für ihn selbst herausgestellt hatten. Es war ein schwieriger, fünf Jahre währender Scheidungsprozess gewesen, der für beide Seiten schmerzlich war. Nach der erschöpfenden Welttournee 1965 - 66 hatte Grossman noch mehr als 60 weitere Konzerte für ihn gebucht.
Dylan ist einer der wenigen Künstler der Epoche, die zumindest Teile der Kontrolle im Musikgeschäft von den Pfeffersäcken in die eigenen Hände genommen haben. Er hatte mir oft von dem Ärger erzählt, den er mit Geschäftsleuten, Mitarbeitern der Plattenfirmen, Agenten und Tourneeplanern gehabt hatte. Sobald er stark genug dazu war, hatte er seine Bedingungen durchgesetzt. Was für eine feindselige Welt war denn das für einen Dichter? Er brauchte einen Schild. Als mit seinem Manager alles glatt lief, lobte Bob ihn über den grünen Klee, und selbst jetzt war er sehr zurückhaltend mit Angriffen gegen Albert; er sagte nur: »Albert hat einen lausigen Geschmack -und das darfst du zitieren.« Er bezog sich damit offenbar darauf, wie Albert Woodstock-Bearsville verstädterte, mit einem Edelrestaurant in einem Farmhaus und einem Plattenstudio. »Ein Country-Farmhaus!« rief Bob. »Unglaublich!« (Schon 1963 hatte er für die anderen Broadside-Sänger eine Warnung verfasst: Sie sollten sich hüten vor den unsichtbaren »Käufern und Verkäufern«, die alle Seiten gegeneinander ausspielen und den Künstler zwischen die Mühlsteine setzen.)
Er hatte Einwände, aber er war nicht rachsüchtig. Sogar für ihn gibt es Grenzen, was das Herausfordern von Autoritäten angeht. Das internationale Musikgeschäft ist ein Koloss, und Dylan hatte ihn satteln müssen, um auf ihm reiten zu können. Er kannte dessen Verlockungen, Schwächen und Heucheleien. Er arbeitete »innerhalb des Business«, versuchte aber, eine gewisse Distanz zu wahren. Mit welchem Erfolg? Er hatte keinen Fanclub, warb nicht für Produkte, hatte in seinen Rückzugsphasen auf mehrere Vermögen verzichtet. In den 60ern hatte er gesehen, wie die amerikanische Popmusik-Industrie von 250 Millionen Dollar pro Jahr auf über eine Milliarde pro Jahr anwuchs. Nach diesem Jahrzehnt war Dylan bereit, mir gegenüber das Musikgeschäft »ein Spielzeug, ein Spiel« zu nennen.
Wir beide wussten, dass Folkways, Vanguard und Elektra ihn schmählich missachtet hatten, ehe er bei Columbia einen Vertrag von einem Produzenten bekam, der ihn nicht einmal hatte singen hören! Es ist eine alte Geschichte, wie Presley und die Beatles und Dylan von der Musikindustrie verschmäht oder verlacht wurden, bis sie die Bestie gezähmt hatten. Die Grausamkeit des Showgeschäfts ist eine Platitüde - aber wenn Leute von der Größe Dylans oder der Beatles mit den Geschäftsleuten stritten, war es für den Mann auf der Straße nicht leicht, mit ihnen zu sympathisieren.
Konnte der Musikfan mehr Sympathie empfinden für die Hunderte oder Tausende, die im Räderwerk des Showgeschäfts zerrieben wurden? Ein führender Mann der Musikindustrie, der nicht genannt werden möchte, hat mir gegenüber die Arbeitsweise dieses Geschäfts verteidigt. Er erwähnte den harten Wettbewerb, das hohe Risiko. Ich teile einen Teil von Dylans Zorn darüber, wie das Geschäft funktioniert. Es ist eine Litanei herber Fakten. Wir können Dylan am besten verstehen, wenn wir sehen, wie er mit dieser Welt gekämpft hat, zu seinem Nutzen und Schmerz.
Bob und ich redeten stundenlang. Wenn ich zu nah ans Mark kam, stand er auf und sah aus dem Fenster, als wolle er gleich gehen. Wenn ich den Druck verringerte, setzte er sich wieder. Manchmal improvisierte er Aphorismen: »Man kann nirgends hin. Es gibt im Gefängnis Leute, die können es sich einfach nicht leisten, rauszukommen.« Wir scherzten darüber, dass er nie besonders sorgfältig im Umgang mit den eigenen Erzeugnissen gewesen war. »Ich habe Songs auf Papierservietten geschrieben, genau wie Woody, und mir dann damit den Mund abgewischt«, erinnerte er sich lächelnd.
»1959 habe ich ganz neue Sachen gemacht. Ich war damals ziemlich abgerissen, aber ich hab Sachen gemacht, wie sie seitdem nicht wieder zu hören waren. Hör dir meine Platten vor 1965 an, und du wirst heute nichts finden, was auch nur so ähnlich klingt.« Flossen die Lieder immer noch so schnell aus ihm heraus wie früher? »Vor ein paar Jahren, als ich mitten im Getümmel war, hab ich manchmal einen Song in zwei Stunden, höchstens in zwei Tagen geschrieben. Jetzt sind es manchmal zwei Wochen oder mehr.« (Ein paar Wochen später las ich eine dieser Geschichten über Dylan, wonach er bei einer Studiosession einen Song in 25 Minuten geschrieben habe!)
Ich versuchte ihn hinsichtlich gesellschaftspolitischer Aktionen auszuhorchen, und hier schienen die alten zornigen Feuer immer noch zu glimmen. Wir stimmten darin überein, dass Amerika nach wie vor große Probleme habe, dass die Herren des Kriegs immer noch an der Macht seien. Bob äußerte sich nicht dazu, ob oder wie er wieder auf die Barrikaden steigen würde. Aber als er sagte: »Damit kommen die nicht durch«, klang seine Stimme sehr entschlossen. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis er gegen »die« wieder zur Keule greifen würde.
Bob wollte sich unbedingt das Schwimmbecken im Keller ansehen. Wir gingen hinunter und standen ein paar Minuten neben dem Becken; seine Augen wurden groß und glühten in diesem hellen Blau. »Gibt es viele solche Pools in der Stadt?« fragte er, als wäre ich ein Fachmann für Schwimmbäder in Manhattan. »Ich muss mir unbedingt so was suchen.« Dann plauderten wir, bis wir draußen seinen neuen limonengrünen Station Wagon erreichten. Ein paar Leute kamen auf der West 57th Street an uns vorbei, aber keiner bemerkte ihn.
Dylan und seine Frau wollten zwei Tage später nach Israel fliegen. Ich wollte in New York bleiben, um Erinnerungen an Greenwich Village und Woodstock aufzufrischen. Damals lebte ich in der Vergangenheit und stellte die Uhr zurück auf die große Zeit der frühen 60ern. »Folk City ist bloß noch ein Parkplatz«, hatte Bob mir gesagt, und da an der Ecke war es, einfach abgerissen und asphaltiert. Mike Porco war mit dem Club in die 3rd Street umgezogen. Ich ging vorbei an Dylans altem Apartment in der West 4th Street, gegenüber vom Hip Bagel, und dann weiter zu seiner neuen Behausung die Straße hinab. Sara Dylan kam eben aus dem Eingang, schaute sich nach beiden Seiten um; sie trug eine Sonnenbrille und einen Regenmantel und ging mit ihrem kleinen weißen Hund spazieren. New York ist nicht einmal was für Hunde, dachte ich. Nicht genug Platz zum Atmen. Die Bleecker Street wirkte noch heruntergekommener als früher - müde, schmutzige, traurige Cafes. Es gab noch Pizzaläden und Espressobars, aber mit allem war es bergab gegangen. Erst im Sommer 1975 würde Bob das Village wieder mit dem alten Geist befeuern. Im Moment blickte ich zurück auf 1960. Das New York, in das Dylan damals kurz vor Jahresende kam, war der Asphaltdschungel, der es immer gewesen war - voller Vitalität und Konflikte, eine Verlockung für alle jungen Männer und Frauen aus den Provinzen, die die kargen Ressourcen ihrer Heimatstädte aufgebraucht hatten.
1960: ein weiterer Punkt, an dem die Geschichte beginnen könnte. Damals hatte es so viel Hoffnung gegeben. John F. Kennedy hatte die Präsidentschaft um Haaresbreite vor Nixon gewonnen. Floyd Patterson war Boxweltmeister. Die Radio-Seifenoper The Romance of Helen Trent sickerte nach 27 klebrigen Jahren in den Abfluss. Im Süden begannen 1960 in Greensboro, North Carolina, die Sit-ins für die Rassenintegration. Der Pilot eines amerikanischen Aufklärungsflugzeugs vom Typ U-2 wurde von den Russen abgeschossen. Castro konsolidierte die kubanische Revolution. Der Kalte Krieg, der zuletzt nach Tauwetter ausgesehen hatte, gefror wieder.
Die Amerikaner lasen Wer die Nachtigall stört, Frei geboren und Aufstieg und Fall des Dritten Reichs. Viele machten sich bereit, die Hundertjahrfeier des Bürgerkriegs zu begehen. Zu den Broadway-Hits gehörten A Taste Of Honey und Bye Bye Birdie. Elvis drehte einen weiteren schrecklichen Film, G. I. Blues, während Paul Newman zur neuen Kultfigur des Kinos wurde. Hitchcock erschreckte uns zu Tode mit Psycho, während ein sanfter Frank Sinatra der Star von Can-Can war. Oscar Hammerstein II, Textdichter von Oklahoma! und South Pacific, starb mit 65. Emily Post[22] starb mit 86, und Amerikas Manieren erholten sich nie ganz von dem Schock. Sonntags nie war als Film und Lied ein internationaler Hit. Hank Ballards »The Twist« würde bald von Chubby Checker zu einem erfolgreichen Tanz gemacht werden. Das Aufregendste in der populären Musik kam aus dem Folk - es war ein Revival, das den Rhythmus der frühen 60er vorgeben sollte.
1960 stand Amerika um den jungen Mann im Weißen Haus, von dem wir hofften, dass er ein Idealist sei. Wir versuchten zu glauben, dass »die neue Grenze« mehr als ein Slogan wäre. Ehe die Raketenkrise um Kuba, die Kugeln der Attentäter und Vietnam aus all den Verheißungen Kummer machten, war es eine großartige Zeit, um jung zu sein und aufzubrechen. Bevor Martin Luther Kings passiver Widerstand gestoppt wurde, war es sogar die Zeit, schwarz und jung und hoffnungsvoll zu sein.
1960 war: nach Joe McCarthy, vor Eugene McCarthy[23]. Nach den Beats, vor den Hippies. Nach der Alten Linken, vor der Neuen Linken. Nach Campbell-Suppen, vor Andy Warhol. Nach Dada, vor Camp[24]. Nach Batman, vor Batmans Wiederkehr. Nach Village Voice, vor East Village Other. Nach Marshall Field[25], vor Marshall McLuhan. Nach Trotzky, vor Yippie.
1960 war: post-Thomas-Wolfe, ante-Tom-Wolfe. Post-Presley, ante-Beatles. Nach Bill Mauldin[26], vor Jules Feiffer[27]. Nach Tee, vor pot. Nach dem Lindy, vor dem Twist. Nach apathisch, vor cool. Nach den Angry Young Men (den zornigen jungen Männern), vor den Protestsängern. Nach Billy Graham[28], vor Bill Graham[29]. Nach dem Momismus[30], vor dem Pop-ismus[31]. Nach dem Establishment, vor den street people.
1960 war eine Zeit der Verheißung. Aus einer Vielzahl von Gründen begann die Jugend der Welt zu atmen und sich zu regen nach all der fürchterlichen Stille und Apathie der 50er. Papst Johannes XXIII. schubste die Kirche ins 20. Jahrhundert. Castro und Guevara versuchten, eine Revolution, die bürokratisch und erstickend geworden war, wieder bunt zu machen. Kennedys »Camelot« brachte einiges an Jugend, Kultur und Stil in das spießige Washington.
Und 1960 war, bevor Bob Dylan nach New York kam.
Anmerkung des Herausgebers: Dieses »Vorspiel« wurde ursprünglich 1977 als 1. Kapitel geschrieben und wurde 1980 überarbeitet, als Shelton an der (wie er hoffte) letzten Fassung des Manuskripts saß. Zu diesem Zeitpunkt wollte er daraus das 2. Kapitel machen, nach dem ersten über Dylans Kindheit in Hibbing. Danach wollte er mit dem Interview von 1966 weitermachen, das er mit Dylan führte, als sie von Lincoln, Nebraska, nach Denver, Colorado, flogen - eine filmische Eröffnung mit Rück- und Vorblenden. Man überzeugte Shelton aber davon, dass dieses Vorgehen den Leser eines ohnehin schon recht komplizierten Buchs weiter verwirren würde, und kam überein, dass der Text am besten als eine Art Einführung einzusetzen wäre, die dann in der Ausgabe von 1986 unter dem Titel »Leblosigkeit, der Feind« firmierte.