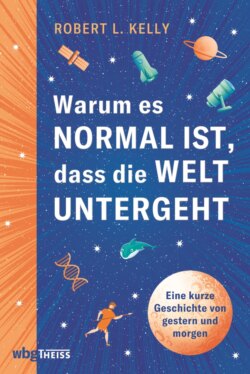Читать книгу Warum es normal ist, dass die Welt untergeht - Robert Kelly - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2 Wie denken Archäologen?
ОглавлениеEs geht nicht darum, was man findet, es geht darum, was man herausfindet.
SO DER ARCHÄOLOGE DAVID HURST THOMAS
Vor einigen Jahren saß ich in Truth or Consequences, New Mexico, am Straßenrand. Die Stadt hieß früher Hot Springs. 1950 änderten die Stadtväter den Namen ihrer Gemeinde, als der Moderator einer beliebten Radiosendung versprach, das nächste Mal aus der ersten Stadt zu senden, die sich umbenennen und fortan wie seine Sendung heißen würde. »T or C«, wie die Einheimischen sie nennen, ist heute noch eine Stadt mit Humor. Als ich dort am Straßenrand saß, sah ich, wie sich dieser Humor in den Autoaufklebern widerspiegelte. Auf dem Wagen eines Star-Trek-Fans las ich: »Mein Gott, Jim, er ist tot. Du nimmst seine Brieftasche, ich seinen Tricorder.« Und ein Aufkleber sprach mich ganz besonders an: »Archäologen sind die Cowboys der Wissenschaft.«
Cowboys und Archäologen sind immer für einen Spaß zu haben. Ich erinnere mich an den 4. Juli 1976 in Austin, Nevada, einer weiteren Kleinstadt mit Humor. Meine Freunde und ich waren dort in einem kleinen Hotel abgestiegen, das wir liebevoll »Austin Hilton« nannten, als Les Boyd, ein Cowboy von der Triple T Ranch, hoch zu Ross in die Lobby geritten kam und fragte, ob »irgendein Vogel hier« mit ihm um die Wette reiten würde. Niemand schien das sonderlich merkwürdig zu finden, und nachdem sich ein Kontrahent gefunden hatte, wendete Les sein Pferd und trottete seelenruhig wieder hinaus. Sämtliche Bewohner von Austin (es ist eine sehr kleine Stadt) schlenderten zu einer unbefestigten Landebahn etwas außerhalb, jemand feuerte eine Pistole ab, und los ging das Rennen. Boyd war ein ausgezeichneter Reiter. Die Zügel locker in der Armbeuge, galoppierte er die Piste hinunter und drehte sich, mit einem Glas Bier in der einen und einer brennenden Zigarre in der anderen Hand, im Sattel um und feuerte seinen Herausforderer grinsend an: »Na los! Leg mal ’nen Zahn zu!«
Archäologen ticken ganz ähnlich. Unter der sengenden Sonne mit Zahnarztbesteck ein zerbrechliches Knochenfragment freizulegen kann nicht nur langweilig sein, es kann einen an den Rand des Wahnsinns treiben. Daher erleichtern sich Archäologen ihre Arbeit mit Anekdoten und Witzen. Ich habe mitbekommen, wie Studenten beim Graben ganze Episoden der Simpsons nacherzählten, ich habe Gesprächsfetzen mitgehört, bei denen ich mich ein ums andere Mal fragte, worüber die da bloß redeten, so etwas wie: »Ach ja? Chuck Norris hat zweimal bis unendlich gezählt!« Oder mein Favorit: »Ich sag dir, der Affe litt ganz bestimmt unter Verstopfung.« Bei der Mittagspause an einem besonders heißen Tag in Nevada verkündete eine Studentin: »Orangen sind besser als Sex!« Und damit brach sie eine lange Diskussion vom Zaun, was man mit Obst alles anstellen kann. Ich kann das hier unmöglich wiedergeben.
Archäologen brauchen Humor. Archäologie ist kein Hexenwerk, sie ist um einiges komplexer. Zumindest wissen Hexen gleich, ob sie alles richtig machen: Entweder funktioniert ihr Zauberspruch oder nicht. Ohne Zeitmaschine können wir Archäologen niemals sicher sein, dass wir aus unseren Funden die richtigen Schlüsse ziehen. Wir verbessern ständig unsere Methoden, aber wenn wir ehrlich wären, dürften wir niemals sagen: »Dies und das ist damals geschehen«, sondern nur: »Wir glauben, dass dies und das damals geschehen ist, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist soundso hoch.« (Das sagen wir natürlich nicht, denn das wäre, ehrlich gesagt, recht ermüdend.)
Aber manchmal sind wir dann doch in der Lage, die Vergangenheit so detailliert zu interpretieren, dass wir selbst darüber staunen. Zum Beispiel als Wanderer 1991 hoch in den Ötztaler Alpen einen nackten männlichen Leichnam entdeckten; er war so gut erhalten, dass sie davon ausgingen, es handele sich um einen kürzlich verunglückten Wanderer. Sie riefen die Polizei, doch die Gerichtsmediziner merkten schnell, dass die erstarrte Leiche schon länger im Eis gelegen hatte. Eine Radiokarbon-Datierung bestätigte diese Vermutung und ergab, dass der Mann, den man heute als Ötzi kennt, vor etwa 5100 Jahren gestorben war, während des europäischen Neolithikums (der »Jungsteinzeit«, vor 9000 bis 4000 Jahren).
Ötzi ist so gut erhalten, dass an seinem Körper sogar noch fünfzig Tätowierungen sichtbar sind. Analysen des Skeletts haben ergeben, dass er ca. 45 Jahre alt war, als er starb, 1,60 Meter groß war und 50 Kilogramm wog. Er hatte dunkles, gewelltes schulterlanges Haar und trug einen Bart. Seine Zähne waren stark abgenutzt, da er viel Weizenvollkornschrot aß, aber er hatte kaum Karies. Der hohe Arsengehalt in seinen Haaren deutet darauf hin, dass er noch kurz vor seinem Tod dabei gewesen war, als Kupfer eingeschmolzen wurde, und die Rillenbildung in seinen Fingernägeln zeigte, dass er acht, dreizehn und sechzehn Wochen vor seinem Tod krank gewesen war – wahrscheinlich als Folge einer chronischen Erkrankung. Laut seiner DNA hatte er braune Augen, war laktoseintolerant, hatte die Blutgruppe 0, war mit Menschen verwandt, die heute auf Sardinien leben, und litt wahrscheinlich an Lyme-Borreliose. Mit den gleichen Methoden, die Forensiker verwenden, um von Totenschädeln Gesichter zu rekonstruieren, erstellten italienische Forscher ein Porträt von Ötzi. Es ist das einzige Gesicht eines Menschen aus der Jungsteinzeit, das wir je zu Gesicht bekommen haben.1
Wir wissen auch, wie Ötzi gekleidet war und was er bei sich trug. Seine Schuhe waren aus Hirschleder und Bärenfell gefertigt und mit Gras ausgepolstert. Gamaschen, Lendentuch und Mantel waren aus dem Leder domestizierter Ziegen, er hatte eine aus Gras gewebte Matte bei sich und trug eine Mütze aus Bärenfell. Ötzis Mantel war mit einem Gürtel aus Kalbsleder zusammengeschnürt, an dem eine Tasche hing, in der sich mehrere Steinwerkzeuge und ein getrockneter Zunderschwamm zum Feuermachen befanden. Er hatte einen nicht ganz fertiggestellten Langbogen aus Eibenholz dabei, der in Blut getaucht war (um ihn wasserfest zu machen), sowie ein Messer mit einer Feuersteinklinge und einem Griff aus Eschenholz, das in einer Scheide aus Bast steckte. Zum Schleifen von Stein diente ein Stift aus Lindenholz mit einem Einsatz aus gehärtetem Hirschgeweih. In einem Köcher aus Gamsleder trug er zwei fertige und zwölf unfertige Pfeile bei sich. Nach der Art und Weise zu urteilen, wie die Befiederung befestigt war, wurde einer der fertigen Pfeile von einem Rechtshänder, der andere von einem Linkshänder angefertigt. Auf dem Rücken trug er eine Trage mit einem Rahmen aus Haselholz und einem Netz aus Rindenfasern. Außerdem fand man zwei Behälter aus Birkenrinde, von denen einer frische Ahornblätter und der andere Reste von Holzkohle zum Feuermachen enthielt. Sein kostbarster Besitz war zweifellos ein Beil aus Eibenholz mit einer scharfen Kupferklinge, die mit Birkenpech und einem Lederband am Griff befestigt war. Kupfer war im Neolithikum so selten und teuer, dass das Beil ein guter Indikator für den gesellschaftlichen Status von Ötzi ist.
Anhand von Ötzis Zähnen und Knochen konnte man feststellen, dass er im oberen Eisacktal in Südtirol aufgewachsen war und seit zehn Jahren im Vinschgau lebte, aus dem auch seine Steinwerkzeuge stammten. Die Analyse seines Darminhalts hat ergeben, dass seine letzte Mahlzeit aus ungesäuertem Weizenbrot, Hirsch- und Steinbockfleisch und ein wenig grünem Gemüse bestand. Die Pollen in seinen Lungen deuten darauf hin, dass er sich noch zwölf Stunden vor seinem Tod im Vinschgau befand, und der Pollen- und Chlorophyllgehalt der Ahornblätter verrät, dass er seine letzte Reise im Juni unternommen hat.
Und wir wissen sogar, wie Ötzi starb: Er wurde ermordet. Jemand schoss ihm einen Pfeil in den Rücken und schlug ihm danach möglicherweise noch auf den Schädel. Bei einer Röntgenuntersuchung entdeckte man eine steinerne Pfeilspitze, die sein linkes Schulterblatt und ein großes Blutgefäß durchbohrt hatte. Ötzi war binnen Minuten verblutet. Er hatte auch mehrere Schnitte an der Stirn und an den Fingern – vielleicht hat er einen mit einem Messer bewaffneten Angreifer abgewehrt. Auf der rechten Seite des Brustkorbs fand man mehrere geheilte Rippenbrüche, aber auf der linken Seite waren einige Rippen noch kurz vor seinem Tod gebrochen.
Obwohl er seit über fünftausend Jahren tot ist, wissen wir, was Ötzi an seinem letzten Tag auf Erden getan und erlebt hat. Es war Juni, er verließ sein Haus im Vinschgau; er rechnete damit, einige Zeit unterwegs zu sein, denn er packte Utensilien ein, wie man sie für eine mehrtägige Reise benötigte. Jemand verfolgte ihn oder begegnete ihm. Es kam zu einem Kampf, und Ötzi konnte fliehen, doch sein Angreifer holte nahe dem Bergkamm auf und tötete ihn mit einem einzigen gezielten Pfeilschuss in den Rücken. Vermutlich war der Angreifer ein erfahrener Bogenschütze und hatte nicht nur Glück, daher handelte es sich wahrscheinlich um einen Mann etwa in Ötzis Alter. Und ich glaube, dass der Mörder Ötzi gut kannte. Warum? Er muss gesehen haben, wie Ötzi zu Boden ging, denn ein so gut platzierter Schuss kann kaum aus mehr als fünfzehn Metern Entfernung erfolgt sein. Vielleicht stand der Mörder danach über Ötzi und wartete, bis jener seinen letzten Atemzug nahm. Und dennoch nahm er Ötzis Habseligkeiten nicht an sich, vor allem das wertvolle Beil aus Kupfer. Warum hätte jemand ein solches Beutestück zurücklassen sollen? Ich vermute, er hätte das Beil nicht benutzen können, weil er ebenfalls aus Ötzis Dorf stammte; dass sie sich kannten und er aus irgendeinem Grund wütend auf Ötzi war. Wenn er das Beil mit nach Hause gebracht hätte, so hätte es bestimmt jemand wiedererkannt und unangenehme Fragen gestellt.
Hätten wir eine Zeitmaschine, um in die Jungsteinzeit zurückzureisen, könnten wir mit ziemlicher Sicherheit Ötzis Mörder überführen.
Detaillierte forensische Informationen wie diese – das ist es, was die Öffentlichkeit an der Archäologie interessiert. Und warum auch nicht? Man liest so etwas gerne, weil die Details einem das Gefühl geben, »dabei zu sein«. Es verbindet uns mit der Vergangenheit auf einer ganz persönlichen Ebene. Es fällt uns leichter, Informationen nachzuvollziehen, wenn sie in Form von Begrifflichkeiten daherkommen, die wir sofort verstehen. Kaum jemand liest Artikel in soziologischen Fachzeitschriften mit Statistiken über Untreue in der Ehe, doch die diesbezüglichen Fehltritte von Prominenten schaffen es immer wieder auf die Titelseiten der Regenbogenpresse.
Und die Archäologie wird immer besser darin, diese Neugier zu befriedigen. Ständig kommen technische Neuerungen auf den Markt, die die Grenzen dessen ausloten, was wir aus einer unscheinbaren Keramikscherbe, einem Steinabschlag, einem Knochenfragment herauslesen können. Sie haben sicherlich schon von der Radiokarbon-Methode gehört (mit der man organisches Material datieren kann, wenn es nicht älter als 45.000 Jahre ist), aber es gibt noch weitere Datierungstechniken, die Sie sicherlich nicht kennen, zum Beispiel die optisch stimulierte Lumineszenz, die ermitteln kann, wann Quarzkörner zum letzten Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, und die Elektronenspinresonanz, die Zähne anhand von Änderungen der Molekülstruktur datiert, die von der Hintergrundstrahlung im umgebenden Sediment verursacht wurden.
Die Analyse von Kohlenstoff-, Stickstoff- und Strontiumisotopen in menschlichen Knochen und Zähnen verrät uns, was Menschen gegessen haben, wo sie geboren wurden, wo sie aufgewachsen sind und ob sie später den Standort gewechselt haben. Wir können Lipide aus Keramikgefäßen entnehmen, die uns verraten, welche Lebensmittel in einem Topf einst gekocht oder gelagert wurden. Aus Steinwerkzeugen können wir Proteinrückstände extrahieren und ermitteln, welche Tiere damit getötet oder geschlachtet wurden. Wir können anhand von Tierknochen die Spezies identifizieren (das ist sogar relativ einfach), und wir können feststellen, ob diese Tiere von Menschen geschlachtet, von Hunden und Wölfen gerissen, von Nagetieren angenagt wurden. Wir können herausfinden, ob ein Koprolit (getrockneter menschlicher Kot) von einem Mann oder einer Frau hinterlassen wurde und was diese Person gegessen hat. Wir können feststellen, ob die Handabdrücke, die weltweit die Wände von Höhlen zieren, von Männern oder Frauen stammen (das hat mit der Handgröße und der relativen Fingergröße zu tun). Wir können zurückverfolgen, woher das Gestein eines Steinwerkzeugs oder der Ton eins Stücks Keramik stammt. Diese Daten helfen uns, die Reiserouten von Nomaden und Handelswege nachzuzeichnen. Wir können sogar aus alten Skelettresten genetisches Material extrahieren. Wir sind zu einigem in der Lage.
Ehrlicherweise muss ich jedoch zugeben, dass viele dieser Techniken nur in ganz bestimmten Fällen anwendbar sind, und alle haben ihre Grenzen. Ich habe Ötzi so ausführlich beschrieben, um Sie in ein altes Archäologengeheimnis einzuweihen: Wir können solche detaillierten Informationen nicht systematisch gewinnen. Nicht überall ist DNA oder überhaupt organisches Material erhalten, und es gibt immer potenzielle Kontaminationsquellen. Viele Fundstellen waren keine Siedlungen, sondern Orte, wie zum Beispiel Flussdeltas, an denen Mutter Natur Artefakte und Knochen angespült hat, die anderswo durch Bodenerosion in den Fluss gelangt sind. Auch wenn die Technik immer besser wird und wir aus immer bescheideneren archäologischen Objekten immer mehr Informationen extrahieren können, wird die Archäologie doch niemals in der Lage sein, ein so detailliertes Bild der Vergangenheit zu zeichnen, wie wir es gerne hätten.
Doch wie mein erster Mentor, David Hurst Thomas, sagte: Es geht nicht darum, was man findet, es geht darum, was man herausfindet. Ötzi und seine Ausrüstung – das haben wir gefunden, doch was wir herausfinden wollen, steht auf einem anderen Blatt. Wenn wir Ötzi untersuchen, erfahren wir eine Menge über das Leben eines Mannes, aber wie viel verrät es uns ganz allgemein über das Leben der Menschen im Neolithikum in Mittel- und Südeuropa? Wenn wir uns die Vergangenheit als Familienfoto vorstellen, steht Ötzi deutlich sichtbar im Vordergrund, aber der Rest ist verschwommen und verpixelt. Über die längerfristigen, großflächigen Prozesse des technologischen, sozialen, politischen und kulturellen Lebens in der Jungsteinzeit erzählt Ötzi uns nur wenig. Dabei kann die Archäologie gerade solche Prozesse oftmals sichtbar machen, und zwar ziemlich deutlich.
Um diese großflächigen Prozesse zu untersuchen, müssen wir Daten analysieren, die uns leider keine persönliche Verbindung zur Vergangenheit ermöglichen oder uns das Gefühl geben, »dabei zu sein«. Aber das ist in Ordnung, und ein britischer Archäologe mit dem wunderbaren Namen Osbert Guy Stanhope Crawford (1886–1957) verrät uns, warum.
Crawford kam in Indien zur Welt, seine Eltern starben, als er acht Jahre alt war. Später studierte er Geografie und Kartografie, doch sein eigentliches Interesse galt der Vor- und Frühgeschichte. 1911 nahm er an einer Ausgrabung im Sudan teil, doch dann kam der Erste Weltkrieg, und seine Karriere lag zunächst auf Eis.2
Während des Krieges war Crawford als Beobachter beim Royal Flying Corps tätig. Er fotografierte und analysierte Fotos, bis er 1918 abgeschossen wurde; den Rest des Krieges verbrachte er in einem deutschen Kriegsgefangenenlager. Nach dem Krieg nahm er eine Stelle im britischen Ordnance Survey an und suchte anhand von Luftaufnahmen nach Blindgängern. Als er von der Seite eines Doppeldeckers aus bei tief stehender Sonne eine Reihe Fotos schoss, entdeckte Crawford am Boden seltsame Schattenmuster. Er fand heraus, dass es sich um Mauern und Gräben handelte, die im Erdboden verborgen waren und trotz ihrer Größe so gut versteckt, dass man sie am Boden gar nicht bemerkte. (Crawford demonstrierte diesen Effekt, indem er einen Teppich einmal von oben und einmal aus der Perspektive seiner Katze fotografierte – das eine Mal sah man deutlich das Muster, das andere Mal nicht.) Sein neuer Ansatz half Archäologen, in der englischen Landschaft zahlreiche archäologische Spuren zu entdecken.
Crawford wollte ein Forum für Archäologen schaffen, das ihnen ermöglichte, die Ergebnisse ihrer Arbeit mit anderen zu teilen, und gründete 1927 die Fachzeitschrift Antiquity, die heute noch eines der wichtigsten Organe der Archäologie ist. In der ersten Ausgabe erklärte er, worum es in der Zeitschrift ging: »Unser Forschungsfeld ist die Erde, unser Zeithorizont beträgt etwa eine Million Jahre, unser Thema ist die menschliche Rasse.« Diese Aussage beschreibt die zwei großen Stärken der Archäologie: Zeit und Raum.
Keine andere Wissenschaft beschäftigt sich mit dem Menschen im gleichen Maßstab wie die Archäologie. Wir »beobachten« das Verhalten unserer Artgenossen, wie es sich über extrem ausgedehnte geografische Gebiete und über extrem lange Zeiträume hinweg manifestiert. Die Archäologie erforscht die gesamte Menschheit – von der Zeit, bevor wir Menschen waren, bis heute, und vom Äquator bis zum Nord- und Südpol. Sicherlich bleiben uns manche Details verborgen, die in die Domäne von Kulturanthropologen oder Historikern fallen, und Individuen, die früher einmal lebten, wie Ötzi, betrachten wir nur selten. Wir können nicht systematisch Religionen, Kosmologie, Verwandtschaftsbeziehungen oder noch abstraktere Aspekte der menschlichen Kultur rekonstruieren, die sich in den Überresten, die wir ausgraben, oft nur indirekt manifestieren. Ich weiß nicht, wie oft jemand Fachfremdes eine meiner Ausgrabungen besucht und mich gefragt hat: »Wie sah denn die Religion dieser Leute aus?« Leider muss ich die Besucher dann regelmäßig enttäuschen. Aber da wir uns mit so gewaltigen (Zeit-)Räumen befassen, gleichen wir jeden Mangel an Details dadurch aus, dass wir den Überblick über das große Ganze haben. Ich sage meinen Studentinnen und Studenten immer gerne: Andere Leute sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht – wir sehen vielleicht nicht die einzelnen Bäume, aber den Wald dafür umso deutlicher.
Wir Archäologen interessieren uns dafür, was Menschen in längst vergangenen Zeiten taten und dachten, aber ihre Taten und Gedanken können wir nur mithilfe dessen rekonstruieren, was sie hinterlassen haben: zerbrochene Knochen, verbrannte Samen, Keramikscherben oder, wenn wir großes Glück haben, ein eingestürzter Tempel. Wir rekonstruieren Geschichte anhand von Dingen, besser gesagt: anhand bestimmter Muster, die sich dadurch ergeben, dass diese Dinge in Zeit und Raum immer wieder auftauchen.
Wer Vor- und Frühgeschichte studiert, lernt gleich im ersten Semester die Bedeutung von Begriffen wie »Epoche«, »Phase« und »Kultur« kennen, die sich auf bestimmte Einheiten in Zeit und Raum beziehen. Im US-amerikanischen Südwesten spricht man zum Beispiel von der »Basketmaker-Kultur« oder von der »Pueblo-Kultur«. Diese Begriffe beziehen sich auf Zeiträume; die Basketmaker-Kultur bestand beispielsweise von ca. 200 v. Chr. bis 700 n. Chr., Pueblo I von 700 bis 900 und Pueblo II von 900 bis 1100. Solche Begrifflichkeiten beziehen sich aber nicht nur auf die Zeit, sondern auch auf den geografischen Raum; in diesem Fall werden sie ausschließlich für den Südwesten der USA verwendet.
Phasen definiert man anhand der räumlichen und zeitlichen Verteilung bestimmter Gegenstände, zum Beispiel der Formen von Pfeilspitzen, der Bauweise von Behausungen oder der Dekoration von Keramik. Die Basketmaker-Kultur war eine Phase im US-amerikanischen Südwesten, als die Menschen in halbunterirdischen Steinhäusern lebten und ganz ausgezeichnete Körbe (daher der Name der Epoche) und auch Töpferwaren herstellten; außerdem hat man aus jener Zeit moderate Mengen von Überresten von Mais gefunden, zum Beispiel verbrannte Maiskolben. In der Epoche Pueblo I tauchen erstmals der bekannte quadratische, oberirdische Pueblo und die Kivas auf (runde, halbunterirdische Zeremonienräume), Keramik mit schwarzen geometrischen Motiven auf weißem Hintergrund und rot bemalte Keramik. Rückstände von Mais sind in zahlreichen Pueblo-I-Stätten vorhanden und signalisieren die gewachsene Bedeutung von Mais in der Ernährung der nordamerikanischen Ureinwohner. In der Epoche Pueblo II werden die Pueblos größer, und es finden sich einige besonders große Kivas. Es gibt einige Beispiele grauer Keramik und jede Menge schwarz-weiße Keramik. Das ist natürlich längst nicht alles, aber diese Veränderungen in den materiellen Hinterlassenschaften sind der Grund, warum die Archäologie die Kultur des Südwestens Nordamerikas so einteilt, wie sie es tut.
Der springende Punkt ist: Wir Archäologen benennen solche Veränderungen in Form von Epochen oder Phasen, weil wir davon ausgehen, dass Veränderungen in den materiellen Hinterlassenschaften Veränderungen in der Organisation des menschlichen Miteinanders signalisieren. In einem Buch über die Geschichte Nordamerikas könnte sich zum Beispiel ein Kapitel mit dem Titel Basketmaker-Kultur finden, das beschreibt, wie die Menschen damals lebten und wie ihre gesellschaftliche und politische Organisation aussah – all das auf Basis der Interpretation archäologischer Funde. Im nächsten Kapitel würden dann vielleicht die materiellen Hinterlassenschaften von Pueblo I interpretiert, um zu zeigen, wie sich das Leben der Menschen gegenüber der Basketmaker-Kultur veränderte. Es ist nicht immer einfach, aber die Archäologie möchte solchen materiellen Hinterlassenschaften Leben einhauchen, um so von den statischen Überresten der Vergangenheit auf das dynamische Verhalten der Menschen zu schließen, die diese Dinge hergestellt und benutzt haben.
Dennoch bin ich sicher, dass jene, die in einer bestimmten archäologischen Phase lebten, enttäuscht wären, wenn sie »ihr« Kapitel zu Gesicht bekämen. »Da steht ja gar nichts über den furchtbaren Winter, als Schnelle Krähe und all ihre Kinder starben«, würden sie vielleicht sagen. »Und was ist mit Rote Hand, diesem großartigen Sänger und Jäger? Der wird ja nicht einmal erwähnt.«
Um dieses Manko auf andere Art und Weise zu verdeutlichen: Stellen Sie sich vor, Sie müssten einen Aufsatz darüber schreiben, was im 20. Jahrhundert alles geschah, und hätten nur eine DIN-A4-Seite Platz. Was würden Sie erwähnen? Vor allem aber: Was würden Sie weglassen? Den Ersten Weltkrieg? Den Zweiten Weltkrieg? Den Koreakrieg? Den Vietnamkrieg? Den Völkerbund? Die Vereinten Nationen? Die Spanische Grippe? Die Weltwirtschaftskrise? Den Impfstoff gegen Polio? Die Mondlandung? Die Polarexpeditionen? Computer? Den Kommunismus? Das Internet? Einstein? Marie Curie? Spielberg? AIDS? Die Doppelhelix? Das Frauenwahlrecht? Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung? Gandhi? Die Ermordung Kennedys? Die SPIEGEL-Affäre? Das Fernsehen? Satelliten? Die Ölkrise von 1973? Martin Luther King? Bob Dylan? Elvis? Willy Brandt? Den NATO-Doppelbeschluss? Madonna? Handys? Mikrochips? Die Aufgabe scheint kaum lösbar, doch wir Archäologen tun im Grunde nichts anderes – wir wühlen uns durch Berge von Details, um das Muster zu finden, den Wald.
Wie soll man eine solche Aufgabe angehen? Sie ahnen es vielleicht bereits: Erweitern Sie Ihr Blickfeld! Nordamerika-Archäologen entdecken Muster in Zeit und Raum nicht, indem sie sich auf einen einzigen Standort konzentrieren, sondern indem sie viele verschiedene Standorte aus unterschiedlichen Epochen untersuchen, die sich auf mehrere Tausend Quadratkilometer verteilen. Erst dann können sie die Unterschiede zwischen Basketmaker- und Pueblo-I-Stätten aufzeigen. Um Ihren Aufsatz über das 20. Jahrhundert zu schreiben, sollten Sie sich also zunächst mit dem 18. und 19. Jahrhundert auseinandersetzen (es würde helfen, wenn Sie auch noch wüssten, was im 21. und 22. Jahrhundert alles geschehen wird). Dadurch hätten Sie einen besseren Überblick darüber, wie sich das 20. Jahrhundert von den Phasen davor und danach unterschied.
Archäologen können sich nur mit den materiellen Zeugnissen der Vergangenheit beschäftigen. Wenn wir in Raum und Zeit nach Mustern suchen, dann suchen wir nach Mustern in der Verteilung materieller Zeugnisse. Dabei haben Archäologen eigentlich gar kein so großes Interesse an materiellen Dingen (sie sind bloß das, was wir finden). Vielmehr wollen wir wissen, was uns diese Dinge über die Organisation menschlicher Gesellschaften der Vergangenheit verraten (das ist es, was wir herausfinden möchten).
Stellen Sie sich vor, ein Archäologe aus der Zukunft würde in Mülldeponien aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert wühlen: Was würde seine Aufmerksamkeit erregen? Neben der Tatsache, dass sich die schieren Mengen an Material unterscheiden würden, gäbe es im Müll des 20. Jahrhunderts einige Dinge, die ihm besonders ins Auge fallen würden: Autos, elektronische Geräte und vor allem tonnenweise Papier (der Archäologe Bill Rathje, der sich viel mit Müll beschäftigte, fand heraus, dass recycelbares Papier auf modernen Deponien den meisten Platz einnimmt).3 Ein Archäologe würde aufgrund der großen Unterschiede in dem, was er vorfände, auf zwei Phasen schließen: Eine würde das 20. Jahrhundert umfassen, die andere das 18. und 19. Jahrhundert.
Doch das ist natürlich nur der Anfang, denn der Archäologe möchte vor allem wissen, um was es sich bei den Autos, der Elektronik und dem Papier handelt: Wie wurden sie hergestellt und wozu dienten sie? Wer hat sie verwendet – Männer, Frauen, Kinder? Wurden sie vor Ort produziert oder importiert? Signalisierten sie ein bestimmtes Prestige oder waren es reine Alltagsgegenstände? Um diese Fragen zu beantworten, würde er aus dem großen Fundus archäologischer Techniken und Methoden schöpfen.
Nun wissen Sie ein wenig mehr darüber, wie Archäologen ticken. Wir suchen in verstreuten materiellen Überresten nach räumlichen und zeitlichen Mustern, und anhand dieser Überreste versuchen wir zu rekonstruieren, wie die Menschen damals lebten. Und wir gehen davon aus, dass das Auftauchen neuartiger Gegenstände – seien es Steinwerkzeuge, Töpferwaren, Wohnhäuser, religiöse Bauten, Autos, Elektronik oder Druckerzeugnisse – darauf hindeuten, dass sich im Leben der Menschen etwas veränderte.
In den folgenden Kapiteln werde ich die große Stärke der Archäologie, ihre Fähigkeit, Muster in Raum und Zeit zu erkennen, bis zum Äußersten ausreizen und den gesamten Verlauf der Menschheitsgeschichte nach globalen Mustern abklopfen. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen in der Stratosphäre Platz wie in der hintersten Reihe eines Kinos und schauen sich einen Film an, der die gesamte Menschheitsgeschichte zeigt, alle sechs Millionen Jahre. Lassen Sie die Geschichte der Menschheit auf sich wirken, während Sie Ihr Popcorn futtern (Sie brauchen wahrscheinlich den Jumbo-Becher), und fragen Sie sich: Können Sie irgendwelche globalen Veränderungen in der materiellen Kultur ausmachen? Können Sie Phasen erkennen, die die ganze Welt umfassen, die bedeutende Übergänge in der menschlichen Evolution kennzeichnen, Zeitpunkte, an denen sich der grundlegende Charakter des menschlichen Lebens auf Erden verändert hat?
Könnten wir die Geschichte der Menschheit von einer solchen Warte aus betrachten, so würden uns meiner Meinung nach vier wichtige Wendepunkte auffallen, an denen es zu gewaltigen Veränderungen in den materiellen Zeugnissen kam, die auf bedeutende Verschiebungen in der Organisation menschlichen Lebens schließen lassen. In den Kapiteln 3 bis 6 werden wir feststellen, was die Archäologie über diese Verschiebungen alles weiß. Wir kennen noch immer nicht alle Details, aber immerhin sind wir bereits schlauer als vor hundert Jahren – damals wusste man so gut wie nichts darüber. Und ich werde beweisen, dass heute alles anders ist als früher, auch wenn der unhöfliche Student aus Kapitel 1 es nicht wahrhaben will. Am Schluss, in Kapitel 7, werden wir dann sehen, inwiefern der Ansatz aus Kapitel 3 bis 6 darauf schließen lässt, dass auch in Zukunft beileibe nicht alles so bleiben wird, wie es heute ist.