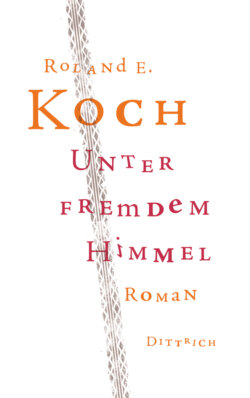Читать книгу Unter fremdem Himmel - Roland E. Koch - Страница 6
2
ОглавлениеWährend ich ging und auf das Schlurfen meiner zu großen Schuhe achtete, fuhr ein Fahrrad vorbei, ein ziemlich altes Damenfahrrad, mit doppelten, geschwungenen Rohren, es erschien mir vertraut, ich kannte mal jemanden, der so eins fuhr, oder hatte ein ähnliches einmal repariert, das kann ich, Fahrräder reparieren.
Ich achtete zuerst auf das Fahrrad, nicht auf die Frau, die darauf saß und beinahe umkippte, so voll beladen war es. Sie hatte schwer zu treten und schwankte immer weiter, als sie mich überholt hatte. Sie trug einen gelben Anorak und sah nass aus, obwohl es nicht regnete. Im Gegenteil, die Sonne schien und wärmte, es würde wieder ein klarer, trockener Tag werden, aber nachts nahe am Frost. Die blonden Haare der Frau fielen mir auf, sie trug schwere Wanderschuhe und eine weite Hose. Ich ging einfach weiter, aber jetzt war es, als folgte ich ihr, denn sie fuhr immer langsamer.
Schließlich blieb sie stehen und drehte sich zu mir um, aber so, als habe sie etwas verloren. Ich schüttelte den Kopf, sie lachte und blieb stehen, bis ich näher gekommen war. Sie untersuchte ihr Fahrrad, und ich sah, dass sie einen Platten am Hinterreifen hatte.
Wie ist das denn passiert, schimpfte sie und sah mich an, als hätte ich damit etwas zu tun.
Haben Sie eine Luftpumpe?, fragte ich. Vielleicht können wir den Schlauch flicken.
Meine Stimme klang heiser, weil ich bis auf die paar Sätze am Morgen kaum gesprochen hatte. Bestimmt hörte man auch den Akzent.
Nichts dabei, sagte sie, aber es ist nicht mehr weit.
Ich bückte mich und sah mir den Reifen an.
Ich habe Flickzeug zu Hause, sagte sie.
Wenn Sie wollen, kann ich das machen, sagte ich.
Ich sah in die Tüten an ihrem Lenker und im Fahrradkorb und musste lächeln. Dieselben Sachen, die ich auch abgeholt hatte, lauter aussortierte, abgelaufene Lebensmittel. Und hatte sie nicht auch ein bisschen anders Deutsch gesprochen, mit einer harten Aussprache, die mir vertraut schien?
Wohin wollen Sie denn?, fragte sie. Hier kommt doch nichts mehr, nur das Moor.
Ich lauschte ihrer Stimme und ihrer Aussprache. Sie war gut angezogen, vielleicht sogar aus der Kleiderkammer, aber sie sprach ein fremdes Deutsch. Sie stammte nicht von dort, das war klar.
Ich habe auch Vorräte geholt, sagte ich, aber ich weiß noch nicht, wohin.
Das Geräusch hatte ich schon länger wahrgenommen, aber dann bemerkte ich, dass ein Traktor näher kam. Ich hob meine Tüten auf, die ich mitten auf dem Weg abgestellt hatte. Die Frau machte keinerlei Anstalten, ihr Fahrrad zur Seite zu schieben, und der Fahrer hupte. Sie blieb trotzdem stehen, sodass der Traktor in den Graben ausweichen musste. Sie schien ihn nicht einmal zu sehen, es war, als habe sie etwas viel Wichtigeres zu tun, dabei starrte sie nur auf das Feld.
Halt mal, sagte sie, als der Traktor vorbei war, und reichte mir das Fahrrad.
Wieder stellte ich zuerst meine Tüten ab, diesmal auf der Seite.
Die Frau ging einen Schritt auf den Acker zu, trat in das frisch sprießende Getreide, klopfte sich vor die Brust und sprang dann einmal kurz in die Luft.
Du kannst erst mal mitkommen, sagte sie, mich schon wieder duzend, obwohl ich offensichtlich der Ältere war.
Die Frau kümmerte sich nicht mehr um das Fahrrad, überließ es mir, und ich hängte auch noch meine Tüten an die Lenkstange. Sie ging, ohne etwas zu tragen, voraus, und ich stemmte mich gegen den Lenker, um das beladene Fahrrad mit dem platten Reifen weiterzusteuern.
Sie spinnt, dachte ich, aber ich wollte sie auf jeden Fall begleiten, weil ich mir davon eine Unterkunft versprach, einen geheizten Raum, eine Waschmöglichkeit, denn sie sah sauber aus; aber das war nicht mehr die Hauptsache, im Grunde hätte ich sie nach diesem Luftsprung überallhin begleitet, nur um ihr zu folgen, um sie kennenzulernen, in ihrer Nähe zu sein.
Sie lief voraus, und ich kam kaum hinterher, wir hatten offenbar einen längeren Weg zurückzulegen. Ich weiß noch, ich musste an ein Musikstück denken, das ich vor langer Zeit einmal in einem Konzert gehört hatte, eine mächtige, anschwellende, weit ausholende, sehnsüchtige Melodie, von einem großen Symphonieorchester gespielt, in die sich dann eine hohe, starke Frauenstimme eingemischt hatte. Das Lied handelte vom Frühling, und ich hatte nur die ersten Worte verstanden: »In dämmrigen Grüften träumte ich lang«, genau das empfand ich im Moment, als sei ich endlich aus einem Grab heraus ans Frühlingslicht geholt worden, aus einem langen, düsteren Traum. Ich versuchte, die Melodie zu summen und die erste Zeile leise zu singen, aber es gelang mir nicht richtig.
Von Weitem sah ich ein Gebäude, das wie ein großer Bienenkorb aussah, rund und aufrecht, und die Frau ging darauf zu. Der Weg war schlammig, und ich kam immer schlechter voran, aber die Frau schien zu hüpfen und zu springen, auch sie sang etwas vor sich hin. Mein Feldhaus konnte ich schon nicht mehr erkennen, und ich bezweifelte, ob ich es überhaupt wiederfinden würde.
Wir gingen auf den Hof mit dem großen runden Gebäude zu. Es war eigentlich nur ein einziges Haus, denn mehrere Teile schienen an das große angebaut. Überall war es nass und schmutzig, der ganze Hof voller Pfützen und Schlamm. Ich lehnte das Fahrrad an die Hauswand, nahm so viel Tüten wie ich tragen konnte, und sah mich um, die Frau verschwand im Haus. Nirgendwo stand ein Auto oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Alles war dunkel. Nur aus dem Schornstein kam dunkler Qualm, als verbrenne jemand alte Zeitungen.
Ich wusste schon nicht mehr, welche Tüten mir und welche ihr gehörten, aber ich dachte sofort, das ist egal, ab jetzt gehört uns alles zusammen. Ich spürte Hunger, folgte der Frau in das Gebäude und stellte meine verdreckten Schuhe vor der Tür ab.
Es gab eine große Diele, von der mehrere Türen abgingen, und ich suchte die Küche. Ich öffnete eine Tür und war überrascht, einen Jungen von vielleicht sieben oder acht Jahren zu sehen, mit schwarzen Haaren, einer Brille und unbeweglichem Blick, der ganz allein zu sein schien.
Wo ist denn deine Mutter?, fragte ich, aber er antwortete nicht.
In der Küche fröstelte ich und stellte meine Tüten auf den Tisch. Auch wusste ich plötzlich nicht mehr, wo ich mich befand. Es war mir, als müsse ich mich umsehen, und ich erkannte ein schmales schwarzes Haus auf einer Hügelkuppe, ein Haus mit vielen niedrigen Stockwerken, dilettantisch aufeinandergebaut, mit kleinen Fenstern und einem unsymmetrischen Dach, mit Holz verkleidet, ich sah es wie zum ersten Mal, und doch wusste ich genau, wo es stand, in der Nähe meines Geburtshauses, der Kirche und der Schule, dort, wo ich immer zu einer Kindergruppe gegangen war; aber ich wusste, dass ich es früher nie in Ruhe angesehen hatte und es jetzt erst bemerkte, Jahrzehnte später; und doch baute es sich in meinem Kopf vollständig zusammen, als stünde ich davor und röche den leicht rußigen Geruch von früher, spürte die Angst, meine Mutter zu verlieren, die ich damals hatte, und das Gefühl, ganz allein und ohne fremde Hilfe überleben zu müssen.
Der Junge hatte noch nicht reagiert, er trank aus einer kleinen Glasflasche ohne Etikett und tat so, als sehe er mich nicht.
Kann ich auch was zu trinken haben?, fragte ich.
Ich öffnete die Tür und horchte in den Flur, um herauszukriegen, wo die Frau hingegangen sein konnte. Es war nichts zu hören.
Ich nahm mir von der Spüle ein fleckiges Glas, wusch es aus und trank das kühle, saubere Leitungswasser, das nach Kalk und Metall schmeckte. Dann ging ich die restlichen Tüten holen. Als ich zurückkam, hatte der Junge begonnen, die Vorräte auszupacken. Ich lächelte ihn an, aber er beachtete mich wieder nicht. Ich nahm ein paar Scheiben Toastbrot, untersuchte sie auf Schimmel und legte sie dann auf die Platte des Küchenherds, die noch warm war. Einen Toaster schien es nicht zu geben. Als die Scheiben geröstet waren, bot ich dem Jungen eine an, und er begann zu essen, wie ein Vogel, immer darauf bedacht zu fliehen, sobald jemand in seinen Schutzbereich kommen sollte.
Ich packte die restlichen Sachen aus, ordnete sie auf dem Tisch, tat einiges zur Seite, das mir verdorben erschien, und suchte einen Kühlschrank, auch den fand ich nicht. Als ich den Lichtschalter ausprobierte, stellte ich fest, dass es keinen Strom gab. Warm war es auch nicht, aber viel angenehmer als in meinem Steinhaus. Ich hatte den Wunsch, mich zu waschen und zu schlafen, nur wollte ich den Jungen nicht allein lassen. Am Ende der Küche gab es eine Nische mit einem alten roten Sofa, ich zog meine Jacke aus und legte mich mit angewinkelten Beinen hin, ausstrecken konnte ich mich nicht.
Ich schlafe vielleicht ein, sagte ich, das kann lange dauern, lass mich einfach in Ruhe.
Diesmal nickte der Junge ernsthaft, als habe er nicht nur das verstanden, was ich gesagt hatte, sondern noch viel mehr, meine Situation, meine Gedanken, meine Befürchtungen.
Ich wusste nicht, wie lange ich geschlafen hatte, es war noch hell, aber es schien bereits zu dämmern. Als ich wach wurde, sah ich zuerst das Gesicht des Jungen, der vor mir stand und mich beobachtete, seinen Blick, der eher Hilfe suchend als neugierig schien, aber irgendetwas stimmte nicht mit diesem Blick, das hatte ich schon am Morgen gemerkt. Es war, als sehe er nur wenig oder fast nichts von der Außenwelt, als forsche er nach innen und könne sich nicht aus einem Gefängnis befreien.
Ich stand auf, mein Mund war ausgetrocknet, ich fühlte mich wie von einer schmutzigen, wächsernen Schicht überzogen, der Rücken schmerzte, und mir war kalt. Ich erschrak, als ich bemerkte, wie ängstlich der Junge zurückwich, als ich ihm über sein schönes schwarzes Haar streichen wollte. Am Morgen hatte er keine Angst gehabt. Vielleicht wollte er nur nicht berührt werden?
Wie heißt du denn?, fragte ich.
Wieder antwortete er nicht.
Ich heiße Simon, sagte ich.
Das ist nicht mein richtiger Name, aber ich nenne mich so, weil er überall verstanden wird, wenn man ihn passend ausspricht oder schreibt. Er gefällt mir besser als mein alter Name, den ich schon fast vergessen habe. Der neue hat etwas von einem Seher oder Propheten.
Ich suchte die Malsachen des Jungen, die auf dem Tisch lagen, nahm einen Stift und schrieb ihm meinen Namen auf. Aber wieder reagierte er nicht, als ich ihm die Buchstaben zeigte. Er hatte dünne, feine Striche gemalt, nebeneinander, unsicher und zaghaft, wie Muster auf Versteinerungen.
Ich schaute aus dem Fenster. Man konnte weit über die Felder sehen, es gefiel mir, man war einsam und nicht eingezwängt, hatte das Gefühl, dass einem das Land gehörte, soweit man blicken konnte; ich hörte die Vögel in der beginnenden Dämmerung singen, wie ich es so liebte. Ich blieb eine ganze Weile ruhig stehen.
Ich vermisste die anderen, mit denen ich hierhergekommen war. Was war aus ihnen geworden? Wir waren zwölf Personen gewesen, Insassen eines Kleintransporters, Ausgespuckte, Verlorene, ohne Herkunft, ohne Papiere, ohne Geld, wir hatten uns nur mühselig verständigen können, kaum jemand konnte Deutsch, manche sprachen etwas Englisch, aber wir hatten schon nach ein, zwei Tagen zusammengehört. Wir hatten zusammen kampiert, gegessen, Wache gehalten, wir waren durchgekommen, und unser Fahrer hatte uns hier rausgelassen, weil es menschenleer schien. Ich musste besonders an Kari denken, ein vierzehnjähriges Mädchen. Ich hatte versprochen, ihr zu helfen, sie hatte keine Eltern mehr, und ihr Bruder war unterwegs ausgestiegen.
Als ich eine kräftige kleine Hand auf meiner spürte, schrak ich auf, der Junge hatte sich neben mich gestellt und schien mit mir nach draußen zu starren, meine Gedanken zu teilen. Ich spürte die Wärme und Entschlossenheit seiner Hand, drückte sie und nahm ihre Energie auf.
Dann merkte ich, dass es dunkel wurde. Ich fand weder eine Kerze noch eine Taschenlampe und wollte mich überall umsehen. Der Junge stieß einen Schrei aus, als ich ihn losließ, einen Klagelaut oder Schmerzenston, wie ein kleines Tier, und ich sah ihn überrascht an. Er ging wieder zum Tisch und hockte sich auf einen Stuhl, ohne mich weiter zu beachten. Er musste etwas essen und ins Bett, aber wer kümmerte sich um ihn?
Ich sah mich in der Diele um, auch da war nichts Brennbares zu entdecken. In einem Raum fand ich Lebensmittel, es schien noch kühler zu sein, deswegen brachte ich alle Vorräte hierher. Nebenan war eine Art Büro, in dem ein Fernseher und ein Telefon standen, beide funktionierten nicht. Daneben lag ein großes Badezimmer, ich schloss mich ein, benutzte die Toilette und drehte das Wasser in der Dusche auf. Es wurde nicht warm, aber ich zog mich aus und sprang unter den kalten Strahl, ich hatte zwei Wochen nicht mehr geduscht und nahm mir von dem Shampoo, das dort stand, bis ich mich sauber fühlte. Ich hätte gern noch länger unter dem Wasser gestanden, aber ich zitterte und hatte das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Ich fand ein Handtuch, trocknete mich ab und zog mich wieder an. Meine Unterwäsche weichte ich mit Seife im Waschbecken ein, ich wollte sie später aufhängen.
Plötzlich sah ich mich selbst, vor dem Spiegel, ein blasses, unrasiertes Gesicht. Ich sah mich monatelang, jahrelang in diesem Haus umhergehen, schleichen, leise auftretend, sah das Haus meine Heimat werdend, so vertraut, dass ich im Dunkeln alles fand, dass ich seinen Atem kannte, seine Geräusche, seine Seele. So vertraut, dass ich eines Tages die immergleichen Wege an den immergleichen Wänden entlang nicht mehr aushalten und wieder meine Wanderung aufnehmen würde, wieder ein Verlorener und Verlassender sein wollte. Ich zog die restlichen Sachen an, drehte mir ein Handtuch um den Kopf und ging zurück in die Küche.
Ich spürte schon im Flur, dass sich etwas verändert hatte. Eine Kerze brannte, und die Frau war zurückgekommen. Der Junge kniete vor ihr und hielt seinen Kopf in ihrem Schoß versteckt, dabei wimmerte er leise und zuckte, während die Frau etwas summte. Die beiden waren so versunken, dass sie mich nicht bemerkten. Ich ging zu ihnen und murmelte einen Gruß.
Du bist ja noch da, sagte die Frau.
Ist das deiner?, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf.
Ich bin froh, dass du dich um ihn kümmerst, sagte ich. Ich wusste nicht, was er braucht.
Du kannst uns etwas zu essen holen, sagte sie.
Der Junge drehte sich nicht um.
Ich heiße Simon, sagte ich.
Valentina, sagte sie leise.
Was ist mit ihm?
Hol uns was zu essen, flüsterte sie.
Ich nahm die Kerze vom Tisch und leuchtete vorsichtig in den Vorratsraum, fischte aus den Tüten, was mir für ein Abendessen passend erschien, und trug es in die Küche. Die beiden wippten und schaukelten immer noch vor sich hin.
Du musst ins Bett, sagte Valentina.
Der Junge rollte sich auf den Boden, wie ein Embryo, unempfänglich gegen Sprache, gegen Veränderung, gegen Forderungen. Valentina packte ihn an Beinen und Armen und trug ihn hinaus. Ich nahm die Kerze und leuchtete den beiden in ein Zimmer, das aussah wie Valentinas Schlafzimmer. Der Kleine hatte dort ein Lager aus Matratzen und Decken, sie zog ihm ein viel zu großes Nachthemd an, nahm ihm die Brille ab, ging mit ihm ins Bad und legte ihn ins Bett. Er hatte sich nicht mehr bewegt und keinen Laut von sich gegeben, ich näherte mich, um ihn anzusehen, aber Valentina machte mir Zeichen, ihm nicht zu nahe zu kommen.
Du darfst ihn nicht anfassen, sagte sie.
Wir gingen zurück in die Küche.
Er hat einen Gehirnschaden, sagte sie, seit der Geburt oder durch eine Krankheit, ich weiß es nicht, ich weiß nicht einmal, wie alt er ist. Wir waren hier zu fünft, die Leute, mit denen er kam, sagten, seine Eltern und seine Schwester seien verschwunden.
Wir aßen, reichten uns gegenseitig die Packungen über den Tisch, es gab verschiedene Säfte, und ich mischte sie mit Wasser. Wir hatten Toastbrot, Käse, Gurken, Oliven, Frühstücksfleisch in Dosen, und ich aß nur so viel, bis ich mich beinahe satt fühlte. Ja, ich bekam alles, was ich mir gewünscht hatte, ich war gewaschen, trocken, fror nicht mehr, konnte essen, trinken und zufrieden sein. Nur rasiert hätte ich mich gern, aber auch mit einem Bart konnte ich es aushalten.
Valentina räumte den Tisch ab und brachte die Lebensmittel weg. Ich fürchtete schon, dass sie nicht wiederkommen würde, aber sie setzte sich noch mal an den Tisch.
Kann ich heute Nacht hierbleiben?, fragte ich.
Ich hatte das Gefühl, ich solle lieber zurückhaltend sein, gleichzeitig wollte ich um jeden Preis bleiben.
Es ist Platz genug, sagte sie. Du kannst dich im Büro einrichten. Es sind Matratzen und Decken da. Die Frau, der die Mühle gehört, lässt mich hier wohnen, aber ich muss alles in Ordnung halten. Sie wird irgendwann zurückkommen. Dafür werden wir nicht kontrolliert. Ich weiß nicht, wie lange ich noch bleibe.
Auf einmal wurde mir klar, wie einsam ich gewesen war, wie plötzlich sich alles verändert hatte. Ich saß in einem richtigen Haus mit einer Frau und einem Kind, als sei das ein neues Leben und ich könne einmal alles richtig machen.
Ein Jahr lang hatte ich nur gezögert. Gezögert, ob ich weggehen sollte, wohin, wie, wann am besten, ich hatte immer gehofft, dass alles besser werden würde, und ich bleiben könnte. Dabei war es schon viel zu spät gewesen, und es war nur schlimmer geworden. Ein Jahr in einer heruntergekommenen Wohnung, mit der Hoffnung, wieder arbeiten zu können, krank war ich gewesen, monatelang hatte ich mich nicht hinausgetraut, hatte mit niemandem gesprochen. Dieses Zögern war meine Schwäche, auch jetzt stand ich wieder da und sah von rechts nach links anstatt geradeaus.
Ich kann etwas helfen, sagte ich.
Das wolltest du ja schon heute Morgen, antwortete sie leise, aber nicht wie ein Vorwurf.
Ich ging noch einmal nach draußen. Es war wieder eine klare, kalte Nacht, nicht dunkel, der Mond schien, und ich sah die Sterne und ringsum die flachen Felder. Niemand hatte vorhersehen können, dass ich hier landen würde, aber ich hatte immer das Gefühl gehabt, als würde ich noch oft umziehen.
Valentina half mir, eine Matratze in das Büro zu tragen, ein Bett zu machen, ein wenig aufzuräumen, sie brachte eine Kerze, Streichhölzer und eine Uhr.
Dafür machst du morgen Frühstück, flüsterte sie, wieder sprach sie so leise, als fürchte sie, belauscht zu werden.
Warum gibt es keinen Strom?, fragte ich.
Strom und Telefon haben sie abgestellt, offiziell wohnt hier keiner, und die Mühle soll abgerissen werden. Aber vielleicht wird sie auch umgebaut. Wir haben reichlich Kohlen, und du kannst den Ofen in der Küche anheizen. Damit kochen wir auch. Ist dir kalt?
Ich wunderte mich über ihre besorgte Frage und musste lächeln.
Ja, mir ist kalt, sagte ich.
Sie lächelte auch.
Was kannst du denn noch, außer Fahrräder reparieren?
Ich verstehe viel von Autos, sagte ich. Ich kann Deutsch, und ich kann unterrichten.
Das kannst du hier vergessen, sagte sie.
Wieder grübelte ich über ihre Aussprache nach, sie kam mir so bekannt vor, meine Mutter und die Verwandten meiner Mutter hatten so gesprochen.
Wir können nicht immer so weitermachen, sagte sie. Das Essen bei der Kirche holen, ohne Papiere. Einer muss sich melden, einen Antrag stellen.
Sie ist höchstens fünfundzwanzig, dachte ich, sie ist allein, sie hat keine Kinder, sie könnte einfach einen Deutschen heiraten, einen Bauern, hier kann sie sich einen aussuchen. Ich wollte sie nicht fragen, woher sie stammte, wie alt sie war, ob sie allein gekommen war, ich wurde auf einmal wieder traurig.
Ich roch den fremden Geruch in meinen Kleidern und dachte an einen Ort, an dem ich einmal für ein Jahr gelebt hatte, im Süden, ich hatte nie wieder weggehen wollen, aber ich wurde versetzt und wehrte mich nicht. Es war immer ein Geruch von feuchter alter Kleidung, von in Kellern gelagertem Bettzeug dort gewesen, nahe am Meer, und alles, was man trug, wurde sofort von diesem Geruch durchzogen.
Ich bin müde, sagte Valentina, und wir lachten nicht mehr.
Was machst du mit dem Jungen?, fragte ich.
Ich kann ihn nicht mitnehmen, wenn ich weggehe, sagte sie. Er braucht einen Platz, wo er bleiben kann.
Ich seufzte.
In dem Büro lag ich lange wach. Ich spürte, wie jemand hier gesessen und gerechnet hatte, oder bildete ich mir das ein? Ein Müller oder Bauer, der abends seine Abrechnungen fortsetzte, zu müde, um aufzuhören, sorgenvoll wegen der sinkenden Zahlen? Es roch nach Alter und Angst, die Wände strömten das aus. Hier hatten unglückliche Menschen gewohnt. Ich dachte an den Jungen, dessen Namen ich nicht kannte. Er brauchte einen Arzt, musste untersucht und behandelt werden. Es wäre ein Verbrechen, ihn hier zurückzulassen.
Ich zuckte zusammen, als ein Auto vorbeifuhr und ich die Scheinwerfer auf mein Fenster gerichtet glaubte. Noch immer war ich auf der Flucht, noch immer konnte ich mich nicht setzen oder legen ohne Angst.