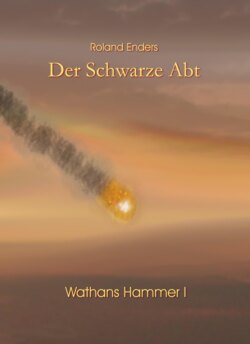Читать книгу Der Schwarze Abt - Roland Enders - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Fest der Gaukler
Оглавление
Jahr 1691 n. WH – Gegenwart.
Der alte Ben starrte verdrossen auf sein Maultier, das den schweren Karren die steile an der Klippe entlang führende Straße hinaufzog, die von der Stadt zur Hochebene führte. Er saß mürrisch auf seinem Kutschbock, würdigte den Sonnenuntergang über dem Meer keines Blickes, knallte ab und zu mit den Zügeln, um das störrische Tier anzutreiben. Er wusste, wenn es einmal stehen bliebe, könnte er es kaum dazu bewegen, das Fuhrwerk wieder anzuziehen.
Vor der Dunkelheit würde er sein Dorf nicht mehr erreichen. Hätte er doch den Wagen nicht so voll beladen! Er arbeitete als Kürschner und Gerber und verkaufte seine Waren in der Stadt, meist an Kapitäne, die Fracht für ihre Schiffe suchten. Im Hafen hatte er einen jetzt überfüllten kleinen Lagerraum gemietet, weil er heute und für die kommenden Tage mit einem sehr guten Geschäft rechnete. Am Morgen hatte er deshalb noch mehr Felle, Lederwaren und Stoffen eingeladen, bevor er in die Stadt aufbrach, in der Hoffnung, seine Waren würden ihm aus den Händen gerissen, doch statt mit einem gefüllten Geldbeutel kehrte er jetzt mit einem Karren voll unverkaufter Produkte nach Hause.
Die Hafenstadt Shoal war die größte der Provinz und deren Handelszentrum. Deshalb hatte er sich in ihrer Nähe niedergelassen. Tausende von Menschen wohnten hier. Doch nun wimmelte die Stadt von Besuchern aus den Provinzen, die die Gaukler und Artisten aus aller Welt sehen wollten. Das Gauklerfest war eine Attraktion, die nur alle fünf Jahre stattfand.
Aber die Vorfreude des Alten auf gute Geschäfte war Ernüchterung gewichen. Shoal brummte zwar wie ein Bienenstock, doch die Reisenden waren nicht gekommen, um Felle und Leder zu kaufen. Sie wollten feiern, Bier und Wein trinken und sich an den wettstreitenden Schaustellern ergötzen. Die Besitzer von Gasthäusern, Herbergen, Vergnügungsstätten und Hurenhäusern rieben sich die Hände, aber er hatte sogar weniger als sonst verkauft. Von seinen Kunden, den Handelskapitänen, Schneidern und Polsterern, hatte er nur wenige angetroffen. Die meisten schienen sich unter die Feiernden gemischt und ihre Arbeit vergessen zu haben. Und die Gaukler und fahrenden Artisten, die die ganze Aufregung verursachten, erwiesen sich als abgerissene Bettler und Habenichtse. Er durfte nicht hoffen, einem von ihnen auch nur ein Schnäuztuch zu verkaufen. Morgen könnte es noch schlimmer werden, denn wenn das Fest erst im vollen Gange war, würde niemand seinen Verkaufsstand eines Blickes würdigen. Er müsste Lärm und Gestank in der Stadt wohl umsonst aushalten.
Allmählich näherte sich der Karren dem Rand der Klippe. Oben, ins rötliche Licht der untergehenden Sonne getaucht, stand ein Mann, oder besser gesagt: ein junger Bursche, der hinunter auf die Stadt, den Hafen und das Meer blickte und Ben und sein Maultier überhaupt nicht wahrzunehmen schien. Der Kürschner erkannte mit leichter Abscheu ein weiteres Exemplar dieses hergelaufenen Gesindels: Ja, unverkennbar ein Gaukler, wie seine bunte Narrenkleidung bewies. Ben musterte ihn abschätzend. Der Junge ging barfuß. Seine verhornten Füße hatten einmal Sandalen gesehen, deren Riemen helle Streifen auf der sonnengebräunten Haut hinterlassen hatten, doch das schien ein paar Tage her zu sein. Wahrscheinlich waren sie ihm verrottet von den Füßen gefallen. Bunte Stofffransen – Zeichen der Gauklergilde – verzierten die Außennähte der schmutzigen, lehmfarbenen Leinenhose. In der abendlichen Windstille baumelte der Gildenschmuck müde herab. Der Oberkörper des jungen Mannes war halbnackt, lediglich eine ärmellose, viel zu kleine Weste aus bunten Flicken bedeckte ihn. Man konnte jede einzelne Rippe sehen. Ja, dachte Ben, wer arbeitsscheu ist, hat auch nichts zum Beißen. In einem Strick, den der Gaukler als Gürtel um die Taille gebunden hatte, steckte ein Jagdmesser, und ein Geldbeutel hing trostlos und schlaff herab. Dafür trug der Junge ein mageres Bündel über der Schulter, wahrscheinlich mit seinen wenigen Habseligkeiten. Bens Blick tastete sich weiter nach oben und blieb am Gesicht hängen. Und zum ersten Mal ließen seine Gefühle von Abscheu und Geringschätzung nach. Der Ausdruck des Jungen war entrückt und voller Freude. Eine Träne glitzerte im Augenwinkel, und sein hohlwangiges Gesicht glühte im Abendlicht. Die Augen schimmerten hellgrau wie Gletschereis, die Nase war leicht gebogen, der Mund voll und weich. An Wangen, Oberlippe und Kinn spross ein flaumiger Jünglingsbart. Die hellbraunen Haare waren lang, strähnig und ungepflegt und bedurften dringend, wie der ganze Junge, eines heißen Bades. Mit einem mit bunten Perlen besetzten Lederband hielt sie aus der Stirn.
Endlich schien der junge Mann aus seinem Tagtraum zu erwachen. Er bemerkte den Karren, der direkt neben ihm anhielt.
„Meinen Gruß, Herr“, sprach er den Kutscher an. „Ist die Stadt da unten Shoal?“
Wenigstens ist er höflich, dachte Ben und nickte.
„Ich nehme an, du willst zum Gauklerfest?“
„Oh ja. Ich arbeite als Jongleur. Ich möchte am Wettbewerb teilnehmen. Vielleicht gewinne ich ein paar Silbermünzen.“
Der Junge tat Ben ein bisschen leid. Er hatte sich immer einen Sohn gewünscht, doch seine Frau hatte ihm stattdessen eine widerborstige Tochter geschenkt, nur wenig älter als dieser Bengel hier. Er liebte sie über alles, aber sie hatte sich seinen Bemühungen, sie zu erziehen und ihr seine Wertvorstellungen beizubringen, erfolgreich widersetzt. Das Kürschnerhandwerk hatte sie auch nicht erlernen wollen. Dafür zog sie jetzt durch die Wälder und sammelte irgendwelche Pflanzen, aus denen sie abscheulich schmeckende Tees brühte. Die Leute bezeichneten sie hinter ihrem Rücken als Kräuterhexe.
Ben bedauerte den Vater dieses Grünschnabels, dessen Erziehungswerk schien ebenso gescheitert, denn wie sonst hätte der Bengel ein herumstreunender Hungerleider werden können, naiv genug zu glauben, er könne mit seinen so genannten Künsten Geld verdienen? Deshalb polterte er schroffer als beabsichtigt:
„Mein lieber Junge, weißt du überhaupt, wie viele Gaukler sich schon in der Stadt aufhalten? Es sind Hunderte, die sich um die wenigen Preisgelder streiten. Nur die ersten drei eines Wettbewerbs bekommen nämlich etwas. Und auf die warten schon Heerscharen von Taschendieben, Räubern und Halsabschneidern. Vor fünf Jahren, beim letzten Fest, gab es drei Morde! Am besten kehrst du um. Das Gauklerfest ist ein Sumpf, in dem sich die Trunksüchtigen, Verderbten und Verbrecher wie Schweine suhlen, nichts für Milchbärte wie dich.“
Er knallte dem Maultier die Zügel auf die Hinterhand, sodass es sich erschrocken in Bewegung setzte, und ließ den sprachlosen jungen Mann einfach stehen.
Traigar vergaß den grantigen Alten schnell und richtete seinen Blick wieder auf das beeindruckende Panorama. Er hatte noch nie das Meer gesehen, geschweige denn einen Sonnenuntergang über der See. Mit ehrfürchtigem Staunen genoss er die letzte Szene des grandiosen Schauspiels. Unter ihm erstreckte sich eine halbkreisförmige Bucht, die sich nach Westen, zum Ozean hin, öffnete. Die Sonne war gerade hinter dem Horizont versunken, und ein roter Dunstschleier schwebte über dem bleifarbenen Meer. Wenige Augenblicke davor – als sie noch drei Handbreit über der leicht gewölbten Linie der Kimm gestanden hatte – war die See wie eine Platte aus poliertem Silber erschienen, auf der ein gleißender, Funken sprühenden Schweif glitzerte, dann hatte das Wasser die Farbe von heller Bronze und bald von Gold angenommen. Der Glutball schmolz sich schließlich hinein, verflüssigte das Gold und versank in der Schmelze. Der Spiegel der See schien wieder zu erkalten, sein Kupferton verblasste, und sein Glanz nahm ab.
Traigar prägte sich diesen Anblick ein und verwahrte ihn in der Schatztruhe seiner Seele. Er wollte sich immer daran erinnern.
Ein dreimastiges Schiff unter vollen Segeln schnitt mit keilförmiger Kielwelle durch das Wasser und hielt auf den Hafen vor der Stadt zu. Zahlreiche große und kleine Schiffe lagen an den Kais vor Anker.
Shoal war annähernd kreisförmig und von zwei konzentrischen Mauern umgeben, die äußere dick genug, um Katapultgeschossen zu widerstehen, die innere zu hoch für Sturmleitern. Wehrgänge mit Schießscharten liefen über die Mauerkronen, insgesamt zwölf hohe Wachtürme ragten weit über den dreifachen Befestigungsring. Vier Tore mit Türmen zu beiden Seiten gewährten den Zugang, davon eines zum Hafen hin und eines nach Süden. Durch dieses wollte er die Stadt betreten, doch zuerst musste er der Straße folgen, die von der Klippe hinabführte. Von hier oben erkannte Traigar ein verschachteltes Häusermeer. Rote und braune Ziegeldächer türmten sich übereinander und verzahnten sich wie die Schuppen einer Fischhaut. Die Straßen und Gassen dazwischen mussten eng und verwinkelt sein. Einige Türme ragten hie und da hervor, manche spitz, andere glockenförmig. Die letzteren schienen zu einem größeren Gebäudekomplex zu gehören, wahrscheinlich einem Tempel. Und dann erhob sich auf einem Hügel am nördlichen Ende ein Palast, majestätisch und prächtig, mit Marmorsäulen, Minaretten und Spitzbögen. Wohnte da der König?
Die Dämmerung währte in diesen Breiten nur kurz. Traigar sah die ersten Laternen aufleuchten. Er machte sich auf den Weg.
Eine Weile später betrat er die Stadt. Der Geruch, der ihm entgegenschlug, war überwältigend. Es roch nach Meer, nach Fisch, Stall und Stroh, nach Abfällen und Fäkalien, aber auch appetitanregende Gerüche von Gebratenem, frisch gebackenem Brot, von Bier und fruchtigem Wein gehörten zu diesem Gemenge. Vor allem aber roch es nach Menschen, nach Schweiß, Dreck, Ärmlichkeit, Krankheit, aber auch nach Duftwasser und Weihrauch.
Noch nie hatte er solche Menschenmassen erlebt. Trotz seines Unbehagens zwängte er sich hindurch und bemühte sich, jedem auszuweichen, der seinen Weg kreuzte. Er war es nicht gewohnt, anderen Menschen so nahe zu sein. Viele Leute trugen ärmlich aussehende, mehrfach geflickte Kleidung aus grobem, grauem oder lehmfarbenem Leinen oder Schafswolle. Sie schritten zielstrebig, den Blick geradeaus gerichtet, an Traigar vorbei und ignorierten die anderen Passanten. Kein Zweifel, sie gehörten hierher, waren Bürger dieser Stadt. Im Gegensatz zu ihnen schlenderten die meisten besser Gekleideten müßig umher, flanierten unter bunten, an Leinen über die Straßen gehängten Laternen, blickten neugierig in Fenster und Hinterhöfe, lachten, kehrten in Wirtshäuser ein oder verließen sie mehr oder weniger betrunken. Diese betuchten, meist in Gruppen auftretenden Passanten schienen Fremde zu sein, vom Gauklerfest angelockt und darauf aus, sich zu amüsieren.
Tandhändler, die mit Bauchläden oder kleinen Handkarren an den Ecken standen, priesen mit lauten Parolen ihre Waren an. Freizügig gekleidete Frauen mit rot gefärbten Lippen und gurrendem Lachen boten mit anzüglichen Gesten ihre Körper feil. Schattengestalten mit in Kapuzen verborgenen Gesichtern lugten aus den schmalen Gassen und kleinen Hinterhöfen heraus, warteten wohl auf ein unvorsichtiges oder betrunkenes Opfer, um es auszunehmen. Die Ursache all dieses Gewimmels waren die Angehörigen seiner eigenen Zunft. Hie und da klopfte ihm einer der bunt gekleideten Gaukler und Artisten auf die Schulter oder schickte ihm im Vorbeigehen einen freundlichen Gruß zu.
Die Stadtwachen, die gut gerüstet und mit Schwertern bewaffnet zu zweit durch die Straßen patrouillierten, musterten die vielen Fremden und die zwielichtigen Einheimischen misstrauisch. Es schien, als würden sie Ärger erwarten.
Plötzlich vernahm er Hufgetrappel. Ein Reiter kam um eine Ecke galoppiert, direkt auf ihn zu. Sein riesiges Pferd schäumte am Maul. Die aufgerissenen Augen des Tiers schienen wütend auf Traigar zu starren. Die anderen Passanten wichen routiniert und gelassen zur Seite, um den Weg frei zu machen. Der junge Gaukler, für einen Augenblick im Schreck erstarrt, schrie auf und rettete sich im letzten Moment mit einem Sprung, der ihn mit einem gut gekleideten, übergewichtigen Mann mittleren Alters zusammenstoßen ließ. Er erschrak zum zweiten Mal und stotterte eine Entschuldigung.
Der Angerempelte sah ihn tadelnd, aber wie es schien auch belustigt an.
„He, junger Mann, nicht so hastig und respektlos! Du bist wohl nicht von hier? Na, dann will ich gerne gnädig sein und darauf verzichten, die Wachen zu rufen und dich wegen Belästigung eines einflussreichen Bürgers einsperren zu lassen. Du solltest vorsichtiger sein. Der Bote des Lords ist in diesen Tagen ständig unterwegs, um den Stadtwachen Anweisungen zu geben. Die Sicherheit der Bürger und Besucher ist Lord Gadennyn sehr wichtig. Der Meldereiter hat es immer eilig, denn je eher er die Befehle abgeliefert hat, desto früher kann er eine Pause in einer der Schenken einlegen. Komm ihm also nicht in die Quere.“
Traigar bat nochmals wortreich um Verzeihung, doch der andere unterbrach ihn:
„Wo willst du denn eigentlich hin?“
„Ich weiß nicht. Ich bin gerade erst angekommen. Wisst Ihr vielleicht, wo ich etwas zu essen und ein Bett für die Nacht bekommen kann?“
„Das kommt auf die Fülle deines Geldbeutels an. Wenn du nicht über die Mittel eines Fürsten verfügst, wirst du wohl schwerlich etwas finden. Alle Gasthäuser und Herbergen sind überfüllt, selbst die Pferdeställe sind schon zu horrenden Preisen an menschliche Gäste vermietet. Eigentlich gibt es nur noch im Palast freie Zimmer. Aber wie gesagt: nur für Fürsten.“
„Ich habe leider gar kein Geld, aber ich kann für Unterkunft und Verpflegung arbeiten.“
Der Mann lachte leise.
„Was glaubst du, wie viele Menschen sich für die Spülküche anpreisen oder Pferdeställe ausmisten wollen, nur um sich das Bett mit wenigstens zwei anderen Gästen teilen zu dürfen? Aber ich sehe, du bist ein Künstler. Bist du gut in deinem Handwerk?“
„Ich denke schon. Ich hoffe, ich kann morgen beim Wettbewerb der Jongleure ein Preisgeld gewinnen.“
Wieder lächelte der Mann.
„Ah, so gut bist du also. Na, dann kannst du ja morgen fürstlich bezahlen. Schade nur, dass man hier überall Wert auf Bezahlung im Voraus legt. Aber mir fällt da etwas ein: Der Wirt des Gasthofs ‚Zur Gespalteten Tanne’ soll ein weiches Herz haben, sagt man. Vielleicht solltest du es dort versuchen. Geh hier die Straße entlang, dann biegst du die übernächste Gasse links ab, dann die nächste wieder rechts. Dieser folgst du bis zu dem grünen Haus mit den roten Fenstern. Von dort…“
Der Mann erklärte ihm gestenreich den komplizierten Weg. Traigar bedankte sich höflich und machte sich auf, den Gasthof zu suchen. Er folgte zunächst der breiten, belebten Straße. Doch bald wurden die Gassen schmaler, die Laternen seltener und die Schatten schwärzer. Er lief an geschlossenen Läden vorbei, durch deren Ritzen nur wenig Licht drang, dann durchquerte er einen engen und dunklen Durchgang. Hier roch es nach verfaulten Essensresten und Urin. Traigar atmete schneller und spürte sein Herz klopfen. Er war ein Landkind, das meist unter freiem Himmel schlief und die Weite gewohnt war. Die Enge der Stadt empfand er als bedrohlich. Hastig passierte er die finstere Gasse. Ein Poltern ließ ihn erschreckt herumfahren. Er riss den Dolch aus der Scheide. Doch es war nur eine große Ratte, die auf der Suche nach etwas zu fressen eine verrottete Kiste umgestoßen hatte. Er beschleunigte seine Schritte und fand endlich das grüne Gebäude mit den roten Fensterläden, das sich als Freudenhaus entpuppte. Doch er hatte den Rest der verzwickten Wegbeschreibung des dicken Mannes vergessen. In seiner Not sprach er eine der in den offenen Fenstern posierenden Frauen an und erkundigte sich nach dem Weg. Bald darauf hatte er das Gasthaus „Zur Gespaltenen Tanne“ gefunden.
Eine hohe, weißgetünchte Mauer umgab die Herberge. Durch das offenstehende Tor gelangte er in einen Innenhof mit einem Ziehbrunnen. Links von ihm waren die Ställe untergebracht, rechts befand sich das dreistöckige Gasthaus. Gelächter und Musik drangen aus der Tür. Die Fensterläden standen offen, und Licht schien durch Scheiben aus Butzenglas. Ein Mann stolperte über die Schwelle und taumelte lallend durch das Hoftor nach draußen. Traigar trat ein.
Innen erwartete ihn eine Wolke aus Tabakqualm und der Duft von geräuchertem Schinken, Bratkartoffeln und anderen Leckerbissen, der den Speichel in seinem Mund fließen ließ. An den rauchgeschwärzten Deckenbalken hingen zahlreiche Petroleumlampen, verteilt über den ganzen Schankraum. Dieser bestand aus zwei Abschnitten: Zu seiner Linken lag ein großer Saal, dessen Höhe sich über zwei Stockwerke erstreckte. Darin standen mehrere Reihen langer Tische mit Holzbänken zu beiden Seiten, alle voll besetzt. Am hinteren Ende des Raumes befand sich ein erhöhter Tanzboden mit einem Geländer drum herum, auf dem sich einige Paare abmühten, ihre Schritte in Gleichklang zu bringen. Eine schmale Treppe führte von dort zu einer Galerie hinauf, wo drei Musikanten mit Laute, Flöte und Handtrommel zum Tanz aufspielten. Gemurmel, Gelächter, Grölen und Zoten der Gäste überlagerten ihre musikalische Darbietung.
Zu Traigars Rechten erstreckte sich schlauchartig ein zweiter Raum, geteilt durch eine lange Holztheke. Dahinter zapften Bedienstete Bier oder schenkten Wein ein, davor stand eine Bank an der Wand, ebenso lang wie der Tresen, auf der die Gäste Seite an Seite saßen, alle mit Krügen oder Bechern in der Hand. Der eine oder andere hielt auch einen Kanten Brot oder eine Hühnerkeule.
Genau gegenüber der Eingangstür, in der Traigar immer noch stand, öffnete sich ein Durchgang zur Küche. Schankmägde, beladen mit Tellern, auf denen sich lecker duftende Speisen türmten, eilten heraus und schwärmten aus, um die Wartenden zu bewirten. Sehnsüchtig blickte er ihnen nach. Welch einen Hunger er hatte! Seine letzte Mahlzeit hatte am Morgen aus einem verschrumpelten und wurmstichigen Apfel bestanden, von einer Bäuerin erbettelt.
Er wandte sich zur Theke. Eine Bohnenstange von Kerl, mindestens sieben Fuß groß, noch recht jung, mit abstehenden Ohren und Schalk in den Augen, scherzte mit einer grün beschürzten jungen Frau, während er gleichzeitig Bierkrüge aus einem Fass füllte. Die Frau nahm die schweren Gefäße und trug sie, vier in jeder Hand, in den Gastraum. Traigar fragte den Mann, ob er der Wirt sei. Dieser lachte.
„Leider hat mich mein Vater noch nicht mit seinem Ableben beehrt. Solange bin ich nur der Sohn des Wirts. Was willst du von ihm, doch nicht etwa eine Unterkunft? Da muss ich dich enttäuschen.“
„Überlass das mir, Fitz“, vernahm Traigar eine bekannte Stimme. Aus der Küche war ein beleibter Mann getreten: der Passant, den Traigar vorhin beinahe umgerannt hatte.
„Ihr?“
„Ja, dieses Gasthaus gehört mir, kleiner Gaukler. Ich hoffe, du beherrschst deine Kunst so gut, wie vorgibst. Das musst du heute meinen Gästen beweisen. Ich erwarte eine grandiose Vorstellung von dir, die meiner bescheidenen Herberge Ruhm, Ehre und Gäste bringen soll. Doch vorher lasse ich dich passabel herrichten. Myra!“, donnerte seine Stimme durch den Gastraum und übertönte den Lärm. Die Frau in der Schürze tauchte wieder auf.
„Ja, Euer Durchleibt, wie kann ich Euch dienen?“ Sie zwinkerte ihm spöttisch zu.
Der Wirt tätschelte lächelnd seinen Bauch und verriet: „Gib’s doch zu, Myra: Du liebst meinen stattlichen Körper! Aber genug von deinen Schmeicheleien. Ich habe eine Aufgabe für dich, meine Liebe, die dir Spaß machen wird: Hier“ – er deutete auf Traigar – „haben wir einen außerordentlich wichtigen, ja, fürstlichen Gast. Jedenfalls streicht er, wenn man ihm glauben darf, morgen eine fürstliche Belohnung ein. Im Augenblick scheint er mir weder fürstlich auszusehen noch adligen Wohlgeruch zu verströmen. Stecke ihn also bitte in eine Wanne mit heißem Wasser und schrubbe ihn, bis seine Haut rosa wie ein Säuglingsarsch glänzt. Dann gibst du ihm ein paar alte Kleidungsstücke von Fitz, aus denen der längst herausgewachsen ist, und beauftragst Margo damit, die Sachen zu waschen, die er am Leib trägt. Danach such ihm ein Bett, aber nicht dein eigenes!“
Die junge Frau kicherte. „Jawohl, Euer Gnaden, ganz zu Euren Diensten. Aber mit einem Bett werde ich wohl nicht dienen können. Selbst die Ställe sind voll, und auf jeder Pritsche und jedem Strohsack schlafen schon zwei Gäste.“
„Auch im Bett von Fitz?“
„Aber, Vater!“, wandte der junge Mann verdattert ein.
„Keine Widerrede. Ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Und außerdem wird vor Morgengrauen keiner von euch zum Schlafen kommen. Solange nicht der letzte Gast gegangen ist, werdet ihr arbeiten!“
Wenig später stand Traigar verlegen vor einem hölzernen, mit heißem Wasser und Seifenschaum gefüllten Bottich im Privatgemach des Wirtes. Verlegen deshalb, weil Myra sich im Zimmer befand, ihn erwartungsvoll ansah und keine Anstalten machte, ihn allein zu lassen. Er räusperte sich geflissentlich. Die junge Frau lachte:
„Wenn du darauf wartest, bis ich gehe, wirst du nie in die Wanne steigen. Bolder hat mir den klaren Auftrag erteilt, dich eigenhändig zu schrubben. Du hast als Herumstreuner wahrscheinlich wenig Übung in der Kunst der Körperpflege, deshalb bezweifle ich, dass du ohne Hilfe wirklich sauber wirst. Stell dich also nicht so an. Ich wirke vielleicht nicht so, aber ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Da werde ich wohl wissen, wie ein Mann ohne Kleider aussieht.“
„Dann dreht Euch aber wenigstens um.“
Myra zuckte amüsiert mit den Schultern und wandte sich ab. Nachdem Traigar sich versichert hatte, dass kein Spiegel in der Ecke stand, in dem sie ihn beobachten konnte, schälte er sich schnell aus seinen schmutzigen Kleidern und stieg in den Bottich, wobei er einen leisen Schrei ausstieß, denn das Wasser war noch sehr heiß. Dennoch setzte er sich rasch und war nun bis zum Hals im Schaum verborgen. Die Frau drehte sich zu ihm um, in der Hand einen Schwamm und ein kantiges Stück Seife.
„Nun tauche erst einmal unter und wage nicht, deinen Kopf wieder herauszustrecken, bevor ich mein Lied zu Ende gesungen habe.“
„Aber –„
„Keine Widerrede. Läuse und Wanzen sind zäh. Wir müssen sie ertränken, sonst wirst du sie nie los.“
Er konnte gerade noch tief Luft holen, da drückte sie auch schon seinen Kopf unter Wasser. Dann hörte er sie singen, ohne allerdings ein Wort ihres Liedes, das sich wie ein melodisches Gurgeln anhörte, zu verstehen. Nach der dritten Strophe oder so hielt sie ihn immer noch unter Wasser gedrückt. Panik überkam ihn. Er musste unbedingt atmen. Er versuchte sich hochzustemmen, aber sie setzte ihr ganzes Gewicht ein, und so schlug er um sich und fing an zu strampeln. Da ließ sie seinen Kopf los. Traigar schoss aus dem Wasser und schnappte nach Luft.
Sie kreischte, halb lachend, halb empört:
„Sieh nur, du hast mich ganz nass gespritzt! Mein Lied war noch gar nicht zu Ende. Hast du gedacht, ich ließe dich ertrinken?“
Danach wusch sie ihm die Haare, seifte ihm Gesicht und Hals ein und pulte mit einem Holzstückchen den Schmalz aus seinen Ohren. Traigar musterte sie verstohlen. Sie wirkte aus der Nähe nicht mehr wie ein Mädchen. Da bemerkte er: Eine erwachsene Frau stand vor ihn, der das Leben erste Spuren ins Gesicht gezeichnet hatte. Neugierig erkundigte er sich:
„Ihr sagtet, Ihr hättet schon einen Ehemann und Kinder in Euren jungen Jahren?“
„So jung bin ich gar nicht mehr. Ich zähle bald dreißig Jahre, und ich habe eine süße Tochter von fünf und einen kleinen Bengel von zwei Jahren. Ich denke, es werden noch einige mehr werden, denn Bolder ist sehr fleißig im Bett.“
„Bolder, der Wirt? Aber er hat doch einen fast erwachsenen Sohn!“
„Du meinst Fitz? Dessen Mutter bin ich nicht. Sie ist im Kindbett gestorben, als sie ihn zur Welt brachte. Und erwachsen ist er noch lange nicht, wenn auch sehr groß für sein Alter. Ich hoffe, er wächst nicht noch mehr, sonst müssen wir die Türstürze herausschlagen. Schon jetzt stößt er sich beinahe jeden Tag den Kopf daran.“
„Erzähle mal von dir“, fuhr sie nach einer kurzen Pause fort. „Wie alt bist du, und woher kommst du?“
„Ich heiße Traigar, das wisst Ihr ja schon. Ich bin siebzehn Jahre alt und stamme aus einem kleinen Dorf namens Stonewall.“
„Nie davon gehört.“
„Es liegt an der östlichen Grenze, Hunderte von Meilen entfernt, im Gebirge.“
„Dann bist du also schon einige Tage unterwegs?“
„Genauer gesagt, drei Jahre. Solange bin ich schon nicht mehr zu Hause gewesen.“
Zum ersten Mal zeigte sich Myras Miene ernst.
„Ein Junge in deinem Alter sollte nicht allein umherziehen. Du musst doch Heimweh haben. Fehlen dir deine Eltern nicht?“
„Meine Mutter ist tot, und mein Vater hat mich verstoßen.“
Dabei drückte sein Gesicht aus, er sei nicht gewillt, das Thema weiterzuverfolgen. Die junge Frau respektierte das, und so unterhielten sie sich über belanglosere Dinge. Sie erzählte ihm kichernd Scherze und sang ihm noch ein Lied vor. Als sie jedoch Anstalten machte, ihn mit einem scharfen Messer zu rasieren, protestierte er energisch.
„Eines Mannes Zier ist sein Bart!“
Wieder lachte sie.
„Bolders Zier ist etwas ganz anderes, allerdings wollte er auch nicht, dass sie ihm jemand stutzt. Ich hole dir jetzt ein paar Sachen von Fitz zum Anziehen. Ich denke, mit dem restlichen Teil von dir wirst du ohne meine Hilfe fertig.“
Myra drückte ihm Seife und Schwamm in die Hand und ließ ihn allein.
Einige Zeit später stand er auf dem erhöhten Podest des Tanzbodens, der auch als Bühne für Darbietungen aller Art diente. Der Schankraum war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Gäste blickten ihn erwartungsvoll an. Auch Bolder und Myra standen im Hintergrund und beobachteten ihn. Traigar fühlte sich nervös. Er wollte dem Wirt und seiner Frau für ihre Großherzigkeit eine gute Vorstellung bieten und durfte sie nicht enttäuschen. Allerdings beabsichtigte er, nicht zuviel von seiner Kunst preiszugeben, denn morgen war der entscheidende Tag. Heute wollte er seinen Konkurrenten – von denen durchaus welche unter den Gästen sitzen mochten – noch keinen Hinweis auf sein wahres Können geben. So ließ er sich aus der Küche einige scharfe Messer bringen und begann zu jonglieren, erst mit dreien, dann mit vieren und schließlich mit fünfen. Die Messer flogen immer höher, berührten beinahe die Decke des hohen Saals. Traigar schloss die Augen. Dann schwirrten auf einmal alle Messer gleichzeitig durch die Luft und stürzten auf ihn herab. Mit immer noch geschlossenen Augen brachte er sich mit einem Salto rückwärts in Sicherheit. Die Messer blieben zitternd im Holzboden stecken, genau da, wo er einen Augenblick vorher gestanden hatte. Das Publikum machte große Augen. Nach einer kurzen Stille regten sich erste Hände, dann badete er im ersehnten Applaus.
Bolder eilte nach vorne, mit Schweiß auf der Stirn, und bat ihn, doch etwas weniger Gefährliches zu zeigen. Und so griff Traigar dem Wirt ans Ohr und zog zum Vergnügen der Gäste eine gestopfte Tabakspfeife heraus. Aus dem anderen Ohr fischte er einen wachsgetränkten Holzspan, kratzte sich mit ihm am Hintern, wobei der Span entflammte. Damit zündete er die Pfeife an und steckte sie Bolder in den vor Staunen offenen Mund. Nach einem Moment der Verblüffung grinste der Wirt über das ganze Gesicht, zog heftig an der Pfeife und stolzierte paffend durch die lachende Menge. Sein triumphierender Gesichtsausdruck wollte sagen: Na, habe ich euch vielleicht zuviel versprochen?
Traigar öffnete seinen Beutel und fischte eine kleine durchbohrte Holzkugel heraus. Er tat nun so, als würde er eine lange, unsichtbare Schnur an dem Ball befestigen. Dann stellte er Blickkontakt zu einem Zuschauer mit wachen Augen her, der an einem Tisch in der dritten Reihe saß, und rief ihm zu: „Fang!“, als er den Holzball warf. Der Mann schnappte die Kugel geschickt aus der Luft.
„Nun zieh“, befahl der junge Gaukler. Sein unfreiwilliger Gehilfe hatte verstanden und bewegte die Holzkugel nach hinten, so, als ob er damit an der Schnur zöge. Traigar, der so tat, als hielte er das andere Ende des fiktiven Fadens immer noch in der Hand, bewegte seinen Arm wie erzwungen nach vorn und mimte dabei Anstrengung. Der Mann „zog“ noch mehr, und Traigar täuschte einen stolpernden Ausfallsschritt vor, scheinbar, um auf den Beinen zu bleiben. Das Publikum lachte. Dann hob er die Hand: „Nur straff halten!“, bat er seinen Partner unter den Zuschauern. Aus dem Beutel nahm er einen aus Draht und bunter Seide hergestellten Paradiesvogel, der am Kopf einen kleinen Haken besaß. Er gab vor, den Vogel an der Schnur aufzuhängen, und ließ ihn los. Der schwebte nun in der Luft. Ein Raunen ging durch den Raum. Traigar hob langsam den Arm, der die Schnur zu halten vorgab, und der Vogel folgte dem vermeintlichen Gefälle, glitt immer schneller über die Köpfe der vorderen Gäste hinweg und landete schließlich in der Hand seines freiwilligen Mitspielers, der vor Schreck die Kugel fallen ließ.
Der junge Gaukler verbeugte sich, und ein Beifallssturm rauschte durch den Saal. Zahlreiche Kupfermünzen flogen auf die Bühne. Er sammelte sie ein, bedankte sich und bat um eine Pause und den Wirt um etwas zu essen und zu trinken, was dieser ihm gerne erfüllte.
Nach fünf Stunden, Mitternacht war schon vorbei, hatte Traigar acht Vorstellungen vor immer wieder neuen Gästen gegeben, denn die vorigen strömten in andere Wirtshäuser, nachdem sie ihn gesehen hatten, und berichteten dort von seinem Können. Und so herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Die Zuschauer forderten den Jungen immer wieder auf, seine Künste zu zeigen, aber endlich gebot Bolder dem Einhalt.
„Du hast genug gearbeitet, mein Junge. Jetzt geh schlafen oder genehmige dir mal ein Bier.“
„Ich möchte Euch und Myra für Eure Großzügigkeit und Gastfreundschaft danken, Master Bolder. Das Essen war wirklich köstlich. Aber ich kann es jetzt bezahlen. Mein Geldbeutel ist dank Eurer Gäste voller Kupfermünzen.“
„Du mich bezahlen? Umgekehrt wäre es wohl gerechter. Ich habe heute Nacht viel mehr Geld als sonst eingenommen und mich köstlich amüsiert. Nun trink ein bisschen auf meine Rechnung mit den Gästen.“
Traigar steuerte das hintere Ende des schlauchförmigen Schankraums an und schlenderte dabei an der voll besetzten Bank vorbei, wo man ihm öfters auf die Schulter klopfte, als ihm lieb war. Fitz erwartete ihn schon mit einem breiten Grinsen. Er stand hinter der Theke, in der Hand einen Krug frisch gezapften Bieres.
„Man hat mir erzählt, du seiest gut gewesen. Von deinen Kunststücken habe ich leider nicht viel mitbekommen, denn anscheinend bin ich der Einzige, der heute arbeitet. Mein Vater und Myra haben dir die meiste Zeit zugeschaut.“
„Ich gebe dir gerne eine Privatvorstellung.“
„Lass mal gut sein. Wo hast du das denn gelernt?“
„Ich war die letzten drei Jahre mit einem Wanderzirkus unterwegs. Die Artisten haben mir viel beigebracht.“
„In nur drei Jahren? Dann musst du aber ungewöhnlich talentiert sein, wenn man der Reaktion des Publikums und dem Schwärmen von Myra trauen kann.“
Traigar sah aus dem Augenwinkel eine Person auf sich zukommen, doch er beachtete sie – vertieft in das Gespräch mit dem Gastwirtsohn – nicht weiter. Plötzlich spürte er ein Zupfen am Gürtel und hörte Schritte, die sich hastig entfernten. Er blickte nach unten. Dort, wo sein Geldbeutel am Gürtel hängen sollte, baumelte nur noch ein durchgeschnittenes Stück Lederband. Erschrocken wandte er sich um.
Der Mann hatte mit raschen Schritten schon den halben Raum durcheilt, als ihm jemand ein Bein stellte und er hinfiel. Einen Augenblick später saß eine rothaarige Frau rittlings auf ihm, ihr Rock rutschte hoch und gab einen Blick auf ihre schönen Beine preis.
„Sieh an, wen haben wir denn da? Einen aus der so seltenen Zunft der Beutelschneider, scheint mir!“, spöttelte sie.
Der Mann hielt das Messer, mit dem er den Geldbeutel Traigars abgeschnitten hatte, noch in der Hand und versuchte sich umzudrehen, um nach der Frau zu stechen. Doch da erhob sich behäbig eine andere Person von der Bank, ein Mann, der, wie Traigar sich jetzt erinnerte, neben der Frau gesessen hatte. Er war längst nicht so groß wie Fitz, ja sogar etwas kleiner als Traigar, aber dafür wohl doppelt so breit. Seine Oberarme wirkten fast so dick wie die Oberschenkel von Bolder, und das wollte bei dessen Leibesfülle etwas heißen. Die Körperkräfte dieses Muskelprotzes mit dem Stiernacken mussten außerordentlich sein, vermutete Traigar.
Der Bulle bückte sich, packte die Hand des Diebes, der mit dem Messer herumfuchtelte, und drückte zu. Mit einem Aufschrei ließ der andere die Waffe fallen.
„Mit einem Dolch gegen ein Mädchen! Das ist nicht sehr nett. Ich fühle mich ein wenig aufgebracht. Du willst doch nicht, dass ich richtig wütend werde, oder?“
Der Taschendieb keuchte und schnaufte, konnte sich dem Griff aber nicht entwinden. Die Frau nahm ihm Traigars Geldbeutel ab. Inzwischen hatte jemand die Stadtwache gerufen, die den zerknirschten Mann abführte. Der stiernackige Bulle und seine Begleiterin näherten sich Traigar. Sie lächelte spöttisch.
„Gehört der verschwundene Geldbeutel auch zu deiner Vorstellung? Wolltest du ihn jemandem aus den Ohren ziehen, oder bist du vielleicht ein grünes Huhn vom Lande, das gerupft werden will?“
„Hör nicht auf ihre Schlangenzunge. Wenn sie gerade kein Gift versprüht, ist sie ganz lieb. Ich bin Boc, der Schmied.“
Boc streckte Traigar die Hand entgegen, die dieser vorsichtig nahm. Er hatte einen Knochen brechenden Händedruck erwartet und war erstaunt, dass der Griff seine Finger nicht zerquetschte.
„Glaube nicht, was dir dieser Säugling im Körper eines Preisboxers erzählt. Ich bin immer lieb und heiße Cora. Ich bin so etwas wie eine Giftmischerin.“
„Sie ist eine Heilerin. Und nun halt den Mund, Cora, und gib dem Jungen doch mal die Gelegenheit, sich ordentlich bei mir bedanken.“
„Du meinst, bei mir.“ Cora musste offenbar stets das letzte Wort haben.
Traigar dankte beiden und lud sie ein, mit ihm zu trinken, was sie auch gerne annahmen. Während er den schnippischen Bemerkungen Coras lauschte, musterte er sie genauer. Sie war eine schöne Frau, die ihn gleich bezauberte. Ihr glutfarbenes Haar rahmte ihr ovales Gesicht ein und fiel in Wellen auf die Schultern. Große, weit auseinander stehende Augen mit grüner, goldgesprenkelter Iris blickten ihn an. Der Mund lächelte breit und spöttisch. Zahlreiche kleine Makel machten ihre Anmut noch natürlicher: etwas unregelmäßige, große Zähne, Sommersprossen, die Nase und Stirn bedeckten, winzige Fältchen, welche die Augenwinkel säumten, ein Leberfleck mitten im Grübchen ihres Kinns, für eine Frau ungewöhnlich dichte, ungezupfte Augenbrauen, eine kleine Warze an ihrem schlanken Hals. Nicht nur ihr Gesicht fesselte Traigar: Cora besaß auch eine gute Figur mit schlanker Taille und ein wenig zu breiten Hüften.
Boc hingegen gehörte nicht gerade zu den gutaussehenden Kerlen: Er war glatt rasiert, doch ein blauer Schatten auf Wangen und Kinn zeugte von starkem Bartwuchs. Er besaß kleine, schwarze Knopfaugen wie eine Maus, überwuchert von zusammengewachsenen dichten Brauen, eine knollige Nase, aus deren Löcher Haare herauslugten, und einen fast mädchenhaften, winzigen Mund. Sein kurzes, krauses Haar, schwarz und stumpf wie Holzkohle, stand drahtig wie die Borsten einer Bürste ab. Wenn er ein grimmiges Gesicht aufsetzte, wie eben, als er dem Dieb gedroht hatte, konnte man wirklich Angst vor ihm bekommen, doch jetzt zeigte seine Miene einen offenen und herzlichen Ausdruck. Traigar war kein ausgesprochener Menschenkenner, aber er schätzte den Schmied als freundlich und gutherzig ein.
„Seid ihr aus Shoal?“, erkundigte er sich.
„Wir wohnen in einem Dorf, ein paar Stunden zu Fuß von hier. Wir sind nur deinethalben gekommen! Na ja, wir wollten die Gaukler sehen und wohnen bei Freunden in der Stadt“, antwortete Cora.
„Du nimmst doch auch an einem der Wettbewerbe teil?“, erkundigte sich Boc. Als Traigar nickte, fuhr er fort:
„Mit deiner Messernummer solltest du eine gute Chance haben. Sehr eindrucksvoll.“
„Den fliegenden Vogel fand ich noch viel schöner“, wandte die Frau ein.
„Das sind doch nur einfache Tricks“, erklärte Traigar. „Wenn ich morgen damit aufträte, würden mich die anderen Bewerber auslachen. Ich kenne einen zwergenwüchsigen Artisten aus Orinokavo, der jongliert mit sieben Bällen. Ein anderer arbeitet wie ich mit Messern, dafür aber mit verbundenen Augen. Und wenn Aganar, der Mann aus Tatsouhy, seinen besten Trick zeigt, jongliert er mit gefüllten Bechern, ohne einen Tropfen zu vergießen. Nein, ich muss schon Besseres bieten, um morgen zu gewinnen.“
„Und, wirst du?“
„Ihr werdet es ja merken. Ich hoffe, ich sehe euch unter den Zuschauern.“
Cora kicherte: „Das wird sich mein Ochse nicht entgehen lassen.“
„Worauf du einen Furz lassen kannst“, bekräftigte Boc.
Als die Glocke des Uhrturms zweimal schlug, war Traigar betrunken und verabschiedete sich von seinen beiden neuen Freunden. Zum ersten Mal seit Monaten fühlte er sich großartig. Das Publikum hatte ihm zugejubelt, er hatte sich satt essen können, sympathische Menschen kennengelernt, mit ihnen getrunken und gelacht. Der Tag hätte nicht besser verlaufen können.
Myra, die Wirtin, führte ihn in das zweite Obergeschoß zu Fitz’ Kammer. Das Bett des Jungen bot mehr als ausreichend Platz für beide. Innerhalb weniger Augenblicke schlief Traigar ein.
Am nächsten Morgen erwachte er von einem Geräusch, das in an das Schnauben eines Pferdes, gemischt mit dem Brummen eines Bären erinnerte. Es war der schnarchende Fitz, der sich im Bett breit gemacht hatte, weshalb Traigar nun halb über den Rand hinaushing. Durch die Ritzen der Fensterläden fielen dünne Lichtfinger. Leise stand er auf, um Fitz nicht zu wecken, der bestimmt bis zum Morgengrauen in der Schankstube gearbeitet hatte. Er zog die geliehenen Sachen an, da seine eigenen, die am Kamin hingen, noch nicht ganz trocken waren, und stieg die Treppe hinab. Es war still und dunkel im Haus. In der Küche stibitzte er einen Apfel und trat hinaus.
Die Stadt war schon längst erwacht und das Fest bereits wieder im Gang. Auf jedem Platz konnte man eine andere Attraktion bestaunen. Traigar blieb hier und da eine Weile stehen und schaute zu: Ein Seiltänzer hielt eine langen Stange in den Händen und balancierte mutig über ein zwischen zwei Häusern gespanntes Seil. Die Ahs und Ohs der Menge begleiteten jeden Wackler und Stolperer des Artisten. Traigar lächelte, denn er wusste aus seiner Zeit beim Wanderzirkus, die um Haaresbreite vermiedenen Abstürze waren nur vorgetäuscht.
An einer Bühne, auf der ein Zauberkünstler seine verblüffenden Tricks darbot, erkundigte er sich bei einem Mann in der Kluft eines Stadtdieners, ob er wisse, wo die Jongleure aufträten, denn er wolle an diesem Wettbewerb teilnehmen. Der Beamte musterte ihn zweifelnd.
„Du bist ein Artist?“ Traigar nickte. „Dann musst du dich erst anmelden. Geh hinüber zum Palast. Dort erfährst du alles Wichtige. Keine Angst. Du hast noch genügend Zeit. Die Jongleure, Feuertänzer und Kraftathleten sind erst heute Abend an der Reihe.“
Wenig später hatte er den Palast gefunden. Er stieg eine breite Treppe hinauf und trat durch das offene, von mächtigen Säulen eingerahmte Tor in eine fast leere, sehr große Halle. Der Gasthof „Zur Gespaltenen Tanne“ hätte ohne weiteres hineingepasst. Hohe, schmale Fenster an den Seiten ließen das Licht hindurchfluten. Es bildete ein Muster aus gleißenden Balken auf dem glatt polierten Marmorboden. Traigar durchschritt Vorhänge aus glitzerndem in der Luft schwebendem Staub und näherte sich einem breiten Stehpult, vor dem einige Dutzend Männer und Frauen in der typischen bunten Kleidung der Artisten in einer Schlange warteten. Drei Livrierte standen hinter dem Pult. Der mittlere kratzte mit einer Schreibfeder über die Seiten eines dicken Buchs, das aufgeschlagen vor ihm lag. Der linke warf ab und zu ein paar Münzen in einen Geldtopf und teilte Papiere an die Teilnehmer aus. Der rechte setzte nur ein gelangweiltes, hochmütiges Gesicht auf und tat gar nichts.
Traigar stellte sich hinten an. Nach einer Weile sprach er neugierig den Mann vor ihm an:
„Was sind das für Leute da vorn?“
Geringschätzig antwortet der: „Beamte des Königs. Man erkennt sie daran, dass sie zu dritt eine Arbeit erledigen, die einen einzelnen Mann kaum auslasten würde.“
„Wohnt denn der König in diesem Palast?“
Der Mann sah ihn ungläubig an. „Der König? Ha! Du bist wohl nicht aus Koridrea, was?“
„Na ja, schon, aber…“
„Der Königspalast steht in Inay, das weiß doch jeder. Dieses Haus gehört Lord Gadennyn.“
„Lord wer?“
„Sag bloß, du hast noch nie von ihm gehört? Lord Gadennyn ist der Fürst der Provinz Shoala, und Shoal unsere die Provinzhauptstadt.“
Traigar erinnerte sich an den Boten des Fürsten, der ihn beinahe niedergeritten hatte. „Ich bin gestern seinem Meldereiter begegnet. Dann wohnt der Fürst also hier?“
„Ich habe nicht gesagt, er wohnt hier, aber der Palast gehört ihm. Er hat ihn dem Volk zur Verfügung gestellt. Das Gebäude dient jetzt als Sitz des Stadtrats, und auch der Rat der Fürsten tagt hier manchmal. Seine Lordschaft lebt in seiner Burg, eine halbe Tagesreise von hier. Lord Gadennyn zieht die Ruhe des Landes der Hektik der Stadt vor.“
Traigar bedankte sich bei dem Mann. Inzwischen war er in der Schlange weiter nach vorne gespült worden und stand bald vor dem Pult. Nachdem der Beamte seine Personalien in das Buch eingetragen hatte, zeigte er ihm auf einem Stadtplan die Bühne der Jongleure und ermahnte ihn, er habe sich eine Stunde vor Beginn des Wettkamps dort einzufinden. Dann musste Traigar fünf Kupferstücke als Teilnahmegebühr zahlen. Zum Glück hatte er am Abend zuvor genug verdient. Schließlich erhielt er ein Papier, das ihn als Teilnehmer des Wettbewerbs auswies.
Nachdem er den Palast verlassen hatte, bummelte er eine Weile durch die Straßen und betrachtete das bunte Treiben. Schließlich führten ihn seine Schritte zum Südtor, und er fühlte sich vom Meer und dem Hafen magisch angezogen. Staunend betrachtete er die Drei- und Viermaster mit ihren gerefften Segeln und knarrender Takelage. Sehnsüchtig blickte er hinaus über die scheinbar endlose Weite des Ozeans. Er würde so gerne mit einem dieser stolzen Schiffe davonsegeln, in ferne und exotische Länder.
Ein Raunen der auch hier zahlreichen Menschen lenkte ihn ab. Er wandte sich um und entdeckte einen Wettbewerb der Kunstschützen, bereits in vollem Gange. Neugierig trat er näher. Man hatte verschieden große Zielscheiben am Rande eines Kais aufgestellt. Nur noch drei Bogenschützen maßen sich gerade im Endkampf. Sie standen hinter einer Kreidelinie, sechzig Schritte von den Zielen entfernt. Die große und die mittelgroße Scheibe hatten sie bereits mit Pfeilen gespickt, jetzt schossen sie auf die kleine. Sie spannten ihre Bögen, zielten, und die Geschosse schnellten beim hellen Ton eines Gongs gemeinsam von den Sehnen. Alle drei trafen ihr Ziel. Der Kampfrichter maß zehn weitere Schritte ab, zog mit seinem Kreidestück eine neue Linie auf dem Boden, und die Bogenschützen stellten sich dahinter auf. Das Spiel wiederholte sich noch dreimal. Inzwischen betrug die Entfernung schon hundert Schritte. Wiederum schnellten die Pfeile von den Sehnen, aber nur zwei trafen. Der dritte flog knapp an der kleinen Scheibe vorbei und klatschte weit entfernt ins Hafenwasser. Der Schütze fluchte und warf den Bogen auf die Erde. Nachdem der Schiedsrichter ihm seine Prämie, drei Silbermünzen, gegeben hatte, trollte sich der Mann, noch immer ärgerlich. Jetzt blieben nur noch zwei übrig. Der eine war ein dicker, gut gekleideter Mann. Hosen und Weste bestanden aus blauem Brokat, um die Leibesmitte trug er eine goldene Schärpe und auf dem Kopf einen blauen Hut mit einer Fasanenfeder. Offenbar ein Adliger. Der andere war etwa sechs Fuß groß, sehnig und hager und trug die Kleider eines Waldläufers: brauner Lederwams, Leinenhose und weiche Lederschuhe. Auf seinem Kopf saß eine seltsame, mit Schlangenhaut gesäumte Fellmütze, die das wirre, braune Haar kaum bändigte. Sein zotteliger Bart verlieh ihm ein grimmiges Aussehen. Die Augen mit dem harten und durchdringenden Blick erinnerten Traigar an die eines Raubvogels.
Der Wettstreit ging weiter. Bei hundertdreißig Schritten blieb der Pfeil des Adligen gerade noch im Rand der Scheibe stecken, während der Waldläufer die Mitte traf. Doch das Schiedsgericht wertete das Ergebnis als Unentschieden. Bei hundertvierzig Schritten zögerte der Gutgekleidete nach dem Gong einen Augenblick, schien das Ziel verloren zu haben. Doch dann flog der Pfeil davon und traf wieder knapp die Scheibe. Beide waren sehr guten Schützen, aber es stand außer Frage: der Waldläufer würde gewinnen. Bei hundertfünfzig Schritten geschah jedoch etwas, das alle Zuschauer überraschte. Der Pfeil des geckenhaften Mannes traf, während der des hageren knapp am Ziel vorbeiflog. Lachend strich der Adlige die Siegprämie von einem Goldstück ein, während der Zweitplazierte nur zehn Silberstücke erhielt. Trotzdem gratulierte er dem Sieger höflich und klopfte ihm auf die Schulter.
Traigar trottete enttäuscht davon. Er hatte natürlich zu dem grimmigen Waldläufer gehalten, wie alle Leute vom einfachen Volk. Adlige waren bei ihm nicht sonderlich beliebt.
Im Schatten eines Lagerhauses ließ er sich nieder und aß seinen Apfel, als der Waldläufer ein paar Schritte entfernt an ihm vorbei schlenderte, ohne den Jungen zu bemerken. Der Mann biss gerade auf eine Goldmünze, dann warf er sie grinsend in die Luft und steckte sie ein.
Erst als er verschwunden war, erkannte Traigar, das Bogenschießen war ein abgekartetes Spiel gewesen. Der Waldläufer hatte den anderen gewinnen lassen! Ruhm und Ehre gegen ein Goldstück, das er zwar auch durch einen Sieg hätte einstreichen können, aber ein zusätzlicher Beutel mit Silber versüßte ihm den zweiten Platz. Jetzt musste auch Traigar grinsen.
Den ganzen Vormittag über zog er herum, besichtigte die Stadt, schaute bei Wettkämpfen zu und unterhielt sich mit Schaulustigen. Am Mittag kehrte er in die ‚Gespaltene Tanne’ zurück, wo schon wieder emsiges Treiben herrschte. Er bestellte ein gebratenes Hühnchen mit Süßwurzelgemüse und Brot, trank ein Bier dazu und nötigte Myra gegen ihren Widerstand eine Bezahlung auf. Dann zog er seine inzwischen trockene Kleidung wieder an.
Als er wieder in die Gaststube trat, stellte ihm Myra ihre Kinder Gila und Garet vor. Das Mädchen betrachtete ihn mit großen Augen, als sie ihn in seiner bunten Gauklerkluft erblickte. Fitz hatte ihr von den Kunststücken erzählt, die Traigar beherrschte, und so führte er zur großen Freude der beiden einige Zaubertricks vor und jonglierte zum Abschluss mit drei Glaskugeln. Der kleine Garet hielt sich dabei an den Fransen seiner Hose fest, lachte brabbelnd und haschte immer wieder vergeblich nach den Kugeln, die über ihm in der Luft kreisten.
Den Nachmittag verbrachte Traigar bei den Bolders und half beim Bierausschank. Der Wirt bot ihm an, auf unbestimmte Zeit zu bleiben und gegen freie Kost und Logis jeden Abend einige Vorstellungen zu geben. Traigar versprach, es sich zu überlegen.
Inzwischen war der Abend angebrochen, und er verabschiedete sich von Bolder, seiner Frau und den Kindern. Er wollte aber nach dem Wettbewerb zum Gasthaus zurückkehren, um dort zu feiern, falls er einen der ersten drei Plätze belegte.
Als er sich auf den Weg zum Marktplatz machte, wo er bald gegen die anderen Jongleure antreten sollte, dachte er über Bolders Angebot nach. Schon all zu lange nicht mehr hatte er das Gefühl erlebt, irgendwohin zu gehören. Ein Jahr zuvor hatte er den Wanderzirkus – sein zweites Zuhause nach Stonewall – verlassen. Die Artisten, Narren und Gaukler waren seine Freunde, ja seine Familie gewesen. Es fiel ihm sehr schwer fortzugehen. Aber er hatte keine Wahl. Nirgendwo konnte er lange bleiben, nie seine Gabe auf Dauer verbergen. Er betrachtete sie als Fluch, der ihn bei den Menschen verhasst machte. Selbst sein Vater hatte ihn ihretwegen verstoßen. Und deshalb konnte er auch hier nicht lange bleiben. Traigar seufzte. Vielleicht könnte er ein paar Tage, ein paar Wochen lang so etwas wie eine Familie haben. Bolder und Myra könnten ihm die Eltern ersetzen, und Fitz würde der Bruder sein, den er nie gehabt hatte. Aber je länger er blieb, desto schwerer würde ihm die Trennung fallen. Nein, entschied er, morgen würde er sich wieder auf den Weg machen, mit oder ohne Siegespreis.
Endlich erreichte er den Marktplatz, wo eine hölzerne Bühne stand. Der Wettkampf der Kraftathleten hatte schon begonnen. Muskelberge von Männern stemmten schweißüberströmt Gewichte oder übten sich im Armdrücken. Er trat vor einen der Offiziellen, nannte seinen Namen, und der Mann hakte ihn auf einer Liste ab. Allmählich überkam ihn Lampenfieber. Er wartete voller Ungeduld.
Es war dunkel geworden. Der Marktplatz erstrahlte gleichwohl im Licht zahlreicher, auf Masten errichteter Öllaternen. Auf dem Podest der Artisten hatte man zusätzliche Pechfackeln entzündet, und vier große, mit Kupferspiegeln ausgerüstete Lampen leuchteten die Bühne aus. Sechs Jongleure boten nacheinander ihre Kunst dar. Traigar musste zugeben, sie zeigten sehr gute Leistungen. Gerade schwoll der Beifall für Aganar zu einem Orkan an. Der Mann verbeugte sich lächelnd und nahm einen kräftigen Schluck aus einem seiner Weinkrüge, die er vorher durch die Luft geschleudert hatte, ohne einen Tropfen zu verschütten. Und nun war Traigar als Letzter an der Reihe. Ein Kampfrichter verlas seinen Namen und winkte ihn auf die Bühne. Jetzt stand er allein da oben und blinzelte geblendet in die dunkle Zuschauermenge. Er suchte nach vertrauten Gesichtern, hoffte Cora, Boc und Fitz zu entdecken, aber die Menschen hinter den ersten Reihen erschienen ihm wie gesichtslose Schemen. Tief atmete er durch und konzentrierte sich. Dann nahm er drei apfelgroße, polierte Glaskugeln, in denen glänzende Metallsplitter eingeschmolzen waren, aus seinem Beutel. Sie blitzten und funkelten im Licht der Lampen. Er hörte das Murren der Menge, die wohl annahm, er wolle damit bloß jonglieren. Aber er setzte eine Kugel auf die Spitze seines linken Zeigefingers und versetzte sie mit der Rechten in eine schnelle Umdrehung. Dann legte er eine zweite oben drauf und gab ihr einen Drall in die andere Richtung. Mit der dritten machte er es ebenso. Die Kugeln bildeten eine wirbelnde, lichtfunkelnde Säule auf seinem Finger. Er hörte die Zuschauer raunen. Seine rechte Hand berührte die oberste der rotierenden Kugeln; sie glitt von den anderen herunter, über seinen rechten Unterarm, am Ellenbogen hinauf bis zur Schulter. Dort verharrte sie, immer noch in schneller Rotation. Der obere der beiden übrigen Bälle sprang wie von selbst auf den linken Unterarm und rollte gleichfalls – scheinbar gegen die Gesetze der Schwerkraft – bis zur linken Schulter hinauf. Mit einem kurzen Schnicken seines Handgelenks warf er die dritte Kugel in die Luft und fing sie, den Kopf in den Nacken gelegt, mit der Stirn auf. Alle drei kreiselten immer noch unvermindert, wie von einer inneren Kraft in Drehung versetzt. Traigar nahm weitere Glaskugeln aus seinem Beutel, gab ihnen ebenfalls einen Drall und ließ sie von den Fingerspitzen über die Arme bis zu ihrer neuen Position gleiten. Am Schluss waren es neun: eine auf der Stirn, zwei auf den Schultern, vier auf den zu beiden Seiten ausgebreiteten Armen und zwei auf den Fingerspitzen. Alle drehten sich rasend schnell und blitzten im Licht der Fackeln auf. Eine Frau kicherte, doch sonst vernahm er keinen Laut mehr. Das Gemurmel und Raunen war verstummt. Er hatte sie in seinen Bann geschlagen. Aber das war erst der Anfang.
Er beugte sich vor, und die Kugel auf seiner Stirn passte sich seiner Bewegung an, rollte über seinen Kopf, seinen Nacken bis auf den Rücken. Aus dieser Position, mit waagerechtem Oberkörper, richtete er sich nun langsam wieder auf. Die immer noch heftig rotierende Kugel rollte sanft an ihm herunter, auf einem Weg, der sich spiralförmig um seinen Leib wand, um seinen rechten Ober- und Unterschenkel, bis sie schließlich auf der Fußspitze verharrte. Nun begann der gläserne Ball auf seiner rechten Schulter wie von selbst eine ähnliche Reise – hinab zum anderen Fuß; und während er noch unterwegs war, verließ auch die Kugel auf der linken Schulter ihre Position und machte sich auf den Abstieg. Bald bewegten sich alle Kugeln nach unten. Sie schraubten sich langsam um seinen Körper, als wären sie die sichtbaren Teile einer sonst unsichtbaren Schlange, die an ihm herab kroch.
Traigar hob das rechte Bein und beugte es. Mit einer schnellen Bewegung schleuderte er den Glasball von seiner Fußspitze nach oben und fing ihn mit der Stirn auf. Die Kugel auf seinem linken Fuß folgte auf die gleiche Weise. Sie landete dort, wo ihre Reise den Anfang genommen hatte: auf der rechten Schulter. Nun ging alles sehr schnell, und die Zuschauer konnten kaum mit den Augen folgen: Unablässig trafen wandernde Kugeln auf seinen Fußspitzen ein und flogen wieder empor zu ihrem Ausgangspunkt, wo sie ihre Wanderung erneut begannen. Traigar war eingehüllt von glitzernden Bällen, die wie eigenständige Wesen über seinen Körper krochen und dann aufflogen, um sich wieder auf ihm niederzulassen wie schillernde Taufliegen, die sich nicht verscheuchen ließen. Die Vorstellung lief wie von selbst. Eine Art Trance überkam ihn, und seine Gedanken schweiften zurück in seine Kindheit. Er erinnerte sich daran, wie er die Gabe zum ersten Mal bewusst angewendet hatte:
Er ist drei Jahre alt, als ihn der Wunsch befällt, mit dem prächtigen Dolch seines Vaters, der an der Wand hoch über ihm hängt, zu spielen. Die Waffe ist mit Nägeln befestigt und außerhalb seiner Reichweite. Da stellt er sich vor, wie die Nägel Stück für Stück aus dem Holzbalken herausrutschen, einer nach dem anderen. Und so geschieht es. Er muss sich anstrengen, aber es gelingt ihm. Mit beiden Händen gegen die Wand gestützt, blickt er hinauf und konzentriert sich auf die Waffe. Einer der Nägel ist widerspenstig. Doch mit einem Ruck fliegt er heraus, quer durchs ganze Zimmer, und der Dolch fällt herab, streift fast sein Gesicht und bleibt knapp neben seinem Fuß im Boden stecken. Erschrocken schreit er auf. Als sein Vater, der draußen beim Holzhacken gewesen ist, in den Raum stürzt, lehnt Traigar weinend an der Wand. Der Vater tröstet ihn, und nachdem sein Sohn sich wieder beruhigt hat, betrachtet der Mann stirnrunzelnd die Löcher im Balken, sucht die Nägel und findet sie verstreut herumliegen. Noch nie zuvor hat der Junge seinen Vater so ratlos gesehen.
Ein halbes Jahr später: Traigar hat die Gabe wie selbstverständlich angenommen. Noch weiß er nicht, dass sie böse ist und ihn brandmarken wird. Eine Ahnung davon bekommt er erst, als er mit Kieselsteinen spielt und probiert, wie viele er gleichzeitig in der Luft schweben lassen kann. Er sitzt draußen vor der Schule, während sein Vater, der als Lehrer arbeitet, die älteren Kinder des Dorfes unterrichtet. Unerwartet öffnet sich die Tür des Schulhauses, und sein Vater tritt heraus. Traigar hört erst seinen erstickten Aufschrei, bevor er ihn sieht. Er fährt zusammen, und alle Steine purzeln zu Boden. Noch viel mehr erschrickt er aber, als er Vaters Gesicht erblickt. Kreidebleich ist es und voller Angst und Zorn.
Traigar achtet das Verbot, doch er versteht es nicht. Warum soll es schlecht sein, mit Kieseln zu spielen? Also lässt er keine mehr schweben. Er hat ein neues Spiel entdeckt: Er formt Kugeln aus Wasser und lässt sie über den Tisch rollen, ohne ihn nass zu machen. Natürlich demonstriert er es auch seinen Freunden.
An diesem Tag kommt eine Abordnung wütender Eltern zu seinem Vater, und der verabreicht ihm am Abend die schlimmste Tracht Prügel seines Lebens.
Später, als sein Sohn älter ist, versucht es der Vater Traigar zu erklären und erzählt ihm, der Name der Begabung laute Magie, und sie sei keine Gabe, sondern ein Fluch. Der Junge versucht dann wirklich, damit aufzuhören, und es gelingt ihm auch für einige Jahre. Aber der Drang, Magie anzuwenden, ist übermächtig, und er tut es wieder in aller Heimlichkeit. Oft schleicht er sich allein in die Wälder oder eine dunkle Berghöhle und gibt dem Bedürfnis nach. Er wird besser und besser.
Als er vierzehn Jahre alt ist, geschieht das Unvermeidliche. Im Dorf hat man ihm nie vergessen, dass er die Magie beherrscht, wenn er es auch schon seit Jahren nicht mehr offen gezeigt hat. Eines Tages, als er aus dem Wald zurückkommt, lauern ihm drei halbwüchsige Jungen auf – älter und stärker als er. Sie verlangen eine Kostprobe seiner Kunst. Als er sich weigert, verprügeln sie ihn. Er hofft, sie würden ihn danach gehen lassen, aber sie fesseln und knebeln ihn, dann lassen sie die Hosen herunter und urinieren auf ihn. In diesem Augenblick packt ihn brennende Wut. Er schleudert sie durch die Luft; einer bricht sich ein Bein, als er gegen einen Baumstamm prallt. Danach löst Traigar seine Fesseln und geht nach Hause.
Am nächsten Tag setzen die Dorfbewohner seinem Vater ein Ultimatum. Binnen einer Woche habe sein Sohn, der Hexer, zu verschwinden. Der Lehrer verlässt danach das Dorf, ohne Traigar zu erklären, warum. Nach drei Tagen taucht er wieder auf, packt ein Bündel für Traigar und nimmt ihn mit. Sie steigen hinab ins Tal. Traigar ist hundeelend zumute. Er weiß, er wird fortgeschickt. Doch seinem Vater geht es noch schlechter. Er weint die ganze Zeit. Dann ringt er seinem Sohn das Versprechen ab, seine Gabe nie wieder gegen Menschen einzusetzen und sie zu verbergen, so gut es geht. Ein bisschen lächelt er, als er ihm verspricht, ihn zu einem Ort zu bringen, wo er nicht ganz auf Magie verzichten müsste. Im Tal gebe es eine kleine Stadt, und dort habe ein Wanderzirkus sein Zelt aufgeschlagen.
Tatsächlich bietet der Zirkus dem Jungen die Möglichkeit, seine Gabe frei und doch im Verborgenen zu gebrauchen. Sein Vater hat ihn dort in die Lehre gegeben, und Traigar hat gute Lehrer: einen Jongleur, einen Taschenspieler und einen Zauberer. Natürlich wenden Zirkuszauberer keine echte Magie an; es sind Illusionisten. Aber Traigar erlernt bei vorsichtigem Gebrauch seiner Magie die Tricks schneller und kann sie bald besser ausführen als seine Lehrer.
Mit dem Zirkus kommt er viel herum, und so erfährt er ein wenig über die Magie. Es hat Magier gegeben, so erzählt man ihm, viele Jahrhunderte früher. Doch sie waren böse und haben ihre Macht für abscheuliche Ziele missbraucht. Zu unserem Glück, so sagen die Leute, sind sie ausgestorben. Andere meinen, es gebe auch heute noch Magier, aber man dürfe sich nicht auf sie einlassen, und am besten sollte man sie totschlagen, wenn man sie entdeckte. Es wird ihm klar: Die Menschen haben eine furchtbare Angst vor der Magie, und der Ratschlag seines Vaters, die Gabe zu verbergen, ist ein guter. Traigar fragt sich, warum er mit ihr geboren wurde. Was hat er getan, um so bestraft zu werden?
Diese Gedanken gingen ihm während seiner Vorstellung durch den Kopf, und schlagartig begreift er, dass er heute vielleicht viel zu weit ging. Noch nie hatte er die Magie so offensichtlich eingesetzt. Würde man ihn auf einem Scheiterhaufen verbrennen? Warum verhielt sich die Menge so still? Zum Schein ließ er eine der schwebenden Kugeln fallen und lächelte verlegen, so als ob ihm eine Ungeschicklichkeit passiert sei.
Als er mit seiner Vorstellung fortfuhr, musterte er die Zuschauer in den ersten Reihen und versuchte, an ihren Mienen abzulesen, ob sie seine Gabe erkannt hatten. Doch er konnte nur Bewunderung und großäugiges Staunen darin entdecken. Sie schienen nach wie vor zu glauben, es handele sich bei seinen Tricks um manuelle Geschicklichkeit und Täuschung des Auges. Aber dann fiel sein Blick auf ein Mädchen in der zweiten Reihe. Sie mochte vielleicht in seinem Alter sein und war recht hübsch. Ihr wissendes Lächeln verunsicherte ihn.
Die nächste Stunde verflog wie im Traum. Nach der Vorstellung fand er sich in der Menge wieder. Jeder wollte mit ihm sprechen. Er hörte Komplimente, und man klopfte ihm auf die Schulter. Ein heftiger Schlag traf ihn, der nur von Boc stammen konnte. Cora schloss ihn in die Arme, drückte ihm einen Kuss auf die Wange und beglückwünschte ihn. Nach kurzer Beratung erklärte ihn das Komitee der Offiziellen zum Sieger des Jongleurwettstreits, und er erhielt eine Urkunde und ein Goldstück, das er in seinen Geldbeutel steckte, den er jetzt an einem Riemen um den Hals trug, verborgen unter seinem Hemd. Er unterhielt sich, immer noch benommen und trunken vor Glück, mit dem Schmied und der Heilerin, als der Wettstreit der Feuertänzer begann, doch er sah gar nicht hin. Plötzlich verspürte er eine seltsame Empfindung, so als ob ihm jemanden sachte auf den Nacken blies. Er wollte sich umdrehen, aber Cora, die ihn auf etwas aufmerksam machte, das sich gerade auf der Bühne abspielte, lenkte ihn ab. Wieder war die Menge ganz still geworden. Dort oben stand das Mädchen mit dem wissenden Lächeln und ließ Flammen tanzen. Ihm blieb fast das Herz stehen. Er erkannte sofort, was die anderen nicht sahen. Sie beherrschte die Magie!
Die junge Frau bot schier Unglaubliches: Aus ihrer Handfläche schraubten sich spiralförmige Flammen empor. Farbige Funken entstanden aus dem Nichts, Feuerbälle explodierten. Zum Abschluss ihrer Vorstellung hüllte sie sich in einen Vorhang roter, gelber, blauer und grüner Flammen und schien zu verbrennen. Als die Flammen erloschen waren, war sie verschwunden! Doch dann erblickte er sie ein paar Schritte weiter am Rand der Bühne. Die Menge feierte sie frenetisch, noch mehr als sie vorher ihm applaudiert hatte. Er versuchte, sich nach vorne zu drängen, um mit ihr zu sprechen, doch er kam kaum durch das dichte Zuschauerspalier. Als er endlich die Bühne erreichte, konnte er sie nicht mehr entdecken. Er fragte einen Schiedsrichter nach ihr. Sie habe ihr Goldstück genommen und sei sofort danach gegangen, erwiderte der kopfschüttelnd.