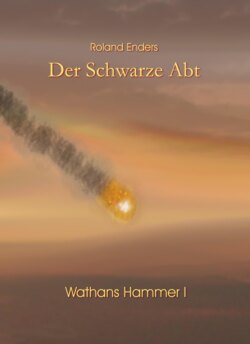Читать книгу Der Schwarze Abt - Roland Enders - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweikampf
ОглавлениеEr blieb noch drei Tage in Shoal. Bolder und Myra versuchten vergeblich, ihn zum Bleiben zu überreden. Boc und Cora traf er nicht wieder, ebenso wenig wie das geheimnisvolle Mädchen, das – und da war er sich ganz sicher – mit ihm den Fluch der Magie teilte. Sie war der einzige Mensch weit und breit, mit dem er offen und ohne Furcht vor Verfolgung und Ausgrenzung reden konnte, erkannte er. Er sehnte sich nach einem Gespräch mit ihr und beschloss, sie zu suchen. Immer und immer wieder wanderte er durch die Straßen der Stadt und hielt Ausschau nach ihr. Schließlich gestand er sich ein: Sie musste Shoal verlassen haben. Und so zog er am selben Nachmittag gleichfalls los. Er hatte keine Ahnung, welchen Weg sie eingeschlagen haben könnte, deshalb folgte er einfach der Straße, die nach Inay, der Hauptstadt Koridreas, führte.
Nach ein paar Stunden zog die Dämmerung herauf. Die Straße, der er folgte, führte durch einen hügeligen Wald. Die letzte Begegnung mit Reisenden lag schon eine Weile zurück. Die meisten hatten wohl schon Gasthäuser aufgesucht, doch er war es gewohnt, unter freiem Himmel zu schlafen. Jetzt besaß er zwar genug Geld, um sich eine leckere Mahlzeit, ein Bier und ein Bett leisten zu können, aber hier schien weit und breit kein Gasthof zu sein. Vor einer Stunde war er an einem Bauernhof vorbei gekommen, verspürte aber wenig Lust, dorthin zurückzulaufen. Myra hatte ihm zwei Schläuche mit Wein und Wasser, einen Laib Brot, sowie Käse und Hartwurst eingepackt, und so machte er es sich unter einem Baum gemütlich, aß und trank und dachte wehmütig an seine Freunde. Der Wein machte ihn müde, und bald schlief er tief und fest.
Es ist ein bitterer Sieg, der einzige, den er in diesem Feldzug erlebt hat, und gleichzeitig die schlimmste Niederlage für die Menschlichkeit. Der Krieg neigt sich dem Ende zu. Der Anfang vom Ende kam vor fünf Monaten, als die Truppen von Koridrea zum Gegenschlag ausholten. Sie marschierten nach Orinokavo ein und drängten die kaiserliche Armee, deren Soldaten jetzt von Eroberern zu Verteidigern geworden sind, überall zurück. Seine Einheit befand sich auch auf dem Rückzug, gehetzt von den feindlichen Soldaten, doch dann entschlossen sich die Gejagten, bittere Rache zu nehmen. Weit abseits von der Front drangen sie über die Berge ins Feindesland ein und überfielen ein strategisch völlig unwichtiges Dorf. Etwa fünfzig koridreanische Grenzer bewachten es, und ebenso viele männliche Dorfbewohner stellten sich ihm und seinen Kameraden entgegen, aber sie waren schlecht gerüstet und nur mit Mistgabeln und Sensen bewaffnet. Gegen die sechsfache Übermacht der Soldaten seiner Einheit hatten sie keine Chance.
Nach der Schlacht zündeten die Soldaten aus Orinokavo das Dorf an und warteten. Die meisten der in den Kellern und Scheunen versteckten Frauen und Kinder schafften es nicht. Ihre furchtbaren Schreie stachelten den Blutrausch vieler seiner Kameraden noch mehr an. Sie schlachteten die wenigen Kinder, die den Flammen entkamen, ab und vergewaltigten ihre Mütter. Er ist dabei gewesen, unfähig, sich an dem Morden und Schänden zu beteiligen, ebenso wenig, wie dem Frevel Einhalt zu gebieten. Eine mutige und verzweifelte Minderheit aus seiner Einheit hat versucht, sich gegen die menschlichen Bestien aus den eigenen Reihen zu stellen; auch sie sind jetzt tot. Er selbst hat die Raserei überlebt, weil er zu feige gewesen ist, diesem Wahnsinn entgegenzutreten.
Jetzt geht er wie benommen durch die rauchenden Ruinen. Ein geköpfter Säugling liegt im Rinnstein. Raben hacken nach dem Schädel des Kindes, streiten darum, und der Kopf rollt hin und her. Eine Frau kriecht wimmernd durch den Staub und lässt eine Blutspur hinter sich. Bevor er sie erreicht, erschlaffen ihre Muskeln, und ihre Augen brechen. Sie ist tot. Leichen überall. Er wandert weiter, erreicht das unübersichtliche Gelände außerhalb des Dorfes, wo er sich während des Gefechts versteckt hat, um dem Massaker zu entgehen. Einer der koridreanischen Grenzer liegt da. Es ist der, den er selbst getötet hat. Vor seinem inneren Auge wiederholt sich das Geschehen, das sein Leben verändern wird:
Der Mann überraschte ihn, als er sich absetzen wollte, und ging voller Wut auf ihn los. Der Grenzer kämpfte tapfer und verzweifelt, war ihm aber unterlegen und sah den Schwertstoß nicht kommen, der ihn unterhalb des Brustbeins durchbohrte. Er drückte den Sterbenden mit seinem Stiefel auf den Boden und zog sein Schwert aus seinem Körper. Dann wollte er vom Ort der Schlacht fliehen, aber seine Beine gaben nach, und wie gelähmt sank er neben seinem Feind auf die Knie.
Dessen Sterben dauerte lange, und er war nicht fähig gewesen, den Mann zu verlassen. Verborgen durch Büsche und Felsen hörte er das Prasseln der Flammen und das Krachen der zusammenbrechenden Häuser, die Triumphschreie seiner Kameraden und die um Gnade flehenden Opfer, roch das Blut und den Rauch. Der anklagende Blick des Sterbenden, voller Angst, Schmerz und Wut, durchbohrte ihn und schmerzte ihn mehr als die unbedeutende Schwertwunde, die er während des Kampfes erlitten hatte. Die lautlos murmelnden Lippen – verfluchten sie ihn? Er merkte gar nicht, wie ihm Tränen über das Gesicht strömten und er die Hand seines Feindes hielt, der ihm in diesem Augenblick näher war als seine so genannten Kameraden. Ihm war nicht bewusst, dass die gestammelten Worte der Verzweiflung und Scham, die an sein Ohr drangen, seine eignen waren. Dann veränderte sich der Blick des tödlich verwundeten Mannes. Prüfend musterte er ihn, seine Miene wurde weicher, als ob er nach einem Rest Menschlichkeit im Antlitz seines Mörders gesucht und diesen gefunden hätte. Dann sprach er mit verblüffend klarer Stimme und rang ihm ein Versprechen ab, bevor er sein Leben aushauchte. Er, der Soldat aus Orinokavo, hat geschworen, diesen letzten Wusch seines Feindes zu erfüllen. Warum? – Er weiß es nicht.
Die Soldaten seiner Einheit sind längst fort. Er hat sich versteckt, als sie abzogen, wollte nicht mehr zu ihnen gehören, war jetzt ein Fahnenflüchtiger. Dann ist er auf der Suche nach Überlebenden durch die Stätte des Gemetzels gewandert und steht nun wieder vor dem Leichnam, an den ihn ein Versprechen bindet. Vielleicht kann er etwas von dem Grauen wiedergutmachen, das er und seine Kameraden über dieses kleine Dorf gebracht haben. Noch einmal beugt er sich zu dem Toten hinab. Doch plötzlich reißt dieser die Augen auf, setzt sich mit einem Ruck auf, wobei ein Blutschwall zwischen seinen Lippen hervorquillt. Dann spürt er das Messer des Toten an seiner Kehle…
Traigar spürte den kalten Stahl an seinem Hals und wusste, er träumte nicht mehr. Beinahe wäre er mit einem Aufschrei aus seinem Alptraum hochgefahren, und nur äußerste Willensanstrengung bewahrte ihn davor. Er öffnete die Lider nur zu einem ganz schmalen Schlitz und sah eine Gestalt über sich gebeugt. Die Morgendämmerung hatte schon eingesetzt, und er erkannte einen zotteligen, verfilzten Haarschopf, einen schmutzstarrenden Bart, ein Gesicht voller Blutergüsse mit einer kaum verheilten und verschorften Narbe auf der rechten Seite und ein dunkles Auge, das ihn anstarrte. Die Höhle des anderen Auges war leer und vernarbt. Stinkender Atem schlug ihm entgegen. Vorsichtig, ja fast behutsam, schnitt der Mann den Lederriemen durch, an dem Traigars Geldbeutel um seinen Hals hing, erhob sich leise und verschwand. Der Junge blieb noch eine Minute still liegen, atmete tief durch und versuchte, sein rasendes Herz zu beruhigen. Dann stand er auf und griff nach seinem Dolch, doch die Scheide war leer. Der Räuber hatte sein eigenes Messer benutzt, um den Riemen zu durchtrennen. Er hätte ihm auch ohne weiteres die Kehle durchschneiden können.
Traigar hörte die Schritte des Mannes verklingen, als der sich entfernte. Er hatte die nördliche Richtung eingeschlagen. Der Junge folgte ihm schnell und leise. Bald entdeckte er die Gestalt weit vor sich. Der Räuber humpelte und kam nur langsam voran. Er war ein Riese, so groß wie Fitz, aber massiger und stärker. Plötzlich bog der Dieb nach links ab, in den Wald hinein. Traigar schlich vorsichtig bis zu der Stelle, an der der Mann den Weg verlassen hatte, und folgte ihm auf einem schmalen Wildwechsel. Zwischen den Bäumen hindurch schimmerte der Waldboden heller; dort schien eine Lichtung zu sein. Er schlug einen Bogen und näherte sich der Waldlichtung von der anderen Seite.
Da hockte er, auf einem umgestürzten Baumstamm! Traigar schlich sich heran, nutzte dabei die Deckung der Bäume und Büsche und achtete darauf, im toten Winkel des blinden Auges zu bleiben. Der Riese hatte den Beutel geöffnet und zählte grinsend das Geld. Traigar war wütend, doch nicht zornig genug dafür. Nein, er würde das Versprechen seines Vaters nicht brechen, er würde die Magie nicht mehr gegen Menschen anwenden. Der Kerl hatte den Beutel gerade neben sich auf dem Stamm abgelegt, reckte sich nun und gähnte. Traigar hob einen dicken, abgebrochenen Ast auf und warf ihn mit aller Kraft. Er traf den Räuber auf der Brust. Der keuchte erschrocken. Der junge Mann sprang hinter dem Baum hervor, der ihm als Deckung gedient hatte, schnappte sich seinen Geldbeutel und rannte davon. Er hoffte, der andere könne ihm mit seinem lahmen Bein nicht folgen. Doch er beging einen schwerwiegenden Fehler, als er im Laufen nach hinten blickte. Er stolperte über einen im Laub verborgenen Stein und fiel der Länge nach hin. Bevor er sich wieder aufraffen konnte, packte ihn der riesenhafte Kerl am Genick. Traigar schrie und versuchte, den Mann zu treten. Doch der kümmerte sich nicht um die unbeholfene Gegenwehr, drehte ihn herum und sprach:
„Keine Angst, ich tue dir nichts.“
Traigar hörte auf zu zappeln. Die schaufelgroße Hand hielt ihn immer noch eisern fest.
„Du bist ein mutiger Junge. Ich hätte nie geglaubt, dass du dich traust, mir zu folgen. Klar hab ich’s bemerkt: Du hast nicht mehr geschlafen, als ich dir den Beutel klaute. Eben hast du noch geträumt und unter deinen geschlossenen Lidern wild mit den Augäpfeln gerollt, und dann stehen deine Augen plötzlich still, und du hältst den Atem an. Du hast dich wirklich gut unter Kontrolle. Wie heißt du, und woher kommt das Geld? Das ist ein hübsches Sümmchen. Mehr als jemand wie du mit ehrlicher Arbeit verdienen könnte. Ich nehme mal an, du bist auch ein Dieb?“
Traigar, immer noch zitternd und kreidebleich, erzählte mit brüchiger Stimme, wie er das Geld beim Gauklerwettstreit gewonnen hatte. Der andere ließ sich alles genau berichten. Dann lächelte er und zeigte dabei ein lückenhaftes Gebiss gelber Zähne.
„Ich glaube, du sagst die Wahrheit. So eine Geschichte kann man nicht aus dem Stehgreif erfinden, wenn man vor Angst schlottert. Dann will ich dir auch von mir erzählen. Ich heiße Winger, und ich werde gejagt. Man nennt mich einen Gesetzlosen, doch vor meinem Gewissen bin ich das nicht, auch wenn ich dich beraubt habe. Ich bin auf der Flucht und habe seit drei Tagen nichts gegessen.“
„Was hast du getan?“
„Nichts, außer um meine Frau getrauert. Es gibt Leute, die behaupten, ich hätte sie umgebracht, doch das ist nicht wahr. Aber mehr musst du nicht wissen.“
Er schwieg einen Augenblick, dann fuhr er fort:
„Hör zu, Junge.“
Er ließ ihn aus seinem schraubstockartigen Griff los und fasste in den Geldbeutel, den er Traigar wieder abgenommen hatte.
„Es war unrecht von mir, dir alles zu nehmen. Ich werde mir die Kupfermünzen leihen. Das Goldstück und deinen Dolch gebe ich dir zurück. Ich hoffe, ich begegne dir eines Tages wieder und kann dann meine Schulden begleichen.“
Er drückte ihm die Goldmünze in die Hand und steckte den Dolch in Traigars Scheide.
„Und nun troll dich, bevor ich es mir anders überlege, und lass die Hand von deinem Messer.“
Der Mann, der sich Winger nannte, packte ihn an der Schulter, drehte ihn herum und gab ihm einen sanften Stoß.
Traigar war den ganzen Tag der Straße gefolgt, die durch ein breites, grünes Flusstal führte. Zu beiden Seiten erstreckten sich Getreidefelder – goldgelbe Meere, über die der Wind Wellen trieb, Wiesen mit den letzten Sommerblumen, saftige Weiden und Obstgärten mit Apfel- und Birnbäumen, die schon reife Frucht trugen. Der Südwesten von Koridrea war fruchtbar und reich, kaum zu vergleichen mit der kärglichen Armut des Ostens, wo er einst gelebt hatte.
Er genoss die warmen Strahlen der tief stehenden Sonne. Der Sommer neigte sich dem Ende zu, und nachts machte sich schon herbstliche Kühle breit. Letzte Nacht hatte er wegen der Kälte und des Alptraums schlecht geschlafen. Er fühlte sich müde, und die Füße taten ihm vom langen Wandern weh. Deshalb beschloss er, sich bald einen Lagerplatz zu suchen. Die Straße wand sich zunehmend steiler durch die Hügelkette, und schließlich verlief der Weg auf der Sohle einer engen Schlucht, die sich zu einem Kessel verbreiterte. In diesem Hohlweg wollte er nicht lagern und – nach der Begegnung mit Winger – schon gar nicht allein. Zwar hätte er sich gerne mit anderen Reisenden zusammengetan, aber den ganzen Tag über war er nur wenigen Fuhrwerken, Reitern und Wanderern begegnet, wovon die meisten in der Gegenrichtung, nach Shoal, unterwegs waren. Es schien also besser, solche exponierten Stellen zum Lagern zu meiden, denn möglicherweise waren nachts noch andere dunkle Gestalten unterwegs und hinter dem Hab und Gut – vielleicht sogar dem Leben – von einsamen Reisenden her.
Er kletterte die Böschung des Hohlwegs hinauf. Etwa zwanzig Fuß oberhalb erstreckte sich ein dichter Wald. In ihm, so überlegte er, wäre er sicher, jedenfalls vor menschlichen Räubern. Er hoffte, es gab hier keine gefährlichen Raubtiere. In einer kleinen Lichtung, nicht weit von der Bruchkante zum Hohlweg entfernt, häufte er ein paar Zweige und etwas Laub auf, um sich damit nachts zuzudecken. Doch zum Schlafen war es noch viel zu früh. Bis zum Sonnenuntergang dauerte es wohl noch zwei Stunden. Zunächst aß er von seinen Vorräten aus der Gespaltenen Tanne und trank ein paar Schlucke Wasser. Danach fischte er seine Glaskugeln aus dem Beutel und studierte ein paar neue Tricks ein. Bald war er dessen überdrüssig. Jetzt bedauerte er, sich nicht in Gesellschaft zu befinden. Er hätte sich gerne mit Cora, Boc oder den Bolders unterhalten. Alles, was ihn von den im Hintergrund lauernden Gedanken ablenken könnte, wäre gut. Doch unaufhaltsam drängten sie nach vorn, bis seine Ablenkungsversuche nicht mehr fruchteten.
Der Alptraum!
Er war wieder da. Traigar hatte gehofft, er sei ihn endlich losgeworden. Je weiter er sich von seinem Heimatdorf entfernte, desto seltener suchte er ihn heim. Doch jetzt quälte er ihn wieder, schlimmer als je zuvor.
Er kannte die Person, mit deren Augen er das Grauen erlebte: Vater! Traigar hatte diesen Traum von ihm geerbt. Daedor war nicht reich. Als Dorfschullehrer verdiente er gerade genug, um sich und seinen Sohn zu ernähren. Ihr kleines Haus besaß nur zwei Räume. Der eine diente als Vorratsraum, der andere zum Essen, Wohnen und Schlafen. Sie teilten sich das einzige Bett, und der Vater neben ihm träumte fast jede Nacht diesen Traum. Zu Anfang bekam Traigar nicht viel davon mit. Daedor wälzte sich schweißgebadet hin und her und murmelte Unverständliches. Nach und nach verstand der Junge das Gebrabbel immer besser. Sein Vater nahm ihn, ohne es zu wissen, mit in den Traum. Aus Worten formten sich Bilder der grausamen Erlebnisse. Der kleine Traigar empfand sie nicht länger im Wachsein, sondern träumte nun selbst, in seltsamem Einklang zu den nächtlichen Visionen Daedors. Doch er sprach nie mit ihm darüber. Stattdessen brachte ihn seine Großmutter, die Mutter seiner verstorbenen Mutter, auf die Spur, als er ihr von dem Traum erzählte. Sie war voll Mitgefühl mit ihrem Enkel und hoffte, der Alpraum würde verschwinden, wenn er die Ursache dafür erfuhr. Er rief sich jetzt ihre Erzählung wieder in Erinnerung:
Weißt du, mein Kleiner, dass dein Großvater im Krieg gefallen ist? Unser Land hat viele Kriege geführt, doch die meisten sind schon lange her. Aber der letzte liegt weniger als ein halbes Menschenleben zurück. Dein Großvater musste, wie viele andere, sein Land verteidigen. Damals machten uns Banden und versprengte Truppen aus Orinokavo zu schaffen, die in Koridrea einfielen, Nachschublinien überfielen oder Dörfer plünderten und die Bewohner massakrierten, während unsere Armeen weit im Feindesland operierten. Ich habe gehört, unsere eigenen Soldaten seien ebenso grausam gewesen. Frag mich nicht nach den Gründen des Krieges oder wer dafür verantwortlich war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dein Großvater bei der Grenzwache diente und ein Dorf weit von hier beschützen sollte. Soldaten aus Orinokavo überfielen dieses Dorf, und es passierte das Unbeschreibliche, das sich im Traum deines Vaters – und nun auch deinem – abspielt. Damals wusste ich noch nichts von diesen Ereignissen.
Mein Mann wurde vermisst. Eines Tages traf ein Kurier mit einem Pergament ein und verkündete auf dem Dorfplatz die Namen der Gefallenen. Der deines Großvaters stand auch auf der Liste.
Ein Jahr später tauchte ein Mann auf, ein Fremder, ja schlimmer: ein Ausländer aus Orinokavo, jenem Land, das uns überfallen hatte. Der König hatte gesiegt und dem Feind einen Friedensvertrag aufgezwungen, der ihn zwang, Wiedergutmachung zu leisten. Orinokavo zahlte einen hohen Preis für seine Eroberungsgelüste, aber Geld und Güter gingen allein an den König und die Fürsten. Wir, die diesen Krieg mit Blut bezahlt haben, bekamen nichts. Dann kam wie gesagt dieser Mann nach Stonewall. Er nannte sich Daedor. Er wolle Wiedergutmachung leisten , gab er an und bat darum, für uns arbeiten zu dürfen, bot sich als Lehrer an. Daedor, dein Vater, war hochgebildet. Später erfuhr ich, dass er studiert hat und ihm eine glänzende Karriere bevorstand, als der Krieg ihn aus seinem Leben riss und ihn fast zerstörte.
Die Dorfbewohner behandelten Daedor mit großem Misstrauen, als er sich in Stonewall niederließ. Bis heute trägt er den Beinamen ‚Der Fremde’. Er ist nie wirklich einer von uns geworden. Aber wir lernten ihn bald als guten Lehrer schätzen. Vorher hatte das Dorf keine Schule besessen, deshalb konnten nur wenige Kinder und noch weniger Erwachsene lesen und schreiben. Daedor baute das Schulhaus mit eigenen Händen auf, unterrichtete alle Kinder und auch viele der älteren Dörfler. Am Anfang nahm er keinen Lohn dafür, erhielt nur Kleidung und Essen.
Irgendwann lernte er meine Tochter kennen, schien sich in sie zu verlieben und warb um sie. Das Schicksal hat sie zusammengeführt, dachte ich. In Wahrheit war er nur wegen ihr nach Stonewall gekommen.
Etwa ein Jahr später heirateten sie. Ein Wendepunkt in seinem Leben, denn zum ersten Mal war er ein Teil unserer Gemeinschaft. Man misstraute ihm nicht mehr, doch wirkliche Freunde hat er nie bei uns gefunden. Deine Mutter wurde schwanger, und als sie dich gebar, starb sie im Kindbett. Ein harter Schlag für mich, aber für ihn war es noch viel schlimmer. Seine Trauer überwältigte ihn so sehr, dass ich meine eigene wegen des Mitleids für ihn weniger stark empfand. Irgendwann nach der Beerdigung, als alle Trauergäste gegangen waren, erzählte er mir alles. Du warst damals dabei, aber natürlich zu klein, um es zu verstehen:
Dein Vater war derjenige, der meinen Mann im Krieg getötet hat! Doch bevor dein Großvater starb, rang er Daedor das Versprechen ab, für seine Tochter zu sorgen. So kehrte dieser nach dem Krieg nicht in sein früheres, ihm jetzt sinnlos erscheinendes Leben zurück, sondern machte sich auf die Suche nach dem kleinen Ort Stonewall in Koridrea, um dort eine junge Frau zu finden und ihre Mutter unglücklich zu machen. Sehr traurig und voll bitterem Zorn war ich nämlich, als ich dem gegenüberstand, der zugab, meinen Mann getötet zu haben, aber unser gemeinsames Leid und die Pflicht, die er auf sich genommen hatte, um die Tat wieder gutzumachen, ließen mich ihm verzeihen.
Dein Vater ist ein guter Mensch, Traigar. Damals herrschte Krieg, und Krieg macht alle Menschen zu Bestien. Wenn er deinen Großvater nicht getötet hätte, wärest du nie geboren worden. Und da ich dich liebe, kann ich ihn nicht hassen.
Doch die Erzählung seiner Großmutter, die ihm die Mutter ersetzte, konnte weitere Alpträume vom Krieg nicht verhindern. Schlimmer noch: Mit den Jahren wurden sie zahlreicher und detaillierter. Dabei träumte er nicht nur von der Schlacht seines Vaters, er nahm an zahlreichen Gemetzeln teil, im letzten Krieg und in vielen davor, erlebte unvorstellbare Grausamkeiten, sah Tausende von verstümmelten Toten, schreiende Verwundete, geschändete Frauen, zerstückelte Kinder, brennende Städte, auf Flüssen treibende, aufgedunsene Leichen, unbeschreibliches Leid, Leid, Leid…
Er war in diesen Träumen selbst vielfach verwundet worden und gestorben, hatte seinen eigenen Schmerz und den anderer gefühlt. Er büßte damit für alle Verbrechen, die Menschen im Zeichen des Krieges begangen hatten, doch er wusste nicht, warum. Seine Großmutter glaubte, Gott sei barmherzig, doch so oft er ihn in seinen Gebeten auch um Gnade bat, er verschonte ihn niemals.
Gott – Wathan.
Nein, Traigar war nicht fromm, aber er glaubte an ihn. Der Kardenus aus der nächst gelegenen Stadt Soth, ein gesalbter Priester Wathans, besuchte ihr Dorf nur selten. Er schickte meist seinen Stellvertreter, den Sudenus, einen Laienprediger, der in dem kleinen Gotteshaus während der gemeinsamen Andachten die heiligen Rituale vollführte. Traigars Vater hatte seinen Sohn nicht im Glauben erzogen, er selbst betrat das Gebetshaus nie, aber Großmutter nahm den Jungen immer dorthin mit. Doch inzwischen zweifelte Traigar an seinem Glauben. Er fühlte sich unschuldig verfolgt.
Dieser Gedanke brachte ihn wieder auf Winger. Der Räuber hatte ihm erzählt, seine Frau sei ermordet worden und man jage ihn deshalb. Doch er behauptete, unschuldig zu sein. War dies ein weiterer Mensch, den Wathan in seiner Ungerechtigkeit verfolgte und leiden ließ? Oder hatte Winger nur den Schuldlosen gespielt? Das würde Traigar wohl nie erfahren.
Ein Geräusch lenkte ihn von seinen Gedanken ab. Hufschlag. Jemand kam den Hohlweg entlang geritten.
Gother zog an den Zügeln und brachte seinen Hengst zum Stehen. Ah, hier war die Stelle! Regungslos blieb er im Sattel sitzen und ließ sich von seiner Erinnerung noch einmal die Ereignisse der letzten neun Monate erzählen: Sein Herr hatte ihn als Spion in das Land des Feindes geschickt. Er sollte ihn finden, seine Pläne erkunden, dann zurückkehren und berichten. Nun hatte er eine lange und gefährliche Reise hinter sich, durch die vier Länder des Alten Königreichs, bis in den höchsten Norden. Orinokavo war mit Koridrea verfeindet, und Pheldae befand sich im Bürgerkrieg. Wilde Nomaden beherrschten Vulcor. Und alle Menschen in diesen Ländern hassten das reiche, dominante und politisch stabile Koridrea. Ein kluger Schachzug, sich nicht als dessen Bürger erkennen zu geben. Gother beherrschte die Landessprache von Pheldae sehr gut und die von Vulcor leidlich – beide, wie auch das Koridreanische, Derivate der Alten Sprache, doch in Orinokavo verständigte man sich in der ihm kaum vertrauten Zunge der südländischen Eroberer. Er geriet das eine oder andere Mal in brenzlige Situationen, aber die meisten Schwierigkeiten konnte er vermeiden, indem er nachts reiste und sich tagsüber versteckte.
Vier Monate dauerte der Ritt in den hohen Norden, wo sich Gerüchten zufolge der Feind seines Herrn aufhalten sollte. Und er spürte ihn schließlich auf. Dann erst begann der schwierige Teil: Er sollte herausfinden, was der Gesuchte vorhatte, ohne sich selbst zu enttarnen. Und so lauschte er den Gesprächen in den Wirtshäusern, achtete auf jedes Gemunkel, befragte viele Leute, bestach sie und verschwand wieder, bevor seine Neugier jemanden misstrauisch machte. Seine Ausbeute erwies sich leider als dürftig. Immerhin wusste er jetzt, wo der Feind lebte, für wen er sich ausgab, wie viele Gefolgsleute er hatte und dass zumindest keine unmittelbare Gefahr für seinen Herrn zu bestehen schien. Mit diesen Informationen machte er sich auf den Rückweg. Einige Tagesreisen später bemerkte er, wie ihn ein Reiter verfolgte. Er hielt sich gerade in Sichtweite, blieb stehen, wenn Gother sein Pferd zügelte, und nachts entdeckte Gother sein Lagerfeuer etwa eine Meile zurück. Zwei-, dreimal versuchte er erfolglos, seinen Schatten zu stellen. Einmal schlich er sich im Schutz der Dunkelheit an sein Lager, fand aber nur ein niedergebranntes Feuer. Der Mann schien ein Geist zu sein. Gother verlegte sich wieder darauf, nachts zu reiten und tat alles, um seine Spuren zu verwischen, und tatsächlich schien es, als habe er ihn abgeschüttelt. Doch als er Monate später die Grenze seiner Heimat erreichte, tauchte der Verfolger wieder auf. Da fasste Gother einen Plan. Er würde ihm auflauern, an einem Ort, wo er nicht ausweichen, sich nicht in Luft auflösen konnte. Dort hielt Gother noch eine Überraschung für den Mann bereit. Nun hatte er diese Stelle erreicht. Die Zeit war gekommen. Gother stieg ab.
Traigar schlich auf dem Bauch zur Kante des Hohlwegs und blickte hinab. Dort unten in dem kleinen Kessel stand ein Mann, der gerade die Zügel seines Pferdes, eines kräftigen Apfelschimmels, an einen Stein band. Danach nahm er einen Ledersack aus der Satteltasche, schüttete Wasser aus einem prall gefüllten Schlauch hinein und gab es seinem Pferd zum Saufen. Der Fremde, mittelgroß, breitschultrig, etwa Mitte dreißig, wandte Traigar sein sonnengebräuntes und bartloses Gesicht zu. Das aschblonde Haar fiel ihm bis auf die Schultern. Er war einfach gekleidet, sah mit seinen staubigen Sachen aus wie ein Reisender, der schon lange unterwegs war. Nachdem er sein Tier versorgt hatte, näherte er sich einem von der gegenüberliegenden Kesselwand herabgestürzten Felsblock. Mit aller Kraft stemmte er sich dagegen und wälzte ihn beiseite. Darunter erschien ein Loch. Der Mann bückte sich, nahm in Öltücher gehüllte Gegenstände heraus und wickelte sie aus. Traigars Augen weiteten sich vor Erstaunen, als er eine leichte Rüstung erkannte! Der Mann legte sie sich an: ein stählernes Kettenhemd, das ihm fast bis zu den Knien reichte, eine gepolsterte Lederhaube, die in eine Halsberge aus Kettengliedern überging, Arm- und Beinschienen, sowie einen offenen Helm mit Wangenflügeln und Nackenschutz, gekrönt von einem Helmbusch aus Adlerfedern. Über die Rüstung zog der Mann einen weißen Wappenrock, der in Rot mit einem stilisierten Tigerkopf bestickt war. Dann schnallte er sich noch einen breiten Gurt schräg um die Brust, an dem am Rücken die Scheide eines Langschwertes befestigt war. Der Ritter – so sah er für Traigar jedenfalls aus – zog das Schwert aus der Scheide, prüfte seine Schärfe und steckte es wieder hinein.
Er band sein Pferd los, stieg auf, wendete es in die Richtung aus der er gekommen war und rief mit lauter Stimme:
„Du kannst jetzt aus deinem Versteck herauskommen!“
Traigar, der glaubte, er sei gemeint, erschrak. Beinahe wäre er der Aufforderung gefolgt und hätte sich erhoben, als er erneut Hufschläge vernahm. Ein Reiter bog um die Ecke des Hohlwegs und lenkte sein Pferd in den Kessel.
Der Ankömmling trug ein schwarzes, in mehreren Lagen gebundenes Tuch auf dem Kopf, das sein Gesicht fast vollständig verhüllte, sowie einen langen, ebenso schwarzen Umhang, schwarze Reiterhosen und Stiefel. Auf dem Rücken hing ein mannslanger Stab, der auf beiden Seiten in zwei faustgroßen Kugeln endete, die aus poliertem Ebenholz zu bestehen schienen. Sein Rappe war kleiner und viel zierlicher als das großknochige Schlachtross des Ritters. Er schnaubte und tänzelte, als er das andere Tier erblickte. Ein kurzes Zusammenpressen der Schenkel seines Reiters genügte, um ihn still wie eine Statue stehen zu lassen.
Die beiden Reiter musterten einander. Schließlich ergriff der Mann in der Rüstung das Wort:
„Du verfolgst mich jetzt seit mehreren Monaten. Ich konnte dich niemals abschütteln. Ich kenne dich nicht. Was willst du von mir?“
Der andere machte eine lange Pause, bevor er mit einem starken ausländischen Akzent antwortete:
„Was ich will? Euch töten! Denn ich weiß jetzt, welcher Feind Euch geschickt hat, meinen Herrn auszuspionieren. Ihr tragt sein Wappen auf Eurer Brust. Doch er wird nie erfahren, was immer Ihr herausgefunden habt. Und mir scheint, Ihr wusstet, was Euch jetzt erwartet, denn Ihr habt Euch zum Kampf gerüstet.“
Der Ritter lachte:
„Schon komisch: Wir verfolgen offenbar aus den gleichen Gründen die gleichen Ziele. Auch ich will dich töten, damit dein Herr, der Feind meines Lords, nicht erfährt, wem ich diene. Du wirst es sicher als unehrenhaft empfinden, wenn ich das Gleichgewicht zu meinen Gunsten verändert habe. Ja, ich trage eine Rüstung, und ich bedaure, einen Mann töten zu müssen, der nicht ebenso gut bewaffnet und gerüstet ist wie ich. Aber meine Ehre hat hinter der Sicherheit meines Herrn zurückzustehen.“
„Ihr irrt Euch, wenn Ihr glaubt, mir dank Eures Kettenhemdes, Helmes und scharfen Schwerts überlegen zu sein. Verlasst Euch nicht darauf und seid auf der Hut.“
Beide Kontrahenten stiegen von ihren Pferden. Der Schwarzgekleidete sah sich um:
„Es ist wenig Platz hier und wir werden ihn brauchen. Wir könnten unsere Pferde verletzen.“
„Du hast recht“, stimmte der andere zu. Er gab seinem Apfelschimmel einen Klaps auf die Hinterhand, und der trottete davon, verschwand hinter der Biegung des Hohlwegs. Der Rappe folgte ihm. Die Männer waren nun allein.
„Bringen wir es hinter uns.“
Der Mann in der Rüstung zog sein Schwert, hielt es in der rechten Hand, während sein Arm locker an der Seite herabhing. Die Schwertspitze ruhte auf dem Boden. Der andere nahm seinen Kampfstab vom Rücken, löste die Schlaufen des Tragriemens und warf ihn beiseite, dann fasste er den Stab mit beiden Händen in der Mitte, blieb mit gespreizten Beinen vor seinem Gegner stehen und hielt dabei die Waffe in Kniehöhe vor.
Der Angriff des Ritters erfolgte überraschend. Aus dem Stand machte er einen Satz nach vorne, überbrückte dabei die Distanz von zwei Schritten und führte das Schwert gleichzeitig in einer bogenförmigen, geschmeidigen Bewegung zuerst zur Seite, dann hinter seinem Rücken nach oben und ließ es zuletzt wie eine Peitsche auf den Mann in Schwarz hinabsausen. Die Bewegung der Waffe war so schnell, dass Traigar nur ein sirrendes Blitzen wahrnahm. Wäre er an der Stelle des anderen gewesen, so hätte er den Hieb gar nicht kommen sehen und würde jetzt mit gespaltenem Schädel zu Boden sinken. Doch der Gegner des Ritters stand gar nicht mehr dort! Er war ebenso schnell zurückgesprungen, im Gleichklang mit der Bewegung des Angreifers. Dessen Schwert fuhr in den Boden. Der Überraschungsangriff war missglückt. Schnell zog der Mann in der Rüstung die Waffe wieder heraus. Nun umkreiste er seinen Gegner mit vorgestrecktem Schwert, leicht gebückt, den rechten Fuß vorgeschoben. Der andere blieb einfach stehen, hielt den Kampfstab lose in den Händen und folgte seinem Kontrahenten nur mit dem Blick. Erst, als dieser im rechten Winkel zu ihm stand, drehte er sich zu ihm herum.
Erneut griff der Ritter an, diesmal mit einem Stich. Doch auch der ging ins Leere. Wieder war der Schwarze unglaublich schnell seitlich ausgewichen. Bisher hatte er noch keinen Gegenangriff geführt, doch der erfolgte unmittelbar danach. Der Stab wirbelte durch die Luft und traf den Ritter mit einem Ende auf der Brust. Keuchend sprang dieser zurück. Dank seines Kettenhemds blieb er unverletzt. Der Kampf tobte weiter. Meist führte der Mann in der Rüstung die Angriffe, der andere sprang dann entweder zur Seite, oder wehrte die Hiebe und Stiche mit dem herumwirbelnden Stab, an dem das scharfe Schwert, ohne Spuren zu hinterlassen, abprallte, mühelos ab. Gelegentlich ging er zum Gegenangriff über, ließ den Stab so blitzartig durch die Luft sausen, dass der Ritter sein Schwert zur Abwehr kaum einmal rechtzeitig dazwischen bekam. Ein ums andere Mal traf ihn sein Gegner.
Der aschblonde Mann war ein ausgezeichneter Schwertkämpfer, seine Reflexe waren gut. Er war schnell, und seine Schläge besaßen Kraft. Doch er war seinem kleineren und körperlich schwächeren Gegner deutlich unterlegen. Es schien, als spiele der Schwarze mit ihm. Nach einer Weile hörte Traigar den Mann in der Rüstung keuchen. Seine Angriffe erlahmten bald. Immer wieder musste er sich mit der linken Hand den Schweiß von der Stirn wischen, damit er ihm nicht in die Augen lief.
Traigar ergriff unwillkürlich Partei für den Ritter, ohne zu wissen warum. Der andere schien ihm unheimlich. Sein Selbstvertrauen grenzte an Arroganz. Fast übernatürlich wirkte seine Kampfeskunst. In seiner schwarzen Kleidung und mit vermummtem Gesicht erinnerte er den Jungen an einen der Dämonen, von denen seine Großmutter ihm manchmal erzählte. Auch von edlen Rittern handelten ihre Geschichten, in denen man Gut und Böse immer klar unterscheiden konnte. Traigar bangte jetzt um das Leben des Ritters und beugte sich in seiner Aufregung weiter vor. Seine Brust lag auf der Kante des Steilhangs, der bis hinunter zum Hohlweg reichte.
Plötzlich ergriff der dämonenhaft wirkende Mann die Initiative. Mit einer blitzschnellen Körperdrehung wich er einem Angriff des Ritters aus, wirbelte herum, und ein einarmig geführter Rückhandschlag ließ das kugelförmige Ende des Stabes gegen den Helmbusch des Ritters knallen. Der Schlag traf sehr hart. Der Halteriemen riss, und der Helm flog vom Kopf. Wieder wirbelte der Stab herum und krachte diesmal dem Ritter gegen die Stirn. Der stürzte wie ein gefällter Baum um und blieb regungslos auf dem Rücken liegen.
Traigar schnappte nach Luft und beugte sich noch weiter vor. Im diesem Augenblick gab eine überhängende Erdscholle nach und löste sich. Der Junge stürzte mit dem Kopf voraus hinab und überschlug sich dabei. Seine Zirkusausbildung als Artist kam ihm jetzt glücklicherweise zugute: Reflexartig rollte er sich ab, als er nach zehn Fuß freiem Fall den Boden erreichte, und blieb in einer Staubwolke auf dem Rücken liegen. Als er den Blick hob, stand der Schwarzgekleidete mit erhobenem Stab über ihm. Und jetzt erblickte er zum ersten Mal das Gesicht unter der Kapuze und die dämonischen Zeichen darauf: Rotzackige Blitze, Dreiecke, Quadrate und seltsame Runen bedeckten die bleiche Haut, und die dunklen Augen wirkten glanzlos und tot. Panik brach über Traigar herein wie ein Sturm. Instinktiv reagierte er und setzte unbewusst seine Magie ein.
Mit einem Keuchen und weit ausgebreiteten Armen und Beinen flog der Mann rückwärts durch die Luft. Traigar vernahm ein grässliches Geräusch, das klang, als ob man einen toten Fisch auf einen Stein klatschte. Der Schwarzgekleidete war auf den Ritter gefallen. Die Spitze dessen Schwertes ragte aus seiner Brust. Für einen kurzen Moment erzitterte sein Körper, dann lag er still.
Stöhnend wälzte sich der Ritter unter dem Toten hervor, rollte die Leiche beiseite und stand auf. Dann zog er das Schwert aus ihrem Leib und kam zu Traigar herüber, der sich gleichfalls erhob. Der Junge zitterte am ganzen Körper, und sein Atem ging stoßweise. Was hatte er bloß getan? Einen Menschen mit Magie angegriffen! Aber hatte er denn eine Wahl gehabt? Der schwarze Kämpfer – wenn er denn überhaupt ein Mensch war – hätte ihm das Leben genommen, das stand doch außer Zweifel. Und nicht er, Traigar, hatte den Mann getötet, sondern der Ritter. Der Junge wusste bloß nicht: War der Schwarzgekleidete in das Schwert gestürzt, oder hatte der Ritter seinem Gegner die Waffe mit Absicht in den Rücken gebohrt? Doch eines – davon versuchte er sich zweifelnd selbst zu überzeugen – war klar: Traigar war am Tod des Mannes unschuldig. Oder doch nicht?
Der Ritter stand ihm nun gegenüber. Auf seiner Stirn prangte eine dicke Beule, und Blut lief ihm aus einer Platzwunde ins Gesicht. Er sprach Traigar an:
„Du hast mir das Leben gerettet, mein Junge. Ich danke dir. Doch wie hast du das gemacht?“
Traigar stotterte:
„Was meint Ihr, Herr?“
„Du weißt genau, was ich meine. Da fliegt ein ausgewachsener Mann plötzlich durch die Luft, direkt in mein Schwert!“
„Ich habe gar nichts gemacht, Herr. Ich bin nur … abgestürzt. Der … äh … Mann, muss sich erschrocken haben. Er hat wohl einen Satz rückwärts gemacht. Ich habe … äh … nichts damit zu tun.“
Der andere sah ihn zweifelnd an. Dann lächelte er.
„Deiner Kleidung nach bist du ein Gaukler, nicht?“ Traigar nickte. „Nun, ich habe in einem Landgasthof, in den ich gestern eingekehrt bin, Geschichten über einen Jungen gehört, der ein außergewöhnlich guter Jongleur sein soll. Er war einer der Sieger des Wettkampfs der Gaukler in Shoal. Wäre es möglich, dass du das gewesen bist?“
Traigar musste schlucken. „Ja, das war ich, Herr.“
„Wie heißt du? Wohin bist du unterwegs?“
„Mein Name ist Traigar. Ich habe kein besonderes Ziel. Ich muss mein Brot verdienen, Herr. In anderen Städten wird es auch Feste geben, oder vielleicht finde ich ja einen Gasthof, in dem ich gegen einen Lohn eine Weile meine Kunst zeigen kann.“
„Nun, Traigar, wenn du nichts Besonderes vorhast, kannst du mich ebenso gut begleiten. Ich bin dir etwas schuldig und denke, mein Herr sieht das genauso. Er wird erfreut sein, wenn ich ihm einen Gaukler bringe, der ihn nach dem Abendmahl aufheitert. Bei ihm kannst du dein Brot ebenso gut verdienen.“
„Darf ich fragen, wer Euer Herr ist?“
„Du wirst von ihm gehört haben. Es ist Lord Gadennyn, der Fürst von Shoala.“