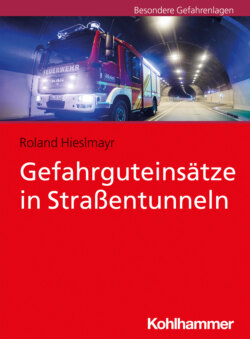Читать книгу Gefahrguteinsätze in Straßentunneln - Roland Hieslmayr - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[5]Vorwort
ОглавлениеDurch den immer weiter steigenden Verkehr auf der Straße, die Verbauung der Flächen und der daraus resultierenden Platznot in Städten sowie der verkehrsbedingten Abgas- und Lärmbelastung ist die Bestrebung der Gesellschaft, alternative Routenführungen bei Straßen in Erwägung zu ziehen. Eine Möglichkeit ist, den Straßenverkehr durch Tunnelbauwerke – sogenannte unterirdische Straßenverkehrsanlagen – zu führen.
Unterirdische Straßenverkehrsanlagen sind äußerst komplexe Bauwerke. Das beginnt bereits in der Planung, bei der man sich nicht nur mit dem Bau des Straßentunnels an sich, sondern unter anderem auch mit geologischen, technischen Gegebenheiten sowie hydrologischen und vielen weiteren speziellen Anforderungen auf höchstem Niveau beschäftigen muss. Der Betrieb einer Tunnelanlage ist nicht weniger aufwändig, wenn man z.B. die Lüftungssituation oder die Entwässerungssysteme betrachtet. Kommt es in diesem eingespielten System aus vielen hochkomplexen Komponenten zu einem Störfall, kann dies zu weitreichenden Folgen für die im Straßentunnel befindlichen Menschen – den Tunnelbenutzern – führen. Für die Einsatzorganisationen und dabei vor allem für die Feuerwehr sind hauptsächlich Interventionen bei Bränden, nach Verkehrsunfällen und bei Schadstoffeinsätzen zu nennen, welche intensiver Überlegungen bedürfen.
Viele längere Straßentunnel wurden vor und um die 1970er Jahre in Europa errichtet. Dabei war seitens der Planung die Ausrüstung der Tunnelanlage für den Betrieb ausgerichtet (lange Standzeit, Beleuchtung, Abgasabtransport etc.). Nach den großen Tunnelbränden (Tauerntunnel 1999, Mont-Blanc-Tunnel 1999 etc.) ist die Problematik von Tunnelbränden seitens der Behörden, der Einsatzkräfte, aber auch seitens der Errichter (Planer) von einem Randbereich (als nebensächlich erachtet) zu einem elementaren Thema in allen Phasen des Projektes (Planungs-, Bau- und Betriebsphase) geworden. 2004 ist die EU-Direktive 2004/54/EC für Mindestanforderungen in Bezug auf Sicherheitsanforderungen in Straßentunnelanlagen erlassen worden. Mit dieser Direktive wurde ein risikoorientierter Ansatz für den Bau, die Ausrüstung und die Nutzung von Straßentunnelanlagen ins Kalkül gezogen.
Die Themen des Brandes und der Verkehrsunfälle in Straßentunnelanlagen werden seitens der Feuerwehren seit Jahren sehr intensiv behandelt und sind bei guten Lösungsansätzen und teilweise auch Lösungen, die in Taktikschemen und Vorgangsweisen abgebildet werden, angelangt. Im Bereich der Vorgangsweise bei Vorhandensein von brennbaren oder nicht brennbaren Gefahrgütern und einem [6]möglichen Austritt von Gefahrstoffen ist allenfalls noch eine Weiterentwicklung und Anpassung von vorhandenem Wissen notwendig. Unter dem Begriff Schadstoffeinsätze können zudem auch Austritte von gefährlichen Stoffen aus Fahrzeugen mit alternativen Antrieben oder der Austritt von Kältemittel in Klimaanlagen von Tiefkühltransporten eingereiht werden. Bei einem sehr hohen Anteil an diesen Lkw-Fahrten mit gefährlichen Gütern werden Kohlenwasserstoffe (u.a. Benzin, Diesel, Heizöl etc.) transportiert.
Ein Unfall in einer Straßentunnelanlage kann zu weitreichenden Folgen für die Tunnelbenutzer wie auch für die Infrastruktur führen. Dabei gibt es Studien zur Risikoanalyse und diverse Ansätze aus bereits absolvierten Einsätzen, welche Grundüberlegungen zur Problemlösung bieten.
Neuere Risikoanalysen schließen nicht nur die Auswirkungen eines Schadensereignisses auf die Tunnelkonstruktion selbst ein – welche Schäden an der Tunnelausrüstung, Schäden am Tunnelbauwerk selbst oder auch Auswirkungen auf die Flucht der betroffenen Menschen haben können –, sondern auch die volkswirtschaftliche Bedeutung einer Tunnelanlage. Was bedeutet es für Betriebe, Anrainer (Menschen, die rund um die Tunnelanlage wohnen und diese täglich für Fahrten zur Arbeit und für das tägliche Leben nutzen), den Transitverkehr etc., wenn eine Tunnelanlage ausfällt und dadurch eine Passstraße oder eine weitreichende Umfahrung des Tunnels benutzt werden muss? Welche Risiken entstehen dabei auf den Alternativrouten, wenn z.B. ein mit gefährlichen Stoffen beladener Lastkraftwagen durch dicht besiedelte Orte fährt – anstatt durch einen Tunnel – und dabei verunfallt?
Als Einsatzleiter einer Feuerwehreinheit ist man stets bemüht, über umfassendes Wissen in allen nur erdenklichen Einsatzsituationen zu verfügen. Dabei steht Aus- und Fortbildung an oberster Stelle. Für die jeweilige Einsatzsituation wird die Werkzeugkiste »Wissen« geöffnet und alles darin Verwendbare zum Einsatz gebracht, um die jeweilige Einsatzanforderung bestmöglich lösen zu können.
Dieses Buch soll dabei unterstützen, eine Grundlage für ein Schema zu erarbeiten und einen wertvollen Beitrag zur positiven Absolvierung solch komplexer Einsatzsituationen leisten. Anhand von Beispielen soll auf die Eckpunkte eines Einsatzes in einer Straßentunnelanlage hingewiesen und spezielle Anforderungen aufgezeigt werden. Trotz aller Möglichkeiten (technisch, taktisch, personell etc.) sind auch Einsatzgrenzen vorhanden. In den einzelnen Kapiteln werden dazu zusätzlich Überlegungen zu speziellen Einsatzsituationen (z.B. Unfälle bei unkontrolliertem Vorhandensein von Explosivstoffen oder explosionsfähigen Atmosphären) angestellt. Dies erlaubt, bereits in der Einsatzvorbereitung (Vorplanung) darauf zu reagieren und sich Lösungsansätze zu überlegen. Dabei erlaubt sich dieses Werk keinen Anspruch [7]auf Vollständigkeit, sondern viel mehr Anregungen in allen möglichen Einsatzlagen zu geben. Ich wünsche Ihnen spannende Stunden beim Lesen dieses Buches.
Steinbach an der Steyr, Februar 2021
Roland Hieslmayr