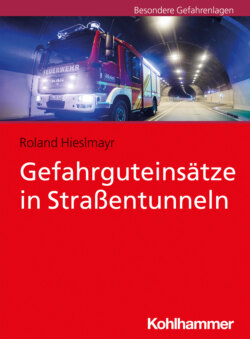Читать книгу Gefahrguteinsätze in Straßentunneln - Roland Hieslmayr - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Risiko
ОглавлениеDas Schutzniveau ist ein grundsätzlich von der Gesellschaft und des Weiteren von der Politik festzustellender Parameter. Aus diesem Schutzniveau lassen sich Fragen ableiten, die nicht einfach zu beantworten sind. Fragen wie z.B.
Was ist uns das Menschenleben wert und wieviel Ressourcen (Geld, Personal, Ausrüstung etc.) sollen eingesetzt werden, um es im Ereignisfall retten zu können?
Wie viele Tote pro Zeiteinheit und Längenabschnitt akzeptieren wir?
Die Liste der Fragen lässt sich beliebig erweitern, die Antworten bergen immer großes Diskussionspotenzial. Wo kann die Grenze zwischen wirtschaftlich vertretbar und gesellschaftlich akzeptabel gezogen werden?
Ab einem bestimmten Punkt muss von einem akzeptablen oder in Kauf genommenen Risiko gesprochen werden. Die akzeptierte Versagenswahrscheinlichkeit von Bauteilen, Bauprodukten, Ausrüstungsgegenständen, statisch relevanten Komponenten etc. gibt daraufhin den Punkt an, ab welchem dieses akzeptierte Risiko zum Tragen kommt. Tritt das Schadensereignis nicht ein, so wird dies als Zuverlässigkeit der verwendeten Elemente oder der Fahrzeuge und Benutzer von Bauwerken wie auch Tunnelbauwerken bezeichnet.
Sicherheit in technischen Systemen resultiert aus Schutzeinrichtungen und aus dem Fehlen von Gefahrenquellen (z.B. durch Ausschluss oder Vermeidung dieser). Durch die Festlegung diverser Maßnahmen und das Einhalten des Standes der Technik erfolgt die Bestimmung eines »Schutzgrades«, woraus sich das tolerable Risiko ableiten lässt. Dieses Risiko ergibt sich aus Kompromissen, Erfahrungen, verschiedenen Untersuchungen, Aufwand und Wirksamkeit von diversen Schutzmaßnahmen (vgl. Preiss/Struckl (2017), Seite 4 f.). Risiken sind in allen Lebenslagen vorhanden und werden nach der DIN ISO 31000:2011 (Seite 8) wie folgt definiert:
»Auswirkung von Unsicherheit auf Ziele«
Viele angewendete Elemente im Risikomanagement beinhalten Führungsaufgaben, die darauf abzielen, Menschenleben, Schäden, und diverse Folgen von bedrohlichen Situationen zu kontrollieren bzw. auf ein vertretbares Maß (gesellschaftlich und [16]wirtschaftlich) zu reduzieren. Eine vermeintlich sehr einfache Strategie zur kompletten Eliminierung von Risiken ist die Risikovermeidungsstrategie. Dabei werden so viele Probleme, Ursachen oder Risiken wie möglich ausgeschlossen. Dies basiert hauptsächlich auf organisatorischen Maßnahmen wie z.B. Erarbeitung von Richtlinien, Prozeduren, Durchführung von Schulungen, um Ereignisse erst gar nicht eintreten zu lassen. Die Vermeidung setzt einerseits auf die Tunnelstruktur (interne Organisation, Schulung eigener Mitarbeiter etc.) als auch auf den Tunnelnutzer (Wissensvermittlung in Fahrschulen, Aufklärungsprogramme zum »Verhalten in Tunnelanlagen im Ereignisfall« usw.). Die grundsätzlichen Elemente der Tunnelsicherheit sind sehr weitreichend. Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen viele Parameter wie der Verkehr, die Fahrzeuglenker, das Tunnelbauwerk, die elektrotechnische Infrastruktur oder auch die Intervention der Einsatzkräfte mitbetrachtet werden.
| Merke: Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit x Auswirkung |
Für jedes Einsatzszenario werden die Risiken empirisch ermittelt. Es liegen häufig viele Einflussfaktoren vor: Bauwerksparameter, Materialien, Ausstattung, Erfahrung vom Einsatzleiter, Passanten, Statistiken, taktische Vorgaben, Transportpapiere, Anweisungen, die Lage vor Ort, die Gefährdungsbeurteilung usw. Bild 2 zeigt dabei den Ablauf eines Risikoanalyseprozesses.
Bild 2: Risikoanalyseablauf [zurück]
Der Einsatzleiter durchläuft im Regelkreis die Risikoanalyse (siehe Bild 2) ständig und immer wiederkehrend. Zu beachten hat er unter anderem Risiken für Mensch, Tier [17]und Umwelt sowie die Risiken für die eigenen Einsatzkräfte – welche als direkte Risiken bezeichnet werden. Folgeschäden wie die Einwirkung auf die Infrastruktur, die Wirtschaft o.ä. werden als indirekte Schäden bezeichnet. Als dritte Gruppe sind die betrieblichen Risiken zu beachten. Fällt eine Tunnelanlage aus, müssen einerseits Instandsetzungsmaßnahmen konzentriert eingesetzt werden, andererseits entfallen Mautgebühren und großräumige Umfahrungen belasten die umgebende Straßeninfrastruktur (Menge an zusätzlichem Verkehr wie auch Schadstoffe, Unfallgefahren etc.). Diese Risiken werden durch verschiedene Management-Analysetools in langwierigen Verfahren ermittelt und in Folge werden nach einer Bewertung daraus Maßnahmen abgeleitet. Dabei unterscheidet man zwischen Risikoverhinderung, Risikominderung und Risikoakzeptanz.
Maßnahmen zur Minderung des Risikos
In allen Lebenssituationen bestehen Risiken für Mensch, Tier und Umwelt. Durch vielerlei Maßnahmen kann man das auftretende Risiko beeinflussen und dieses auf ein gewünschtes Niveau bringen, indem
alle nicht vertretbaren Risiken entfernt werden (Risikominderung).
ein Zustand als gefahrenfrei angesehen wird (Risikoverhinderung).
das verbleibende Risiko akzeptiert wird (Risikoakzeptanz).
Um ungewünschte Betriebszustände (Störungen in der Technik, Hilfeleistungen (Pannen), Verkehrsunfälle, Brände, Massenanfall von Verletzten oder auch Gefahrgutaustritte) auf ein akzeptables Risiko zu reduzieren bzw. die Auswirkungen dieser Betriebszustände zu minimieren, werden Alarm- und Gefahrenabwehrpläne seitens des Betreibers in Abstimmung mit den Einsatzkräften erarbeitet. In Tabelle 1 werden Risikobereiche, die im Bau wie auch im Betrieb relevant sind, aufgelistet. Risiken sind nicht nur für Personen, die Infrastruktur oder die Umwelt vorhanden. Auch wirtschaftliche Risiken und immaterielle Risiken – wie etwa ein Imageschaden – sind in die Betrachtung mit einzubeziehen (vgl. Galler (2017 c), Seite 5 ff.).
Ein Tunnel gilt als »sicher«, wenn er den aktuellen technischen Richtlinien wie auch den geltenden einschlägigen Gesetzen entspricht (richtlinienbasierter Ansatz) oder wenn die vorher festgelegten Risikokriterien (risikobasierter Ansatz) erreicht werden (vgl. Kohl (2018), Seite 12).
[18]Tabelle 1: Risiken in Tunnelanlagen im Bau und Betrieb
| Personenschutz | Versorgung | Sonstiges | |
| Eigenschutz | Belüftung | Bergwasser | Verkehrswege |
| Aufenthalt von Fremdpersonal | Luftversorgung | Schachtsicherung | |
| Positionserkennung | Beleuchtung | Ausbruch/Verbruch | |
| Mangelndes Sicherheitsbewusstsein | Elektrizität | Transport | |
| Schlechte Ausbildung | Maschinensicherheit | ||
| Personal Fluktuation | Finanzieller Druck |
Auf Risiken kann sinnvollerweise nach einer Risikoanalyse in Form eines mehrstufigen Prozesses auf die einzelnen Ereignisphasen reagiert werden (siehe Bild 3). Die erste und gleichzeitig effektivste Stufe, mit Risiken umzugehen, ist die Prävention und somit ein Ereignis gar nicht erst eintreten zu lassen. Dabei können Geschwindigkeitsbegrenzungen, blinkende Ampeln oder auch gezielte Informationen der Tunnelnutzer (Informationstafeln, Lautsprecherdurchsagen, Aufschaltung in den Radioverkehrsfunk usw.) eingesetzt werden. Regelmäßige Wartungen der Anlage, Investitionen in die Sicherheitstechnik und hochverfügbare Systeme sind erforderlich. Die nächste Stufe sind ereignismindernde Maßnahmen. Dabei können technische Maßnahmen wie Lüftungen, Löschanlagen etc. oder organisatorische Maßnahmen zum Einsatz kommen. Einfache organisatorische Maßnahmen sind die Geschwindigkeitsbegrenzung, Verbot des Fahrspurwechsels oder nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen gleichzeitig die Tunnelanlage benutzen zu lassen. In Straßentunnelanlagen gilt das Selbstrettungskonzept. Tunnelnutzer werden dabei mit verschiedenen Maßnahmen (Lüftungsteuerung, Beleuchtungsregelung, Fluchtwegkennzeichnung, wie auch durch Ansagen mit der installierten Beschallungsanlage etc.) bei der Flucht unterstützt. Im Weiteren wird durch gezielte Veranstaltungen in der Fahrausbildung das korrekte Verhalten bei Notsituationen in Tunnelanlagen trainiert. In letzter Konsequenz ist für die Fremdrettung die Feuerwehr im Gesamtkonzept berücksichtigt. Alarm- und Ausrückepläne, Sonderalarmpläne, Kommunikationssysteme und die vorhandene Ausrüstung sind Teil der Fremdrettung. Können die Einsatzkräfte die Tunnelanlage in kurzer Zeit erreichen, können Schadensereignisse (Größe von Brandereignissen, Verbreitung von Schadstoffen, Menge von ausgelau[19]fenen Flüssigkeiten etc.) kleiner ausfallen, als wenn lange Anfahrtszeiten und viele weitere Parameter einkalkuliert bzw. berücksichtigt werden müssen.
Bild 3: Stufenmodell Risikoreduktion [zurück]
Bild 4: Fluchtwegskennzeichnung