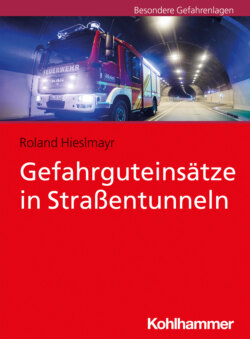Читать книгу Gefahrguteinsätze in Straßentunneln - Roland Hieslmayr - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[21]1.4 Einteilung der Straßentunnel wie auch der gefährlichen Stoffe
ОглавлениеEuropäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)
Das ADR 2017 regelt international die Beförderung von gefährlichen Gütern auf der Straße für die derzeit 47 Vertragspartner. Darin sind alle gefährlichen Güter, welche auf der Straße transportiert werden, aufgelistet. Der Transport darin nicht gelisteter gefährlicher Güter durch das jeweilige Hoheitsgebiet eines Staates kann im Wege eigener bilateraler Verträge vereinbart werden (vgl. ADR (2017), Seite IV ff.).
Mit dem ADR 2017 werden u.a. Bestimmungen getroffen, welche die Durchfahrt durch Straßentunnelanlagen auf Basis von Risikoanalysen beschränken bzw. durch zusätzliche Maßnahmen (z.B. Begleitfahrzeug) ergänzen können (vgl. STSG (2017), Anlage Sicherheitsmaßnahmen, Punkt 3.7). Die Anwendung der Durchfahrtsbeschränkungen wird in den Mitgliedsstaaten unter Einbeziehung von vertretbaren Alternativrouten und nationalen Regelungen unter Zuhilfenahme des Risikomodells DG-QRAM (Dangerous Goods-Quantitative Risk Assessment Model) erarbeitet.
Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, wenn diese in das ADR fallen (z.B. Ausschluss aufgrund eines Mindermengentransportes), werden einem Tunnelbeschränkungscode zugeordnet. Dieser ist in den Stofflisten des ADR abgebildet und kann in den Beförderungspapieren, die jeder Transporteur mit sich führt, eingesehen werden (vgl. ADR (2017), Kapitel 3).
| Merke: Der Tunnelbeschränkungscode seitens des Transportfahrzeuges (Stückguttransport, Tankfahrzeug etc.) in Verbindung mit der Tunnelkategorisierung (für das Bauwerk selbst) erlaubt die Aussage, inwieweit eine Durchfahrt mit dem jeweiligen gefährlichen Stoff durch den Straßentunnel erlaubt ist. |
Eine Veranschaulichung der Durchfahrtsbeschränkungen der Tunnelkategorie (siehe Tunnelkategorisierung) in Verbindung mit dem Tunnelbeschränkungscode (siehe Tunnelbeschränkungscode (TBC)) ist in Bild 5 ersichtlich.
Bild 5: Tunnelbeschränkungscode (siehe auch Tabelle 4) [zurück]
Bild 6: Kennzeichnung der Durchfahrtsbeschränkung vor einem Tunnel
Dangerous Goods-Quantitative Risk Assessment Model (DG-QRAM)
DG-QRAM wurde von PIRAC/OECD zwischen 1997 und 2001 in einem ERS2 Projekt entwickelt und kann für die Risikoanalyse nach der Direktive 2004/54/EC (Mindest[22]anforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen Straßennetz) angewendet werden (vgl. Piarc (o.A.)). Die Software ermöglicht:
den Risikovergleich von Gefahrguttransporten durch Tunnel und alternative Routen im Freibereich,
die Bewertung von Tunnelbeschränkungen/Regelungen (ADR Gefahrgutgruppenbeschränkung),
die Bewertung gesellschaftspolitischer Risiken,
die Bewertung der Tunnelausrüstung (Notausgänge etc.) (vgl. Piarc (o.A.)).
Bei dessen Anwendung wird in einem F/N Diagramm das Risiko dargestellt. Dabei gibt es drei unterschiedliche Bereiche für das Risiko:
1 [23]Das Risiko ist in einem tolerierbaren Bereich, somit ist keine weitere Maßnahme erforderlich.
2 Das Risiko ist in einem nicht tolerierbaren Bereich, sofortige Maßnahmen ohne Rücksicht auf Kosten sind durchzuführen.
3 Das Risiko ist »zwischen« tolerierbarem und nicht tolerierbarem Bereich, der sogenannte ALARP-Bereich, bei welchem Maßnahmen für eine Risikosenkung nach Betrachtung der Kosten-Nutzen-Gleichung durchgeführt werden.
Die Analyse erfolgt dabei stufenweise von Stufe 1 bis Stufe 3. Lässt sich ein Tunnel nicht mit der geringsten Stufe positiv bewerten, wird die nächste Stufe zur Maßnahmenanalyse herangezogen, bis eine positive Bewertung abgegeben werden kann.
[24]Bild 7: Bewertungsstufen nach DG-QRAM [zurück]
UN-Nummer
Für gefährliche Güter werden vom Expertenkomitee der Vereinten Nationen die UN-Nummern, welche auch als Stoffnummern bezeichnet werden, festgelegt. Diese vierstellige Nummer beschreibt keine einzelnen chemischen Verbindungen, sondern Stoffgruppen. Dabei wird vom Gefährdungspotenzial ausgegangen. Beispiele:
UN 1005: Ammoniak, wasserfrei
UN 1202: Dieselkraftstoff/Heizöl
UN 1203: Benzin
UN 1977: Stickstoff
[25]Tunnelkategorisierung
Nach der Risikoanalyse kann die Risikobewertung durchgeführt werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse kann der Straßentunnel einer Tunnelkategorie zugeordnet werden. Dabei basiert die Kategorisierung auf der Annahme, dass in Straßentunnelanlagen drei Hauptgefahren maßgebend sind, die für Menschen bzw. das Bauwerk weitreichende Folgen verursachen können:
1 Explosionen
2 Freiwerden giftiger Gase oder flüchtiger, giftiger, flüssiger Stoffe
3 Brände (vgl. ADR (2017), Seite 1.9-1, Punkt 1.9.5.2.1)
Die Einteilung erfolgt in die Tunnelkategorien von A bis E, wobei die Kategorie A keine Beschränkungen für die Durchfahrt enthält und die Kategorie E fast ausnahmslos Transporte verbietet. Am Bauwerk selbst wird die Tunnelkategorie gemäß dem Gefahrgutbeförderungsgesetz mit dem Kennzeichen »Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern« (vgl. StVO (2017), § 52, Punkt 7 e) sowie einer Zusatztafel, auf welcher die Tunnelkategorie angegeben wird, gekennzeichnet (siehe Bild 7).
Tunnelbeschränkungscode (TBC)
Jeder im ADR gelistete Stoff enthält neben einer UN-Nummer eine Klassifizierung zu einem Tunnelbeschränkungscode. Die Beschränkungen werden in Tabelle 4 Spalte »Beförderungskategorie« (Tunnelbeschränkungscode – Spalte 20) im ADR abgebildet.
[26]Tabelle 3: Tunnelkategorie
| Tunnel- kategorie | Beschränkung | Beschreibung | Kennzeichnung |
| A | keine Beschränkung | kein Zeichen | – |
| B | Beschränkung für gefährliche Güter, die zu einer sehr großen Explosion führen können | Zeichen mit Tafel mit dem Buchstaben »B« | |
| C | Beschränkung für gefährliche Güter, die zu einer sehr großen Explosion, großen Explosionen oder zur umfangreichen Freisetzung von giftigen Stoffen führen können | Zeichen mit Tafel mit dem Buchstaben »C« | |
| D | Beschränkung für gefährliche Güter, die zu einer sehr großen Explosion, großen Explosionen, zur umfangreichen Freisetzung von giftigen Stoffen oder zu einem großen Brand führen können | Zeichen mit Tafel mit dem Buchstaben »D« | |
| E | Beschränkung für alle gefährlichen Güter bis auf wenige Ausnahmen | Zeichen mit Tafel mit dem Buchstaben »E« |
[27]Tabelle 4: ADR Tabelle (ADR (2017), Seite 3.2-A-58.) [zurück]
| ADR-Tanks | Fahrzeug für die Beförderung in Tanks | Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode) | Sondervorschriften für die Beförderung | Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr | UN-Nummer | Nummer und Beschreibung | ||||
| Tank-Codierung | Sondervorschriften | Versandstücke | lose Schüttung | Be- und Entladung, Handhabung | Betrieb | |||||
| 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 | 3.1.2 | |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) | (2) |
| LGBV | AT | 3 (D/E) | V12 | 30 | 12:02 | DIESELKRAFTSTOFF oder GASÖL oder HEIZÖL, LEICHT (Flammpunkt über 60 °C bis einschließlich 100 °C) | ||||
| LGBF | TU9 | FL | 2 (D/E) | S2 S20 | 33 | 12:03 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF |
[28]Gefährliche Stoffe im Allgemeinen
»Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei«
Dieser Ausspruch von Bombastus von Hohenheim aus dem Jahr 1538 hat bis heute Bestand. Für die Einsatzkräfte ist neben der Art und dessen Eigenschaften auch die Menge des ausgetretenen Stoffes und in weiterer Folge die Einwirkung auf das eigene Einsatzpersonal, Schutzbekleidung oder die Ausrüstung von Bedeutung. Aus diesen Werten ergeben sich einerseits Explosionsgrenzen und andererseits in Verbindung mit der Zeit die Toxizität (Einwirkdauer und Produkteigenschaften) der einzelnen Produkte.
Gefährliche Stoffe sind in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen und Kombinationen im alltäglichen Leben vorhanden. Zur Produktion von Geräten, Produkten, Werkzeugen, als Treibstoff oder Reinigungsmittel, beim Arzt im Röntgengerät oder zur Stromerzeugung in Atomkraftwerken. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen (medizinischer Abfall) sind ebenso betroffen wie Labore zur Forschung und Untersuchung von biologischem Material. Über 85 000 chemische Verbindungen – die beim Freiwerden die verschiedensten Wirkungen auf Menschen, auf Tiere, wie auch auf die Umwelt ausbreiten können – werden gelagert, verarbeitet oder transportiert. Viele davon kommen nur in geringen Mengen und sehr selten vor, was das Gefahrenpotenzial keinesfalls verringert. Bild 8 stellt die auf der Straße transportierten Mengen in Prozent nach Gefahrgutklassen in Österreich dar.
Bild 8: Mengen beim Transport (in Prozent (%)) (vgl. Asfinag S7 Abschnitt West Einreichprojekt (2008) Seite 12) [zurück]
Die Sicherheitsvorkehrungen im Transport sind sehr hoch (Verpackung, Kennzeichnung, Routengenehmigungen etc.). Nichtsdestotrotz können Unfälle passieren, die zu letalen Ereignissen, großräumigen Schadstoffwolken und Kontamination der Umgebung und der Menschen und Tiere führen. Das Risiko und auch das Schadensausmaß steigen mit der transportierten Menge und der Eigenschaften der gefährlichen Güter. Auf der Straße ist hier eine Begrenzung mit dem in der Straßenverkehrsordnung (StVO) festgelegten maximalen Fahrzeuggewicht vorgegeben. Beim Transport mit der Eisenbahn oder mit Schiffen können Transportmengen von 100 000 l bis über 1 000 000 l gerechnet werden. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
radioaktiven Stoffen (A-Stoffe),
biologischen Agenzien (B-Stoffe)
und chemischen Stoffen (C-Stoffe).
[29]Radioaktive Stoffe
Unter Radioaktivität wird die von selbst erfolgende Umwandlung eines instabilen Elements in ein anderes Element durch Veränderung seines Kerns verstanden. In der überwiegenden Zahl der vorkommenden Zerfallsarten erfolgt dies durch die Aussendung hochenergetischer Teilchen. Neben den natürlichen Strahlenquellen (kosmische Strahlung, terrestrische Strahlung) existieren viele, vom Menschen geschaffene, künstliche Strahlungsquellen, welche zusätzlich zu den natürlich vorkommenden strahlenden Materialien auf den Menschen einwirken. Diese verschiedenen Strahlungsquellen sind auszugsweise nachfolgend aufgelistet:
bildgebende Verfahren in der Medizin (Röntgenapparat)
kerntechnische Anlagen (Atomkraftwerk)
elektrotechnische Quellen (ionisierende Strahlung)
sonstige technische Quellen (chemische Umwandlung)
Grundsätzlich gilt es, drei unterschiedliche Zerfallsarten voneinander zu unterscheiden:
α-Zerfall: Beim Alphazerfall wird ein hochenergetisches Alphateilchen abgegeben. Dies ist ein Helium-Kern mit zwei Protonen und zwei Neutronen. Alphateilchen haben eine große Masse und sind doppelt positiv [30]geladen. Ihre Strahlungsreichweite ist gering. Eine Abschirmung ist bereits mit einem Blatt Papier möglich.
β-Zerfall: Beim Betazerfall wandelt sich im Atomkern ein Neutron in ein Proton und ein Elektron um. Durch diesen Vorgang wird das Elektron mit hoher Energie aus dem Kern herausgeschleudert. Auch Betastrahlen ionisieren Materie, haben aber weit weniger Masse als Alphastrahlen. Ihre Reichweite ist etwas höher als bei Alphateilchen. Eine Abschirmung ist durch wenige Millimeter Aluminium möglich.
γ-Zerfall: Mit dem Alpha- und Betazerfall ist oft noch ein Gammazerfall verbunden. Nach Aussendung eines Alpha- oder Betateilchens kann ein Kern zu viel Energie enthalten. Die überschüssige Energie wird in Form eines Gammaquants abgegeben.
Bild 9: Abschirmung [zurück]
Im Gegensatz zu Alpha- und Betastrahlung ist die Gammastrahlung eine ionisierende Strahlung und kann nicht abgehalten (abgeschirmt), sondern nur exponentiell abgeschwächt werden. Eine hohe Abschwächung der Strahlenbelastung ist durch einen dicken Bleimantel möglich. Bild 9 vergleicht die Strahlungsarten und zeigt eine [31]mögliche Abschirmung dieser. Der Zerfall eines Nuklides ist bei jedem Stoff unterschiedlich und kann dabei durch das Zerfallsgesetz beschrieben werden. Dabei reicht die Halbwertszeit eines Stoffes von weniger als einer Sekunde, z.B. bei Iod, bis mehreren Millionen Jahren, wie beispielsweise bei Thorium.
| Praxistipp: Bei Strahlenexposition ist vor allem die aufgenommene Strahlendosis pro Zeiteinheit ausschlaggebend. Die möglichen Folgen können von geringen Langzeitschäden bis zum zeitnahen Tod führen. Notwendige Interventionen sollten von älteren Einsatzkräften unter Berücksichtigung der 4-A-Regel (siehe Tabelle 23 4-A-Regel) durchgeführt werden. Eine Kontamination soll dabei auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden. Für zeitkritische Tätigkeiten, wie u.U. die Menschenrettung, sind als Mindestschutz schwerer Atemschutz wie auch Chemieschutzstiefel und Chemieschutzhandschuhe zur normalen Schutzbekleidung (Schutzstufe I) als Mindestschutzausrüstung obligatorisch. In Tunnelanlagen sind dabei der lange Anmarschweg und die begrenzte Möglichkeit, sich in einem abgeschirmten Bereich zu bewegen, zu berücksichtigen. Die Abstimmung mit den jeweils zuständigen Behörden und Sachverständigen bzw. Fachberatern ist dabei äußerst wichtig und meist entscheidend für den Einsatzerfolg! |
Bild 10: Quadratisches Abstandsgesetz
[32]Biologische Stoffe
Unter biologischen Stoffen versteht man unter anderem Mikroorganismen, Endoparasiten, Zellkulturen in natürlich vorkommenden wie auch in gentechnisch veränderten Erscheinungsformen, welche Lebewesen schädigen können. Landläufig versteht man darunter Bakterien, Pilze, Viren oder auch Parasiten. Im Transportwesen kommen solche Stoffe in Form von Krankenhausabfällen, Tierkadavern, Laborprodukten oder militärisch genutzten biologischen Kampfstoffen und nicht zuletzt bei terroristischen Anschlägen vor. Im Falle der Freisetzung nach einem Unfall ist – je nach biologischem Stoff – eine Infektion der Einsatzkräfte möglich. Dabei kann eine Übertragung durch Kontakt (Kontamination), über die Luft (Inhalation) wie auch über die Schleimhaut, Haut etc. (Inkorporation) erfolgen. Dies geschieht lautlos und unsichtbar und kann durch die menschlichen Sinnesorgane nicht wahrgenommen werden. Biologische Stoffe werden nach Artikel 18 Richtlinie 2000/54/EG ((2000), Artikel 2) der Europäischen Union in vier Stufen (siehe Tabelle 5) eingeteilt.
Tabelle 5: Biologische Stoffe – Risikogruppen [zurück]
| Risikogruppe | Gefahr für Mensch | Gefahr für Bevölkerung | Heilungsverlauf | Beispiel |
| 1 | kein | – | – | – |
| 2 | gering | unwahrscheinlich | möglich | Influenzavirus, Masernvirus, Mumpsvirus |
| 3 | mittel | mittel | u.U. möglich | Hepatitis-C-Virus, Gelbfieber |
| 4 | hoch | hoch | nicht möglich | Lassa-Virus, Ebola-Virus, Marburg-Virus |
Infektiöse Stoffe werden mit der Gefahrgut-Unterklasse 6.2 (Ansteckungsgefährliche Stoffe) sowie mit der Gefahrennummer 606 gekennzeichnet. Einige Beispiele für UN-Nummern mit Bezug zu biologischen Stoffen:
UN 2814: Gefahr für den Menschen
UN 3373: Diagnostische Proben
UN 2900: Gefahr für Tiere
UN 3291: Klinischer Abfall, unspezifiziert, n.a.g.
UN 3245: Gentechnisch veränderte Mikroorganismen
[33]Die Verpackung von biologischen Stoffen erfolgt schichtenweise. Der biologische Stoff ist von einem saugenden Material umgeben und in einem Primärbehälter luftdicht verschlossen. Dieser ist wiederum in einem Sekundärbehälter, der nach den ADR-Richtlinien ausgeführt ist, geschützt. Darüber erfolgt des Weiteren der Schutz durch eine Versandverpackung, welche – wie auch die anderen Verpackungsschichten – beschriftet ist. Die Verpackungen müssen dabei Druckprüfungen und hohe Temperaturdifferenzen aushalten. Dabei wird in die Versandkategorie A und Versandkategorie B unterschieden.
| Versandkategorie A: Wenn ein infektiöser Stoff dauernde Körperbehinderung hervorruft, ansteckungsgefährlich oder gar letal für Mensch und Tier sein kann, wird er der Kategorie A zugeordnet. Versandkategorie B: In diese Kategorie fallen alle Stoffe, die nicht unter Kategorie A eingeordnet werden. |
Bild 11: Behälter Versand
Zu erkennen, dass ein biologischer Stoff transportiert wird, kann sich mitunter sehr kompliziert darstellen, da dieser ohne Kennzeichnung und Hinweise von anwesenden Personen nur schwer eingeordnet werden kann. Hinzu kommt, dass biologische Proben ggf. mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Messverfahren können vor Ort zum einen systembedingt (Komplexität, Senilität) und zum anderen aufgrund der [34]Vielfalt an nachzuweisenden Agenzien und der Art der Nachweisführung meist nicht vorgenommen werden.
| Praxistipp: Als Grundsatz gilt in solchen Fällen das Stand-Still-Prinzip (Stationären Zustand der Situation herstellen, durch Absperren, Absichern, Evakuieren etc.). Fachpersonal (Laboranten, Ärzte, Betriebsangehörige etc.) muss für die weiteren taktischen Festlegungen herangezogen werden. Das Weiterverbreiten eines ausgetretenen Stoffes ist unter allen Umständen zu verhindern, soweit dies mit den vorhandenen Schutzmaßnahmen möglich ist. Eine Abstimmung mit dem Fachpersonal, Laboranten, Ärzten ist vor jeder Aktion durchzuführen. Sieht man von einer etwaigen Menschenrettung ab, ist dieser Einsatz in den meisten Fällen nicht zeitkritisch. |
Chemische Stoffe
Die Chemie beschäftigt sich mit Stoffen bzw. Stoffgemischen. Diese können in der Natur als Reinstoff vorkommen oder auch in Chemiebetrieben durch Reaktoren hergestellt werden. Alle nicht rein in der Natur vorkommenden Stoffe werden als Stoffgemische bezeichnet. Alle Stoffe haben verschiedene Eigenschaften und können mit den verschiedensten Verfahren und in den verschiedensten Aggregatzuständen in diversen Temperaturzuständen unter Druck vermengt und zu neuen Stoffgemischen zusammengefügt werden. Beispiele für Reinstoffe sind z.B. Ethanol (Alkohol), Wasser oder Kochsalz. Stoffgemische wären z.B. Milch, Luft oder Beton.
Mit Chemikalien werden Reinstoffe oder Stoffgemische bezeichnet, die industriell hergestellt werden. Dabei unterscheidet man zwischen anorganischer und organischer Chemie. Grob eingeteilt beinhaltet die anorganische Chemie alle Stoffe, die frei von Kohlenstoff sind (sowie einige Ausnahmen). Die organische Chemie beinhaltet alle Verbindungen, die kohlenstoffbasierend sind. Die Einteilung in Gefahrstoffe erfolgt darüber hinaus in der Gefahrstoffverordnung und im Chemikalienrecht. Gekennzeichnet werden Chemikalien über die CAS Nummer (Chemical Abstracts Service), welche dabei eine eindeutige Kennzeichnung dieser vornimmt.
Mit der CAS Nummer werden weltweit alle Stoffe in einer Datenbank registriert. Alle wichtigen Eigenschaften, Formeln und Typen sind damit verbunden. Die Nummer besteht dabei aus mehreren Zahlengruppen, die durch Bindestriche getrennt sind. Alle Zahlengruppen sind mit einer Prüfziffer codiert. Sie werden von der American Chemical Society auf Antrag des jeweiligen Erzeugers vergeben. Beispiel: CAS Nr. Wasser 7732-15-5. Derzeit sind ca. 140 Millionen Stoffe in dieser Datenbank registriert, wobei nur ein Bruchteil davon industriell benötigt wird. Ein nutzungsrelevanter Sinn steht bei dieser Datenbank nicht im Vordergrund.
[35]Gefahrgutklassen
Gefährliche Güter werden von der United Nations Organisation (UNO) über Antrag des Herstellers in Gefahrgutklassen, welche aufgrund ihrer Eigenschaften, Zustände und deren Auswirkung auf Menschen, Tiere und die Umwelt klassifiziert werden, eingeteilt. Diese Eigenschaften (u.a. giftig, brandfördernd, radioaktiv, ätzend, ansteckungsgefährlich, explosionsgefährlich oder brennbar) werden nach einem Prüfschema (vgl. ST/SG/AC.10/11/Rev.5 (2009), Seite 1 f.) beurteilt und eine Zuordnung zu einer Gefahrgutklasse wird durchgeführt. Die Veröffentlichung erfolgte 2015 in den »Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS« in der aktuell 19. Ausgabe (vgl. ST/SG/AC.10/1/Rev21 (Vol I) (2019), Seite 51 f.).
Gefährliche Güter werden in folgende neun Gefahrgutklassen (siehe Tabelle 6) eingeteilt, wobei es weiterführend noch Unterteilungen in den Klassen gibt, die eine genauere Spezifikation der möglichen Eigenschaften und möglichen Auswirkungen erlauben (vgl. ST/SG/AC.10/1/Rev19 (Vol I) (2015), Seite 51).
Tabelle 6: Gefahrgutklassen [zurück]
| Klasse | Beschreibung |
| 1 | Explosivstoffe und Gegenstände mit Explosivstoffen |
| 2 | Gase |
| 3 | Brennbare flüssige Stoffe |
| 4 | Brennbare feste Stoffe |
| 5 | Oxidierend wirkende Stoffe |
| 7 | Radioaktive Stoffe |
| 8 | Ätzende Stoffe |
| 9 | Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände |
Kennzeichnung der Gefahr
Die »Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr« legt zu den gefährlichen Stoffen, welche mit UN-Nummern bezeichnet sind, die Gefahren fest (siehe Tabelle 7). Diese Nummern müssen gemeinsam mit der UN-Nummer auf der orangefarbenen Warntafel auf dem Transportfahrzeug angebracht werden.
[36]Tabelle 7: Kennzeichnung der Gefahr (vgl. ADR (2017), Seite 5.3-7, Absatz 5.3.2.3.1) [zurück]
| Nummer | Gefahr |
| 2 | Entweichen von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion |
| 3 | Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen, Gasen) oder selbsterhitzungsfähiger, flüssiger Stoff |
| 4 | Entzündbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsfähiger Stoff |
| 5 | Oxidierende (brandfördernde) Wirkung |
| 6 | Giftigkeit oder Ansteckungsgefahr |
| 7 | Radioaktivität |
| 8 | Ätzwirkung |
| 9 | Gefahr einer spontanen, heftigen Reaktion |
Zwei gleiche Zahlen nacheinander weisen auf eine Zunahme der Gefahr hin. Reicht eine einzige Zahl aus, um die Gefahr zu beschreiben, wird eine 0 angefügt (siehe Tabelle 8). Bestimmten Zahlenkombinationen (22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90, 99) werden abweichend von den angegebenen Kennzeichnungen besondere Gefahren zugewiesen.
Tabelle 8: Besondere Kennzeichnung (vgl. ADR (2017), Seite 5.3-7, Absatz 5.3.2.3.1) [zurück]
| 0 | Keine weitere Gefahr |
| X | Stoff kann gefährlich mit Wasser reagieren |
Für gefährliche Stoffe, die in die Klasse 1 (Explosivstoffe) eingereiht werden, wird für die Gefahr die jeweilige Verträglichkeitsgruppe (A bis N und S) sowie die Unterklasse (1.1 bis 1.6) angegeben (vgl. ADR (2017), Seite 2.2-2, Absatz 2.2.1.1.4 und Absatz 2.2.1.1.5.9).
Kennzeichnung der Gefahrguttransporte
Die Kennzeichnung der Gefahrguttransporte erfolgt nach ADR 2017 auf drei verschiedenen Ebenen. Die Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer werden auf einer orangefarbenen Tafel am Transportfahrzeug angebracht (siehe Bild 12). Die Gefahrgutklasse wird mit der »Bezettelung« wiederum an der Fahrzeugaußenseite für die Einsatzkräfte gut erkennbar angebracht. Des Weiteren sind noch Transport[37]papiere im Führerhaus des Fahrzeuges mitzuführen, welche genauen Aufschluss über die transportierten gefährlichen Güter, sowie über etwaige Maßnahmen im Schadensfall und Sicherheitsvorschriften (Sicherheitsdatenblätter) geben.
Begleitdokumente
Das ADR sieht in diversen Punkten bei der Beförderung von Gefahrgut auf der Straße das Mitführen von Begleitpapieren, die Auskunft über das transportierte Produkt, Erzeuger, Versender, Empfänger und vieles mehr geben, vor. Dies gilt sowohl für kennzeichnungspflichtige als auch für nicht kennzeichnungspflichtige Transporte. Es soll einerseits dem Empfänger die Möglichkeit geben, das Produkt auf Art und Menge zu prüfen und andererseits den Einsatzorganisationen im Havariefall wertvolle Informationen zum Produkt und Kontaktmöglichkeiten für weitere Informationen über den Stoff und dessen Behandlung (in der Regel Versender und Empfänger) geben. Es gibt keine zwingende Form, die dabei einzuhalten ist. Folgende Informationen müssen jedenfalls in dem Beförderungspapier vermerkt sein:
Klassifizierung
Verpackung (Anzahl)
Verpackung (Beschreibung)
Menge des transportierten Produktes
Versender
Empfänger
Bei Transporten, die mit Warntafeln gekennzeichnet werden, müssen Unfallmerkblätter mit den jeweiligen Gefahren, die von dem Produkt ausgehen bzw. Maßnahmen, die zur Schadensbeseitigung von Nutzen sind, mitgeführt werden. Der Fahrer muss einen gültigen Führerschein der jeweiligen Fahrzeugklasse und eine gültige ADR-Transport-Bescheinigung (»ADR-Führerschein«) besitzen.
Bild 12: Kennzeichnung Gefahrgut-Lkw [zurück]