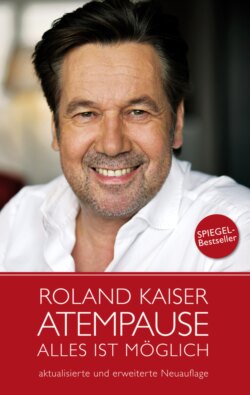Читать книгу Atempause - Roland Kaiser - Страница 10
ОглавлениеEin Kaiser-Jahr
Ich arbeitete wie noch nie. Ich sprudelte über vor Ideen und Kreativität. Als Ausgleich für die zeitweilige körperliche Lethargie, in die meine angeschlagene Atmung mich privat zwang, stürzte ich mich beruflich von einer Aufgabe in die nächste. Wir nahmen ein Album auf. 2002 war ein Kaiser-Jahr. Ich feierte meinen 50. Geburtstag und zugleich annähernd 30 Jahre Bühnenjubiläum mit der Tournee „Alles auf Anfang“. Sie war nach der gleichnamigen Longplay-CD benannt. RPR zeichnete mich beim „Internationalen Schlagerpreis“ als „Sänger national“ aus, und ich bekam durch den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, den ich als überzeugter Sozialdemokrat im Wahlkampf unterstützt hatte, den „Beschäftigungs-Förderpreis des Solidarfonds Castrop-Rauxel“ verliehen.
„Alles auf Anfang“ hieß mein im Herbst 2001 veröffentlichtes Album – und treffender hätte für mich ein CD-Titel in diesem Jahr nicht sein können. Dieses Album stieg nur eine Woche nach Veröffentlichung in die Charts ein, und es schloss sich ein Fernsehmarathon an. Nicht weniger als zwei Dutzend TV-Gastspiele folgten in den ersten vier Wochen. Rund ein Jahr später, 2002 auf Tournee, suchte ich den Kontakt zu den Fans, meinem Publikum. Routine ist für mich ein Fremdwort. Der Album- und Tourneetitel war für mich auch eine Verpflichtung – und lenkte mich von meiner Krankheit ab. Ich wollte es wissen! Ich suchte und fand das Gänsehaut-Feeling auf den Konzertbühnen. Ich hatte mich mit dem täglichen Kampf arrangiert. Mein gesundheitlicher Zustand, die damit verbundenen Beschwerden wurden für mich zur Normalität. Und waren damit zu vernachlässigen. Eine Null unter dem Strich. Doch die Rechnung hatte ich ohne meine COPD gemacht. 2004 folgte die Tournee „Zeit für Gefühle“ mit Claudia Jung und Michelle. Sie führte uns in 29 Städte in Deutschland und Österreich.
In den Jahren 2002 bis 2004 mogelte ich mich, oder besser noch: kämpfte ich mich mit dem Handicap der COPD gesundheitlich durch und verhielt mich zunehmend fahr- und nachlässig. Mit den Monaten und Jahren gewöhnte ich mich bis zu einem gewissen Grad daran. Meine Frau und ich konnten und wollten uns wohl auch nicht (mehr) vorstellen, dass sich die Krankheit verschlechtern könnte.
Ich nahm zwar in regelmäßigen Abständen meine Termine für die Routineuntersuchung bei meinem mich behandelnden Professor wahr, aber eher aus Pflichtgefühl heraus als aus Überzeugung oder gar deshalb, weil ich die Notwendigkeit einsah. Ich hatte aufgehört zu rauchen, nahm meine Medikamente, hatte meine Atemtechnik trainiert und meine Atmung stabilisiert. Wir dachten, das bliebe jetzt so. Zwar nicht optimal, aber bis zu einem gewissen Grad optimiert und alltagstauglich nivelliert. Jeder hat kleine Schönheitsfehler, die er versteckt, – meiner war eben die COPD.
Nachdem wir im Herbst 2003 in das wunderschöne und idyllisch gelegene Fachwerkhaus eines denkmalgeschützten Bauernhausensembles in einem Stadtteil von Münster gezogen waren, fühlte ich mich immer matter. Meine zunehmende Erschöpfung schob ich jedoch weniger auf mein chronisches Lungenleiden als vielmehr auf den zurückliegenden Umzug und die Erkältungsinfekte, die die kalte Jahreszeit eben mit sich bringt. Für meinen Husten, der sich verschlimmert hatte, machte ich zudem das zwar liebevoll renovierte, aber dennoch unbestreitbar alte und – so vermutete ich – feuchte Haus verantwortlich, in dem wir neuerdings wohnten. Das würde sich mit dem Frühjahr und den steigenden Außentemperaturen schon wieder bessern. Um Ausreden und gute Gründe war ich noch immer nicht verlegen.
Ostern 2004 konfrontierte mich jedoch erneut so mit meiner COPD, dass ich notgedrungen eine Atempause einlegen musste.
Wir hatten auf dem Feld hinter dem Haus ein großes Osterfeuer aufgeschichtet und Freunde, Nachbarn und Verwandte dazu eingeladen. Doch anstatt mit Silvia von der Terrasse aus zum hoch aufgeschichteten und hell lodernden Feuer hinüberzugehen, hielt ich mich permanent in der Nähe des Hauses auf. Den ganzen Abend über rührte ich mich nicht vom Fleck, stützte mich auf einen Holzstapel auf und fand eine entspannte Körperhaltung, die mir das Atmen erleichterte. Wem auffiel, dass ich die Feier recht ruhig und zurückgezogen verfolgte, wurde von Silvia und mir mit der Erklärung zufriedengestellt, dass ich gesundheitlich angeschlagen sei: „Der Umzug, die viele Arbeit, der Winter, ihr wisst schon …“
Nach den Osterfeiertagen konnte ich mir nicht mehr selbst helfen. Also ging ich aus eigenem Antrieb erneut für eine knappe Woche ins Krankenhaus, um mich dort stationär besser einstellen zu lassen. Ich sagte zwei Termine ab sowie die Einladung zum 60. Geburtstag des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder.
Im Krankenhaus erhielt ich von meinem Professor nicht nur medikamentös, sondern auch psychologisch ein grundsätzliches „Update“, einen Crashkurs für ein zukünftig verantwortungsvolleres Verhalten und meinen alltäglichen Umgang mit meiner Krankheit.
Mein Leben sollte sich noch einmal drastisch verändern, nahm mir noch mehr Freiheit und Mobilität: Ich verabschiedete mich von unseren geliebten Familienurlauben in den Bergen und von bequemen Flugreisen. Höhe war nicht gut für mich, belastete unnötig meine Lunge und meine Atmung.
Sobald ich das Krankenhaus verlassen hatte, begann eine neue Zeitrechnung. Nach der Diagnose der COPD im Jahr 2000 hatte ich wie viele andere Patienten auch mit einer Hyperkompensation reagiert. Ich wollte auf Teufel komm raus meine Leistungsbereitschaft und -fähigkeit beweisen und bürdete mir Aufgaben auf, die ich als gesunder Mann niemals gemacht hätte. Statt beispielsweise einen Wasserkasten zu tragen, wie es normal wäre, schleppte ich zwei auf einmal.
Ich hatte zu viel Energie vergeudet, die ich weitaus sinnvoller hätte einsetzen können. Jetzt musste ich meine COPD möglichst schnell akzeptieren und mit der Krankheit und mir ins Reine kommen. Doch auch wenn ich mit meinen Kräften innerhalb der eigenen vier Wände fortan besser haushielt, war ich weiterhin bemüht, nach außen den Anschein der Normalität aufrechtzuerhalten. Ich begann, mich erstmals mit dem Gedanken anzufreunden, dass sich meine vermeintliche Schwäche in Stärke umkehren würde, sofern ich sie mir endlich eingestehen würde. Durch die Ruhe- und Atempausen, die ich mir nun selbst auferlegte, verlor meine Welt zwar an Dimensionen, gewann aber durchaus an Qualität. Meine Familie genoss die Zeit mit mir.
Ich versuchte also, meinem zweiten Lebensabschnitt gedanklich positive Aspekte abzugewinnen, doch ich musste auch der Realität ihren Tribut zollen: Aus Sicherheitsgründen musste ich dafür sorgen, dass mein Körper die ganze Nacht über und tagsüber zumindest für einige Stunden ausreichend Sauerstoff bekam, sodass meine Organe arbeiten und funktionieren konnten. Ohne diese Vorsorgemaßnahmen könnten durch eine mögliche Unterversorgung mit Sauerstoff unter Umständen später organische Folgeschäden auftreten. Vorsorge – das bedeutete für mich jedoch, auch auf Reisen ein Sauerstoffgerät mitzunehmen. Welche Herausforderung bei meiner berufsbedingten Reisetätigkeit und meiner Unfähigkeit, über meine Krankheit zu sprechen! Ich entwickelte eine wahre Meisterschaft darin, alles wunderbar zu kaschieren, zu verstecken und so zu gestalten, dass es keiner merkt.
Silvia und ich übten uns zunehmend „professionell“ in diesem Versteckspiel. Dennoch brodelte die Gerüchteküche immer stärker. Zugleich erhöhte sich der Druck auf meine Frau durch die Stimmungsmache und immer penetrantere Recherche einiger sogenannter Journalisten. Sie schreckten auch nicht davor zurück, im Sommer unangemeldet unser Wohnzimmer durch die Terrassentür zu betreten. Telefonklingeln kündigte keine Kontaktaufnahme von Freunden mehr an, sondern bedeutete in erster Linie Alarm. Wer war da wohl wieder in der Leitung? Silvia begann in immer kürzeren Abständen mit mir zu diskutieren: „Pass mal auf, diese ständigen Gerüchte und die Fragen der Leute, ich mach das nicht mehr mit. Du kannst es mir und auch den Kindern nicht mehr länger zumuten, ständig für dich zu lügen.“