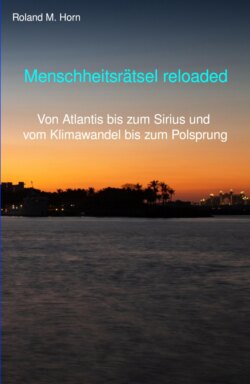Читать книгу Menschheitsrätsel reloaded - Roland M. Horn - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Die Klima-Debatte
Dass wir vor einer Klimaänderung stehen, wurde bereits in den 1980er Jahren angenommen. Mittlerweile wird in diesem Rahmen von der „globalen Erwärmung“ gesprochen, und eine erhitzte Debatte zwischen den Verfechtern der globalen Erwärmung und den so genannten „Klimaskeptikern“ ist an der Tagesordnung. Diese „Klimaskeptiker“ behaupten entweder, die Temperaturen erhöhten sich gar nicht oder streiten zumindest ab, dass CO2 (neben anderen Treibhausgasen) der Verursacher der globalen Erwärmung ist und somit der Mensch nicht schuld ist, sondern beispielsweise die Sonne. Hier wird der Mensch quasi freigesprochen.
Schauen wir doch mal in einen solchen Artikel hinein. Michael Krueger schreibt am 16.11.2011 einen Beitrag mit dem provokanten Titel „Wie die NASA die Arktis warmrechnet und die Globaltemperatur zum Schweigen bringt.“ Der Autor behauptet:
„Die NASA führt in ihrer Liste nur feste Stationen auf dem Land. Im Nordpolarmeer, also gerade dort, wo die Erwärmung am stärksten sein soll, gibt es ein großes Datenloch.“
Krueger behauptet, die NASA würde, um das Loch zu füllen, von wenigen Messpunkten der Arktis ausgehend die ganze Region einschließlich der des Nordpolarmeeres berechnen. Infolge der scheinbar sich erwärmenden Arktis wirke sich dies auf die globale Temperatur aus.
Krueger bezweifelt, dass dem so ist und geht näher auf die Daten von Messbojen ein. Er schreibt:
„Den Daten der NASA zufolge (…) hat in diesem Zeitraum [gemeint ist: Der Zeitraum zwischen 1979-1997. d. A.] ein starker Temperaturanstieg in der Arktis und im gesamten Nordpolarmeer stattgefunden. Betrachtet man die Messdaten aus Bojen-Messungen im selben Zeitraum (…), so fallen grundsätzliche Unterschiede zu den Berechnungen der NASA auf.“
Abbildung 2: Landkarte globale Welterwärmung der NASA
Krueger stellt fest, dass die Messdaten ein dreigeteiltes Nordpolarmeer nahelegen. In den Teilen der Ostarktis, die vor der Küste Russlands liegt, zeige sich tatsächlich ein Trend zur Erwärmung, doch in Teilen der der Westarktis, dem Kanada-Becken, das vor der Küste von Kanada liegt, zeige sich ein Trend zu einer Abkühlung. In weiten Teilen des zentralen Nordpolarbeckens zeige sich weder ein Trend zu einer Abkühlung noch zu einer Erwärmung. Die Berechnungen der NASA zeigten eine deutlich größere Erwärmung der Arktis als jene als aus den Messwerten für die Arktis. Krüger schließt:
„Damit wäre geklärt, die Berechnungen der NASA entsprechen nicht den real gemessenen Temperaturen im Nordpolarmeer und weisen entscheidende Diskrepanzen zu diesen auf.“38
Stefan Rahmsdorf, Abteilungsleiter am Potsdam-Institut für Klimaforschung und Professor an der Universität Potsdam, wirft den „Klimaskeptikern“ „Rosinenpickerei“ vor. In seinem Artikel „Wider die Rosenpickerei der Klimaskeptiker“ auf Sueddeutsche.de schreibt er:
„Deutsche Interessenvertreter aus der Wirtschaft bezweifeln den globalen Temperaturanstieg oder behaupten, die Klimaerwärmung sei zum Stillstand gekommen. Doch die Debatte um unsere Energiezukunft muss auf der Grundlage der wissenschaftlichen Fakten geführt werden. Und die sagen etwas ganz anderes.“
Für Rahmsdorf gibt es keinen Zweifel daran, dass die globale Durchschnittstemperatur auf der Erde immer weiter anstieg, und zwar in dem Maße, wie er in den 1970er Jahren von Klimawissenschaftler in wissenschaftlichen Fachzeitschriften wie Natur und Science vorausgesagt wurde. Sie schlossen dies damals aus CO2-Emissionen. Physikalisch sei ein Ende dieses Trends zur Erhöhung der Temperaturen nicht abzusehen, und in den Messdaten würde ebenfalls nichts auf ein Ende dieses Trends hinweisen.
Rahmsdorf wundert sich, dass trotzdem auf den Webseiten der „Klimaskeptiker“ die These herumgeistere, die globale Erwärmung sei vorbei. Namentlich nennt er die Lobbygruppe mit dem phantasievollen Namen „Europäisches Institut für Klima und Energie“.39
Rahmsdorf sagt aber auch, dass manche Interessenvertreter aus der Wirtschaft derartige Thesen gelegen kämen.
Der Klimaforscher nennt namentlich den RWE-Manager Fritz Vahrenholt, der in der Welt vom 27.05.201140 sagt, dass „die Klimaerwärmung seit zwölf Jahren zum Stillstand gekommen sei“. Weiter sagt Vahrenholt, dass „sich die wissenschaftlichen Stimmen mehren, dass wir vor einer langjährigen Abkühlungsphase des Klimas stehen.“ Auch der RWE-Chef Jürgen Großman habe in einem FAZ-Interview den globalen Temperaturanstieg angezweifelt.
Rahmsdorf bildet eine Grafik ab, auf denen fünf Datensätze zu erkennen sind. Und bei allen geht die Kurve eindeutig nach oben. Von diesen fünf verfügbaren globalen Temperaturreihen nutzen drei vor allem Messungen der Oberflächentemperaturen von Wetterstation und Schiffen.
Zwei andere, kürzere, Kurven, gehen auf den seit 1979 verfügbaren Satellitendaten hervor. Aus ihnen werden die Temperaturen in einigen Kilometern Höhe in der Atmosphäre genutzt. Rahmsdorf schreibt:
„Für die letzten 30 Jahre – also den in der Klimatologie üblichen Beobachtungszeitraum – zeigen alle fünf Datensätze praktisch die gleiche Erwärmung: einen Trend zwischen 0,16 und 0,18 Grad Celsius pro Jahrzehnt. Diese Übereinstimmung zeigt zum Beispiel, dass der Trend nicht von lokalen Effekten (wie städtischen Wärmeinseln) verfälscht wird, denn die Satellitendaten sind davon nicht betroffen. (Bei den Stationsdaten ist dieser Effekt durch Abgleich mit ländlichen Wetterstationen herauskorrigiert. Die gemessene Erwärmung entspricht auch dem, was seit vielen Jahren von Klimamodellen vorhergesagt wird.“
Der Klimaforscher weist darauf hin, dass die Daten monatlich im Internet abrufbar sind. Außerdem betont er, dass in den von Vahrenholt genannten zwölf Jahren, in denen die Klimaerwärmung angeblich zum Stillstand gekommen ist, die Daten im Mittel den gleichen Erwärmungstrend (0,16 Celsius pro Jahrzehnt) zeigten wie über die letzten Jahre.
Rahmsdorf spekuliert dahingehend, dass Vahrenholt nicht die letzten zwölf, sondern die so letzten 13 Jahre – also den Zeitraum von 1998 bis 2010 – gemeint haben könnte, denn das Jahr 1998 war einzigartig. Kein anderes Jahr rage so weit über den Langzeittrend hinaus, denn 1998 wurde im tropischen Pazifik das stärkste El-Nino-Ereignis der vergangenen Jahrzehnte im tropischen Pazifik beobachtet.
„Diese natürliche Klimaschwankung erhöht kurzfristig und vorübergehend die globale Temperatur – mit der klimatischen Langzeitentwicklung hat dies aber nicht zu tun, schon 1999 war der Effekt verpufft. Die Betrachtung ausgerechnet mit dem Extremjahr 1998 zu beginnen, soll wohl das gewünschte Ergebnis bringen – ein statistischer Sündenfall, der im Englischen „cherry picking“ (Rosinenpicken) genannt wird.“
(Man beachte hier die Benennung des Jahres 1998, das letzte des „Beginns der Veränderungen“)
Allerdings sei selbst bei dieser „trickreichen Wahl des Anfangsjahres“ der Trend in allen fünf Datenreihen immer noch positiv.
Rahmsdorf schließt seinen Artikel mit den Worten:
„Das Umdeuten von Messbefunden und Verleugnen der globalen Erwärmung führt uns nicht weiter. Die Debatte um unsere Energiezukunft muss – bei allen unterschiedlichen Adressen und Meinungen – auf der Grundlage der wissenschaftlichen Fakten geführt werden.“41
Auch Florian Rötzer, der sich auf den NOAA-Datensatz bezieht, schreibt, dass 2010 zusammen mit 2005 das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen im Jahr 1880 war.
Was Deutschland und überhaupt Nordeuropa sowie Teile Nordamerikas betrifft, war 2010 kein Rekordjahr, denn die Durchschnittstemperatur lag nach dem Deutschen Wetterdienst geringfügig unter dem langjährigen Klimamittel. Trotzdem betont der Deutsche Wetterdienst, dass die weltweite Erwärmung fortgeschritten sei. Klimaforscher des Potsdam-Instituts gehen davon aus, dass Nordeuropa durch die Klimaerwärmung immer kältere Winter erleben könnte, weil das Eis in der Arktis immer dünner werde und das Meer immer länger eisfrei bliebe. Die Folge: Aus dem Norden gelangt vermehrt kalte arktische Luft in die südwestliche Richtung.42
Wir sehen hier das komplexe Wechselspiel im Rahmen der Klimaänderung. Auf der Erde wird es nicht konstant wärmer, sondern im Rahmen dieser Verschiebung wird es (zunächst) in gewissen Perioden kälter. „Klimaskeptiker“ haben sich vor Jahren über Aussagen aus dem „Lager“ der Befürworter der globalen Erwärmung gestützt, die z. T. vorschnell prophezeiten, dass es in unseren Breiten in naher Zukunft keine „richtigen“ Winter mehr geben könnte. Damals kannte man die o. g. Entwicklung noch nicht, aber „Klimaskeptiker“ freuten sich darüber: Sie frohlockten (und frohlocken wahrscheinlich immer noch) über diesen scheinbaren Widerspruch. In manchen Blogs wurde spöttisch über die letzten kalten Winter berichtet und provozierende Fragen wie „Wo bleibt denn nur der Klimawandel?“ in den Raum gestellt. Wie wir oben gesehen haben, ist eine solche Argumentation unsinnig, denn wenn es schon globale Erwärmung heißt, ist die Durchschnittstemperatur auf dem gesamten Planeten gemeint und nicht nur kurzfristige Ereignisse in Nordeuropa und Nordamerika, wobei wir gesehen haben, dass diese Extremereignisse sogar ins Bild der globalen Erwärmung passen! Außerdem sind solche „Ausreißer“ (kurzzeitige Wetterphänomene) nicht geeignet, um auf einen langfristigen Trend zu schließt. Eine Studie muss einige Jahre (üblicherweise 30) lang durchgeführt werden, um ein brauchbares Bild über das Klima zu erhalten.
„Die Gletscher in der kanadischen Arktis schmelzen neuerdings extrem schnell“ vermeldet der Deutschlandfunk am 14.06.2011. Aus den Geophysical Research Letters ginge hervor, dass etwa ein Siebtel der weltweiten Eisflächen sich auf den Queen Elisabeth Islands im Norden Kanadas befinden, wo sei 2005 ein verstärktes Tauen eingesetzt habe. Seitdem verlören die ausgedehnten Inselgletscher fünfmal so schnell an Masse wie in den vorangegangenen vier Jahrzehnten. 2007 und 2008 seien die Eisverluste sogar siebenmal höher gewesen. Die Eistemperatur in der Region sei seit 2005 um bis zu zwei Grad Celsius gestiegen, und die Schmelzsaison habe sich um bis zu 12 Tage verlängert. Ungewöhnlich hohe Temperaturen im angrenzenden Nordwest-Atlantik seien dafür verantwortlich.43
Wie Daniel Lingenhöhl am 18.04.2011 berichtet, setzt sich die Erderwärmung in der Arktis am meisten durch. Durch diese Erwärmung zieht sich das Meereis immer weiter zurück. Einer großangelegte Studie des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven zufolge habe dies dramatische Folgen für die Küstenlinien der Region. Der von Volker Rachold und seinen Kollegen durchgeführten Studie zufolge werden die Ufer aufgrund des Klimawandels verstärkt erodiert und weichen im Mittel um einen halben Meter pro Jahr zurück.
Die Forscher haben mehr als 100 000 Kilometer Küstenlinie erfasst und somit ein Viertel der Arktis gründlich untersucht.
„Besonders dramatische Veränderungen erfassten die Geowissenschaftler etwa entlang der Laptev-, der ostsibirischen und der Beaufordsee, in denen die Erostionsraten der Küsten mehr als acht Meter pro Jahr betragen. Das Meer kann hier besonders gut am Festland nagen, da dessen Küsten aus gefrorenem Sediment und nicht aus Fels bestehen. Taut der Permafrostboden auf, sackt das Substrat wegen des Volumenverlusts ab: Es kann nun leichter überflutet und abgetragen werden, da die Körnchen nicht mehr vom Bodeneis komplett zusammengehalten werden.“,
so Lingenhöhl. Zusätzlich fehle vielen Stellen inzwischen der Schutz des Meereises, denn das verschwindet aufgrund der erhöhten Temperaturen.
Etwa ein Drittel der weltweiten Küsten lägen im Bereich des arktischen Permafrosts. Die Küstenerosion dürfte sich dadurch noch ausweiten, und durch den Bodenabtrag dürften sich sowohl die marinen auch die angrenzenden Festländer stark verändern. So ist den Wissenschaftlern zufolge mit Trübung des Ozeans, Bodenentwässerung von Südwasserseen und Zerstörung von Weidegründen für Gänse oder Rentiere zu rechnen.44
RIA Novostin online verweist am 04.05.2011 auf einen Bericht, der im Rahmen des Programms AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Program) verfasst wurde. Demzufolge geht das Schmelzen von Eis in der Arktis schneller als bisher vermutetet voran, was wiederum die Prozesse des Klimawandels erhöhe. Dies könne zur Folge haben, dass der Wasserstand der Weltmeere bis zum Jahr 2100 um 90 bis 160 Zentimeter ansteigt.
Mit dem Schmelzen des Eises in der Arktis wird immer mehr Sonnenenergie an der Oberfläche absorbiert. Mit diesem Temperaturanstieg können dann große Mengen Methan freiwerden – einem Treibhausgas, das noch um ein Vielfaches stärker ist als CO2. Die Forscher gelangen zu der Ansicht, dass das Nordpolarmeer in bereits 30 bis 40 Jahren völlig vom Eis befreit worden sein könne. Die Dauer der Schneedecke soll sich bis 2050 um 20% verringern.45
„Warmes Wasser aus subtropischen Regionen dringt ganzjährlich bis in die arktische Fjorde Grönlands vor. Dies haben Auswertungen von Langzeit-Messbojen der grönländischen Arktis jetzt ergeben. Sie betätigen damit, dass die bereits zuvor festgestellte Schmelze der Küstengletscher „von unten“ keine Ausnahme, sondern inzwischen Normalzustand ist. Die Präsenz des warmen Wassers könnte den besonders schnellen Rückgang der grönländischen Küstengletscher erklären, “
schreibt Scinexx – Das Wissenschaftsmagazin (online) am 24.05.2011. Schon 2009 entdeckten amerikanische Wissenschaftler in Grönlands Fjorden Hinweise dafür, dass die Zungen der Küstengletscher durch warmes Meerwasser sozusagen von unten angefressen werden und dadurch besonders schnell abschmelzen. Das warme Wasser könnte durch den Nordatlantikstrom aus subtropischen Regionen hierher abgeleitet worden sein, meinten sie schon damals und setzten Messbojen ein. Ist diese „Schmelze von unten“ ein temporäres oder ein beständiges Phänomen?“, fragten sich die Forscher. Jetzt wurden die am Kangerdlugssuaq-Fjord an der Süd-Ost-Seite Grönlands ausgesetzten Messbojen wieder geborgen, und zum ersten Mal stehen Daten eines vergangenen Jahres über die Temperaturen im Fjord zur Verfügung. Und tatsächlich: Das warme Wasser, dass die Gletscher von unten schmelzen lässt, ist während des ganzen Jahres vorhanden.
„Unsere aktuellen Untersuchungen zeigen uns dasselbe warme Wasser aus subtropischen Regionen, das wir auch schon im letzten Jahr gefunden haben. Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Temperaturen sogar noch um circa ein Grad wärmer – im Kangerdlussuaq- und auch im Sermilik Fjord, “
sagt Fiamma Straneo, eine Ozeanographin vom berühmten Meeresforschungsinstitut Woods Hole. Weiter sagt sie:
„Das Wasser ist das ganze Jahr über vorhanden, Es war also kein einmaliges Auftreten des subtropischen Wassers in Grönland.“ Der weltweite Anstieg des Meerwasserspiegels wird dadurch beschleunigt und erhöht.46
Das Internetmagazin Klimaretter.info vermeldet am 22.05.2011, dass es einen neuen Schmelzrekord in Grönland gibt.
„Höhere Sommertemperaturen und weniger Schnee: Die Schmelzsaison dauerte in Grönland mancherorts 50 Tage länger als bisher. Der Eisschwund verstärkt die Erwärmung der Arktis, “
schreiben Sarah Messina und Nick Reimer. 2010 sei nicht nur eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, sondern auch die Daten zur Schmelze des Grönlandeises belegten Rekordwerte, die in der Zeitschrift Environmental Research Letters veröffentlich worden seien. Die Schmelze habe 2010 ungewöhnlich früh Ende April eingesetzt und habe erst spät Mitte September geändert, sagte der Studienautor Marco Tedesco vom Cryospheric Processes des City College of New York (CCNY). Die Forscher hatten Anomalien in den Oberflächentemperaturen der grönländischen Eisdecke untersucht, und die Schmelzdaten wurden durch Satellitenaufnahmen, Bodenbeobachtungen und Modelle ausgewertet. An der Studie nahmen Forscher der Universität Liege in Belgien, der Universität in den Niederlanden und Wissenschaftler des Nationalen Schnell- und Eisdatenzentrums (NSIDC) in den USA teil.
In der grönländischen Hauptstadt Nuud wurde, wie die Studie zeigt, der wärmste Frühling und der wärmste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen 1973 verzeichnet, und außerdem hat es weniger geschneit. „Bloßes Eis ist viel dunkler als Schnee und absorbiert mehr Wärme“, sagt Tedesco. Zusätzlich wurde die Schmelze durch das Verhalten von Seen an der Gletscheroberfläche, feinen Staub- und Rußpartikeln auf der Eisdecke und den Fluss des Schmelzwassers beeinflusst.
Aus einer zweiten Studie geht hervor, dass sich die Eisschmelze in der Arktis selbst beschleunigt, denn wenn das Eis schmilzt, treten darunter dunkle Stellen zu Tage, die die Sonnenstrahlen stärker anziehen als die reflektierenden Eisflächen, und das wiederum beschleunigt die Eisschmelze. Der Effekt ist bekannt, allerdings, wirkt er deutlich stärker als bisher angenommen. Eine so genannte Analyse der Albedo47-Rückkopplung in den letzten 30 Jahren führt zu dem Schluss, dass das ist der Arktis verloren gegangene Reflexionsvermögen doppelt so groß ist wie bisher vermutet.
US-Amerikanische Forscher schreiben in Magazin Nature-Geoscience, dass dieser Verlust des Eises auch negative Auswirkungen auf die gesamten Schnee- und eisbedeckten Flächen der Erde haben. Stefan Rahmsdorf sagt:
„Die tatsächlichen Messdaten zum Schwund in der Arktis zeigen, dass sich der Rückgang wesentlich schneller vollzieht als vom IPCC prognostiziert.“48
Ein Phänomen, das im Jahr 2011 die Grönländer beunruhigte, ist möglicherweise auch auf die Eisschmelze zurückzuführen: Tatsächlich ging die Sonne zwei Tage zu früh auf. Sie zeigte sich am 11.01.2011 um genau 12.56:57 Uhr. Normalerweise aber geht die Sonne nach der langen Polarnacht erst am 13. Januar wieder auf. An der Konstellation der Gestirne habe sich nichts geändert, sagt Wolfgang Lenhardt, Leiter der Abteilung Geophysik bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), auf der hohen Warte. Die Daten von Erdachse und Erdrotation sind gleichgeblieben.
Auch Thomas Posch vom Institut für Astronomie auf der Universität Wien schloss astronomische Gründe aus. Seine Vermutung ist, dass die Beobachtung auf eine lokale Veränderung des Horizonts zurück zu führen ist. Ein durch das beschleunigte Abschmelzen des grönländischen Eisschildes bedingter niederer Horizont sei denkbar – so könne man die Sonne eben früher sehen. Dies erscheint Posch als die „bei weitem am nahe liegendste“ Erklärung. Allerdings ist nach Lenards Meinung auch denkbar, dass es sich um ein atmosphärisches Phänomen, z. B. eine durch Eiskristalle hervorgerufene Luftspiegelung denkbar.49
Es sollte aber noch erwähnt werden, dass im Gegensatz zum „Mainstream“, der den Klimawandel als Ursache vermutet, Wiener Wissenschaftler eine Alternative für den verfrühten Sonnenaufgang anzubieten haben: Sie vermuten die atmosphärische Refraktion, also ein durch Lichtbrechung verursachten Phänomen, als Verursacher dieses Ereignisses. Diese Lichtbrechung lässt vor allen Dingen die Gestirne am Horizont näher erscheinen. Posch, der ursprünglich die These der lokalen Veränderung durch Eisschmelze vertrat, legte mittlerweile zusammen mit seinem Kollegen Klaus Bernhard in der Fachzeitschrift Der Sternenbote die Refraktionsthese vor. Eine solche Lichtbrechung wird durch einen von Außen in die Atmosphäre eintretenden Lichtstrahl bewirkt. Besonders während des arktischen Winters kann diese Refraktion zwischen 24 und mehr als 120 Bogenminuten abweichen, und so kann die Sonne um bis zu zwei Grad höher erscheinen. Posch schreibt:
„Wenn wir nun annehmen, die Refraktion sei am 11. Jänner in Ilulissat besonders groß gewesen, nämlich um 20 Bogenminuten größer als im Mittel, so böte die allein eine zureichende Erklärung für das beobachtete Phänomen.“
Dafür spräche auch ein „wesentlich höherer oder bodennaher Luftdruck als in den Vorjahren“, sagt der Forscher. Die Lichtbrechung hängt nämlich von Temperatur, Luftdruck und Atmosphärenschichtung am Ort des Beobachters und anderen Faktoren ab.50
Wie dem auch sei, die massive Eisschmelze in Grönland und in der Arktis überhaupt lässt sich nicht abstreiten. Bis vor einigen Jahren wurde die Antarktis dagegen als stabilstes Element betrachtet. Dort war nur von Eisabbrüchen die Rede, die in den Augen der „Klimaskeptiker“ „normal“ seien. Sichere Hinweise auf ein Schmelzen in der Antarktis gab es selten. Doch das hat sich in den Monanten vor dem erstmaligen Verfassens dieses Buches deutlich geändert.
„Bisher dachten Forscher, der Klimawandel ende in 1500 Meter Meerestiefe. Eine Antarktis Expedition zeigt: „Das stimmt nicht“,
schreibt der Südkurier am 25.05.2011. Als Folge des Klimawandels würde das Wasser in den Tiefen des Atlantiks nördlich der Arktis immer wärmer werden. Die Informationen stammen vom jüngsten Einsatz des Expeditionsschiffes Polarstern – einem Forschungseisbrecher des Bremerhaveners Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI). Tatsächlich ist die Wassertemperatur in den vergangenen 26 Jahren großräumig um sechs Hundertstel Grad angestiegen. Dies sei „eine erhebliche Wärmemenge“, die im Ozean gespeichert wird, sagte der Fahrtleiter Eberhard Fahrbach. Die steigenden Wassertemperaturen sind inzwischen in weiten Teilen des Weddel-Meeres im atlantischen Teil der Antarktis festzustellen. Dieser Anstieg beschränkt sich jedoch keineswegs auf die Oberflächenbereiche, sondern ist bis in die Tiefe des Meeres vorgedrungen. Die AWI sieht dies als Beweis dafür an, dass die Ozeane auch in der Tiefe Wärme aus der erhitzten Atmosphäre aufnehmen. Bisher hatte der Weltklimarat IPCC angenommen, dass ca. 80 Prozent der Wärme aus dem Treibhaus-Effekt in den oberen Ozeanschichten bis 1500 Metern Wassertiefe landet. Wie wir dank der Polarstern-Expedition wissen, ist auch der tiefe Ozean mit seinem gigantischen Volumen an diesem Prozess beteiligt. Aus dem Weddel-Meer heraus werden die Verhältnisse in der weltweiten weltweit in der Tiefsee beeinflusst, denn dort sinkt salzhaltiges Wasser. Die Wissenschaftler sind der Ansicht, dass die Veränderungen an den Eigenschaften dieses – bisher – sehr kalten Meerwassers globale Auswirkungen haben werden.51
Auch die Tierwelt ist vom Rückgang des Meereises betroffen. So schreibt Nicola Zellmer am 18.04.2011:
„Die Antarktis verliert ihre Pinguine: Forscher haben einen drastischen Rückgang der Population festgestellt, weil den Tieren die Nahrung fehlt. Die Hauptursache für den dramatischen Nahrungsmangel ist nach Ansicht der Forscher der Rückgang des Meereises.“
Mit der Nahrung, die hier erwähnt wird, meint Zellmer den Krill. Die Autoren des Artikels beziehen sich dabei auf eine Studie, die im Fachmagazin PNAS von Wayne Z. Trivelpiece vom fischereiwissenschaftlichen Institut in La Joalla und seinen Kollegen veröffentlicht wurde. Dieser Krill, eine Kleinkrebsart, ist die bevorzugte Nahrung sowohl der Adeliepinguine, die im Winter auf dem Meereis leben, als auch die Kehlstreifpinguine, die das offene Wasser bevorzugen. Langzeitbeobachtungen auf der Westantarktis und in der schottischen See zeigten, dass die beiden genannten Pinguinarten von 1930 bis 1970 (zunächst) von der Jagd auf Wale und Pelzrobben profitierten. In Abwesenheit der Futterkonkurrenten vermehrten sie sich um 50 Prozent.
Mittlerweile gehen die Anzahl der Pinguinarten jedoch dramatisch zurück, denn in den vergangenen 30 Jahren sank die Zahl der Adeliepinguine um 2,9 Prozent pro Jahr ab, bei den Kehlstreifpinguinen sind es sogar 4,3 Prozent pro Jahr. Von den Jungpinguinen überleben anstatt wie früher 50 heute nur noch 10 Prozent.
Nun haben sich die Robben- und Walpopulationen wieder erholt und sind wieder auf Krill-Jagd. Kommerzielle Fangflotten jedoch fischen immer mehr von den Kleinkrebsen ab. Seit den 70er Jahren ist die Krillpopulation im südlichen Ozean auf ein Fünftel geschrumpft.
Die Forscher um Trivelpiece sehen diese Nahrungskonkurrenz nicht als die Hauptursache des Krillmangels, sondern der Rückgang des Meereises. Die Arktis gehört zu jenen Gebieten auf der Erde, die sich am schnellsten erwärmen. Von den 70er Jahren bis heute stieg die Temperatur dort um 5 bis 6 Grad! Die Folge ist, dass es weniger Meereis gibt, das zudem im Frühjahr weniger langer erhalten bleibt. So fehlt den Jung-Krills der Schutzraum, in dem sie zu auffallend großen Tieren heranwachsen können. „Wenn die Erwärmung anhält, wird der Krillmangel einen durchschlagenden Effekt auf das antarktische Ökosystem haben“, sagt Trivelpiece. Auch der Fakt, dass die Pinguin-Populationen zurückgehen, sind für ihn wertvolle Hinweise darauf, dass im Ökosystem etwas schiefläuft. Man könne sie leicht zählen, da sie an Land brüten und von Menschen nicht gejagt werden. „Wenn wir so steile Abnahmen der Population sehen, wie wir bei den Adelie- und Kehlstreifen-Pinguinen dokumentiert haben, wissen wir, dass ein viel größeres ökologisches Problem dahinterstehen muss,“ so der Wissenschaftler.52
„Die Veränderungen an Eismassen in der westlichen Antarktis von Jahr zu Jahr gehen im Wesentlichen auf Niederschlagsschwankungen zurück, die entscheidend durch das Klimaphänomen El Niño gesteuert werden. Die berichten jetzt Geowissenschaftler in einer Ausgabe der Fachzeitschrift „Earth und Planetary Science Letter“,
schreibt Scinexx – Das Wissenschaftsmagazin am 01.11.2010 in dem Artikel „Schmilzt das Eis am Südpol?“.
Forscher des Deutschen GeoForschungsZentrums (GFZ) untersuchten in ihrer neuen Studie Daten der deutsch-amerikanischen Satellitenmission Grace (Gravity Recovery and Climate Experiment), wobei sich deutliche regionale Unterschiede im Küstenbereich der Westantarktis zeigen.
Besonders interessant aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber der globalen Erwärmung: Einmal die antarktische Halbinsel, wo zur Zeit eine den globalen Durchschnitt überschreitende Erwärmung sowie das Verschwinden massiver Schelfeisgebiete vorherrscht und das Amundsen-Gebiet in der Westantarktis, in der die derzeit größten Fließgeschwindigkeiten und Massenverluste des Antarktischen Eisschildes auftreten, wo in einigen Gletschern Massenverluste des antarktischen Eisschildes festgestellt wurden. In einigen Gletschern schwindet die Mächtigkeit des Eises mit rasanter Geschwindigkeit. Die Gletscher und Eisströmung wirken hier drastisch ins Landesinnere zurück. Die beiden genannten Regionen spielen eine wesentliche Rolle in Bezug auf die Meeresspiegelveränderung: Der Meeresspiegel steigt derzeit in diesen Gebieten um etwa 0,3 Millimeter. (Der globale Meeresspiegel steigt um etwa drei Millimeter pro Jahr.)
In der neuen Studie bestimmten die Forscher vom GFZ die Massenbilanz beider Regionen anhand von Grace‘ Schwerefeldmessungen und stellten wesentlich niedrigere Werte fest als bei den konventionellen Verfahren. „In der GRACE-Zeitreihe konnte zum ersten Mal direkt beobachtet werden, wie die Eismasse in den beiden Gebieten durch Schwankungen im Niederschlag von Jahr zu Jahr variiert“, sagt Ingo Sasken vom GFZ.
Wie wir wissen, hängen das pazifische El-Nino-Klimaphänomen mit dem Schneefall in der Antarktis zusammen, und auch das Komplementärstück zur Kaltphase zur El-Nino-Warmphase – die Kaltphase mit dem Namen La Niña“ – spielt eine wichtige Rolle“. Professor Maik Thomas, Leiter der Sektion Erdsystem-Modellierung am GeoForschungsZentrum erklärt dazu:
„So führen die kühleren La-Niño-Jahre zu einem ausgeprägten Tiefdruckgebiet über der Amundsen-See, was hohe Niederschläge entlang der arktischen Halbinsel begünstigt – die Eismasse nimmt dort zu.“
und weiter:
„Im Amundsen-Gebiet dagegen dominiert in diesen Zeiten trockene Luft aus dem Landesinneren. El-Nino -Jahre mit ihren Warmphasen führen zu genau umgekehrten Mustern: Niederschlags- und Massenabnahme in der Antarktischen Halbinsel bzw. Zunahme im Amundsen-Gebiet.
Die Autoren des Scinexx-Artikels resümieren:
„Die Erfassung der gesamten Eismassen am Südpol und ihre Veränderung ist eine zentrale Aufgabe der Klimaforschung und wirft noch viele ungeklärte Fragen auf. Grundsätzlich konnte die Studie nach Angaben der Forscher zeigen, dass die kontinuierlichen Schwerefelddaten der Satellitenmission GRACE ein weiteres wichtiges mittelfristiges Klimasignal enthalten.“53
Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Mareike Schodder – Presse und Öffentlichkeitsarbeit) gab am 23.06.2011 eine Pressemitteilung mit dem Titel „Kipp-Elemente im Klimasystem: Forscher verfeinern ihre Einstellung“ heraus, in der es heißt:
„Das Eisschild der West-Antarktis ist ein mögliches Kipp-Element, das teils bereits gekippt sein könnte. Wissenschaftler können nicht ausschließen, dass die Eismassen nahe der antarktischen Amundsen See bereits instabil zu werden beginnen. Dies ist eines der Ergebnisse einer jetzt in der Fachzeitschrift Climatic Change erschienenen neuen Einschätzung des gegenwärtigen Zustands von sechs potentiell instabilen Regionen im Klimasystem mit großen direkten Auswirkungen auf Europa. Die Wahrscheinlichkeit des Kippens dieser Elemente steigt im Allgemeinen mit dem Anstieg der globalen Mitteltemperatur, als Folge des von Menschen verursachten Ausstoßes von Treibhausgasen.“
Anders Levermann vom Potsdam-Institut weist darauf hin, dass es sich dabei nur um eine Momentaufnahme handele, die allerdings „in mancher Hinsicht schärfer ist als die zuvor gemachten“. Es war das erste Mal, dass sich Experten für die verschiedenen Kipp-Elemente als Co-Autoren zusammengetan hätten, um zusammen einen „Überblick zum Stand des Wissens über so genannte klimatische Übergänge“ zu geben.
„Diese Vorgänge zu verstehen ist von entscheidender Bedeutung als Grundlage künftiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entscheidungen“,
sagt Levermann. Und weiter:
„Aus dem Blickwinkel der Risiko-Abschätzung muss die Wissenschaft – natürlich immer wieder unter Hinweis auf Unsicherheiten – Betroffene und Entscheider mit Informationen über Wahrscheinlichkeiten und mögliche Wirkungen von klimatischen Übergängen unterstützen. Einfach abwarten ist die Alternative.“54
Ein solcher teilweiser Abbruch des westantarktischen Inlandeises wäre zum Beispiel gleichbedeutend mit einem zusätzlichen Meeresspiegel von 1,5 Metern, wie aus früheren Forschungen hervorgeht. Die meisten Deiche in Europa können der aktuellen Studie zufolge nicht um mehr als einen Meter erhöht werden. Durch das Schmelzwasser würde, selbst wenn es Hunderte von Jahren dauert, auch die Anziehungskraft des Südpols verringert, denn wo die Masse schrumpft, wird auch die Gravitation stärker, und so könnte der Meeresspiegel in Europa noch weiter verstärkt werden.
Der Begriff „Kipp-Elemente“ wird so definiert, dass hier kleine äußere Störungen eine starke Reaktion auslösen. Dies könne bei manchen so missverstanden werden, dass die Veränderungen dieser Elemente immer selbstverstärkend und unumkehrbar sein. Derart dynamische Prozessen mit Selbstverstärkung gehörten zwar zu den meisten Kipp-Elementen, aber nicht zu allen. Wie Levermann erklärt, ist „der entscheidende Punkt die hohe Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen im globalen Klima.“ Dies stellt Levermann zufolge ein Risiko dar, dessen sich die Gesellschaft bewusst sein muss.55
„Die globale Erwärmung geht weiter“, teilt uns Focus online am 29.06.2011 mit. Die Autoren berufen sich auf den jährlichen Klimabericht des National Climatic Data Center (NCDC), der wenige Tage vor der Meldung vorgestellt wurde. „Seit mehr als 25 Jahren lag die globale Temperatur jeden Monat über dem jeweils gemessenen Durchschnittswert im 20. Jahrhundert“, erklärten die Wissenschaftler, die die Studie erstellt haben. Und weiter: „Die Indikatoren zeigen eindeutig, dass die Welt sich weiter erwärmt.“ Dies sagte der NCDC-Direktor Thomas R. Karl. Die Menge an Kohlendioxid, jenem Treibgas, das wahrscheinlich der Hauptverursacher der Globalen Erwärmung ist, in der Atmosphäre hat sich 2010 um 2,60 ppm (das sind die Teile pro Million) erhöht. Und dieser Wert ist größer als der durchschnittliche jährliche Anstieg der CO2-Gase in den Jahren von 1980 bis 2010.
Die Wissenschaftler halten es für sehr wahrscheinlich, dass große Klimaveränderungen viele Arten von Extremereignissen wie heftige Regenfälle, Überschwemmungen, Hitzewellen und Dürren beeinflusst hätten.
Am Klimabericht für 2010 waren 368 Wissenschaftler beteiligt. Peter Thorne von der Universtität von North Carolina betont, dass die Schlussfolgerung, dass die Erde sich erwärmt, aus mehreren Datentypen stammt.56
Über einen Streit innerhalb der Klima-Forschung berichtet Markus Becker für Spiegel-Online am 21.06.2011.
„Erstmals haben Forscher den Anstieg des Meeresspiegels der letzten 2000 Jahre rekonstruiert. Ihr Fazit: Nie zuvor sind die Ozeane so schnell angeschwollen wie seit Beginn der Industrialisierung. Doch Kritiker bemängeln, dass die Studie auf wackeligen Beinen steht“,
heißt es da. In dem Artikel wird der Anstieg der Meeresspiegel als die „vielleicht größte Folge des Klimawandels“ bezeichnet, und es wird daran erinnert, dass insbesondere in ärmeren Ländern Hunderte Millionen Menschen von immer häufiger auftretenden Überschwemmungen bedroht würden.
Im Jahr 2007 ging der UNO-Klimarat in seinem letzten Standardbericht davon aus, dass die Meeresspiegel im globalen Durchschnitt maximal 59 Zentimeter steigen könnten. In einem UNO-Bericht, der einige Tage vor der Spiegel-Meldung veröffentlicht wurde, war allerdings schon mit einem Anstieg auf 90 bis 160 Zentimeter die Rede, und jetzt haben die Forscher nach einigen Angaben zum ersten Mal durchgehend konstruiert, wie sich der Meeresspiegel in den letzten 2000 Jahren entwickelt hat, und das Ergebnis lautet, dass die Meeresspiegel heute schneller als je zuvor in den letzten 2000 Jahren ansteigen.
Der enge Zusammenhang zwischen Lufttemperatur und Meeresspiegelanstieg war bisher nur für die letzten 130 Jahre belegt gewesen, wie Rahmsdorf ausführt. Der Wissenschaftler hat zusammen mit seinem Team fossile Kalkschalen und Mikroben untersucht, die aus Bohrkernen aus Salzwiesen an der nordamerikanischen Atlantikküste stammten. Da diese Mikroben jeweils in einer bestimmten Höhe in Abhängigkeit von Ebbe und Flut leben, ist aus Menge und Art der gefundenen Kalkschalen die Höhe des Meeresspiegels ersichtlich.
Während der Meerspiegel von 200 v. Chr. bis ins 19. Jahrhundert hinein relativ stabil war, sei es mit Beginn der Industrialisierung zu einem Anstieg gekommen, der im Spiegel-Artikel als „rasant“ bezeichnet wird. Der Meeresspiegel sei in etwas mehr als hundert Jahren um etwa 20 Zentimeter gestiegen, was ein Mehrfaches von dem ist, was es in den vergangenen 2000 Jahren gegeben hätte.
Rahmsdorf und sein Team führen dies auf zwei Faktoren zurück:
Wird Wasser wärmer, dehnt es sich aus, und der Meeresspiegel steigt.
Das Abschmelzen von Gebirgsgletschern und großen Eismassen in Grönland und der Antarktis.
Rahmsdorf:
„Der Mensch heizt mit seinen Treibhausgasen das Klima immer weiter auf, daher schmilzt das Landeis rascher und der Meeresspiegel steigt immer schneller. Die neue Untersuchung bestätigt unser Modell des Meeresspiegelanstiegs – die Daten der Vergangenheit schärfen damit unseren Blick für die Zukunft.“
Aber: „Die Studie eignet sich gar nicht für Vorhersagen“, sagt Jens Schröter vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Das Hauptproblem an der Studie sieht er darin, dass sie eigentlich nur auf den Funden von der Küste North-Carolinas beruht und das für eine Aussage zum globalen Klima zu wenig sein könnte.
Rahmsdorf räumt ein, dass örtliche Meeresspiegelanstiege vom weltweiten Geschehen abweichen könnten. Trotzdem gehen er und seine Kollegen davon aus, dass „ihre Daten im Großen und Ganzen die Veränderungen im globalen Meeresspiegel aufzeigen.“ Schröter jedoch entgegnet, dass über einen Zeitraum von über 2000 Jahren Einflüsse wie die Kontinentaldrift sowie der so genannte isostatische Ausgleich spürbar würden. Dabei handele es sich um eine Folge der letzten Eiszeit: Mit dem Schwinden der Gletscher wurden die Landmassen von einer solch riesigen Last befreit, dass sie bis heute eine Wippbewegung durchführen. So hätten sich zum Beispiel in Schottland einige Gebiete im letzten Jahrtausend um bis zu 20 Zentimeter gehoben, während Teile Südenglands und der französischen Kanalküste um den gleichen Wert absanken.
Rahmsdorf und seine Kollegen haben auch Daten aus anderen Weltgegenden in ihre Studie einbegriffen, allerdings weichen die – teils erheblich – von den Werten aus Nordamerika ab. „Nur die Daten aus North Carolina passen einigermaßen zur rekonstruierten Meeresspiegelentwicklung“, sagt Schröter. Er wirft Rahmsdorf und Kollegen vor, ein bereits bestehendes Modell bestätigen zu wollen. Auch Michael Kucera von der Universität in Tübingen hält die Frage, wie repräsentativ die Daten aus Nordamerika wirklich seien, für die Achillesferse der Studie. Jedoch habe man mit dem Gebiet „eines der besten“ ausgesucht, denn in anderen Regionen sei die Lage „noch schwieriger.“
Dazu kommt, dass die neuen Meeresspiegel-Rekonstruktionen deutlich von früheren Studien abweichen. Ein Team um Michael Mann, der ebenfalls zu den Autoren der aktuellen Studie gehört, hätte in einer Arbeit aus dem Jahr 2008 einen wesentlich steileren Meeresmittelanstieg für die letzten Jahrhunderte berechnet. So hätte im Jahr 500 das Wasserniveau um fast anderthalb Meter unterhalb des neuen Werts gelegen, und auch Rahmsdorf selbst hatte 2007 und 2009 Studien zur geschichtlichen Entwicklung des Meeresspiegels mitveröffentlicht, die in ähnlicher Weise von der neuen Kalkulation abweichen.
Mojib Latif vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-Geomar) bezeichnete allerdings den Beobachtungszeitraum von ca. 2000 Jahren als eine „Stärke der Studie“, allerdings betont er, dass die langfristigen natürlichen Schwankungen des Meeresspiegels noch kaum verstanden seien. „Was in Zeiträumen von 300 bis 400 Jahren passiert, ist höchst umstritten“, sagt er.
Daran, dass der Meeresspiegel grundsäzlich in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, gäbe es allerdings keine Zweifel, wie Satellitenmessungen bewiesen. Diese Entwicklung fiele tatsächlich in die Zeit der Industrialisierung und des Anstiegs der Lufttemperaturen. Latif ist sich mit Rahmsdorf einig, dass es „schwer sei zu argumentieren, dass dies Zufall sein könnte“. Was allerdings Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung betrifft, hat Latif ähnliche Zweifel wie Schröter: „Wie viel Eis in der Arktis und Antarktis in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten wirklich verloren gehe, könne heute niemand genau sagen.57
„Eisschmelze – Die Beweislast für den Klimawandel wächst“, schreibt Rüdiger Schacht am 18.02.2011 auf Zeit online:
„Fehler im Weltklimabericht, umstrittene Studien und ein Klimagipfel mit vagen Ergebnissen. Die Klimaforschung hat sich von ihrer Krise noch lange nicht erholt. Und doch finden Forscher immer neue Belege für den menschengemachten Klimawandel, “
lesen wir dort. Und weiter:
„Auch wenn die Faktenlage trotz teils widersprüchlichen Studien erdrückend ist und kein ernsthafter Wissenschaftler weltweit daran zweifelt: Viele Bürger und Lobbygruppen wollen den menschengemachten Anteil am messbaren Klimawandel nicht wahrhaben. Sie meinen, Climate Gate58 und die Fehler im Bericht des Weltklimarates IPCC59 hätten gezeigt, dass es sich bei dem Klimawandel um eine weltweite Verschwörung60 handelt.“
Wie Schacht weiter berichtet, haben die Forscher vom Leibnitz-Institut für Meereswissenschaften, IFM Geomar, die Framstraße zwischen Spitzbergen und Grönland, erforscht. Dort fließt der Norwegerstrom, einer der nördlichen Ausläufer des Golfstroms. Für die Untersuchungen nahmen die Forscher Proben, die dort entnommen wurden. Tatsächlich stellte man fest: „Seit 2000 Jahren war das Meer zwischen Grönland und Spitzbergen nicht mehr so warm wie heute.“ Die Forschungsergebnisse wurden von Robert Spielhagen und seinem paläoozeanischen Team im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht. „Der jüngste Temperaturanstieg um etwa zwei Grad Celsius in den vergangenen Jahren ist beispiellos im untersuchten Zeitraum“, erläuterte Spielhaben demzufolge. Weiter fanden die Forscher einen Zusammenhang zwischen dem Ausstoß von Treibhausgasen und der Erwärmung in der Framstraße. Und tatsächlich fällt der Beginn des Temperaturanstiegs mit der einsetzenden Industrialisierung zusammen.61
Volker Mrasek titelt seinen Beitrag für Forschung aktuell „Turbo-Schmelze an den Polen“ um weiter zu untertiteln: „Eisverlust auf Grönland und in der Antarktis schreitet voran.“ Er schreibt:
„Sowohl am Nord- als auch am Südpol dezimiert sich das scheinbar keineswegs ewige Eis immer mehr. Das Ergebnis einer neuen Studie: Schon jetzt übertrifft die Schmelze auf Grönland und in der Antarktis die von sämtlichen Gebirgsketten weltweit.“
Im Jahr 2006 verloren Grönland und die Antarktis zusammen geschätzte 475 Milliarden Tonnen Eis ans Meer, wo es sich in Wasser auflöst. Dies entspricht einem Meeresspiegelanstieg von 1,3 Millimetern. So sagt Michiel van den Broeke, Professor für Polare Meteorologie an der Universität Utrecht in den Niederlanden und Mitautor an der genannten Studie:
„Unsere Ergebnisse zeigen zwei Dinge sehr deutlich: Der Eisverlust an den Polen beschleunigt sich. Die Eisschilde verlieren jetzt mehr Masse als alle übrigen Gletscher und Eisfelder auf der Erde zusammen. Das heißt, sie leisten inzwischen den größten Beitrag zum Anstieg des Meeresspiegels.“
Die Studie ist aufwändiger als vorhergehende Arbeiten. Der französische Glaziologe Eric Rignot, Professor an der Universität von Kalifornien in Irvie, sagt:
„Für unsere Studie haben wie die bisher längste Messreihe über die Massenbilanz beider Eisschilder herangezogen. – Monatsdaten aus 18 Jahren. Für die letzten acht Jahre haben wir außerdem zwei vollkommen unabhängige Messmethoden miteinander verglichen, um unsere Abschätzungen der Massenbilanz abzusichern.“
Die IPCC-Klimasensitivität ist etwa eine Größenordnung zu hoch, da in Klimamodellen ein starkes negatives Feedback der Wolken fehlt. Wenn wir darauf achten, dass nur ein kleiner Teil der erhöhten CO2-Konzentration anthropogen ist, müssen wir erkennen, dass der anthropogene Klimawandel in der Praxis nicht existiert. Der größte Teil des zusätzlichen CO2 wird laut Henry-Gesetz aus den Ozeanen ausgestoßen. Die tiefen Wolken steuern praktisch die globale Durchschnittstemperatur. In den letzten hundert Jahren hat sich die Temperatur aufgrund von CO2 um ca. 0,1 ° C erhöht. Der menschliche Beitrag betrug etwa 0,01 ° C. Eine der beiden verwendeten Methoden war die Gravimetrie: Zwei Satelliten vermessen im Rahmen des Geo-Projekts Grace ständig das Schwerefeld der Erde, wobei sie ihr Kurs auch über die Polargebiete führt. Die Instrumente der Satelliten registrieren dann vom Erdorbit aus örtliche Massenveränderungen am Boden. Uns so erkennen sie auch, wo Eis verloren geht.
Parallel zur Auswertung dieser Daten arbeiten die Forscher mit örtlichen Atmosphärenmodellen. Auch auf diese Weise ist es möglich, Massenbilanzen aufstellen, und aus diesen Modellen leiten die Forscher Schneefallmengen und Eisschmelzraten ab.
Beide Methoden liefern die gleichen Ergebnisse, sagt van den Broeke. Somit geht aus der Studie eines ganz deutlich hervor: Die Eisschmelze in Grönland und der Antarktis beschleunigt sich demnach – von Jahr zu Jahr gingen im Schnitt 35 Tonnen mehr Eis verloren.
„Natürliche Schwankungen des Klimas über den Eisschilden verschleiern diesen Trend. Es gibt nasse Jahre, in denen viel Schnee fällt und der Eispanzer sogar wächst. Und es gibt trockene Jahre, in denen es besonders stark schmilzt. Aber insgesamt sehen wir einen deutlichen Trend beschleunigter Verluste auf beiden Eisschilden.“,
sagt van den Broeken.62
Das Max-Planck-Institut kommt in seinen Forschungsinfo 2/2009 nach einem längeren Bericht den folgenden Schluss:
„Über längere Zeiträume hinweg deuten die Daten auf einen Einfluss der Sonne auf das Klimageschehen hin, auch wenn dessen genaues Ausmaß und die Wirkungsmechanismen selbst noch unklar sind. Bei der globalen Erwärmung der vergangenen 100 Jahre wird ebenfalls ein gewisser Beitrag der Sonne nahegelegt, allerdings hat spätestens seit etwa 1980 der verstärkte Treibhauseffekt durch die Zunahme von Kohlendioxid der Atmosphäre die Überhand gewonnen.“63
Eine am 3. Juli veröffentlichte Studie kommt jedoch zu einem anderen Schluss. Die Autoren der am 03. Juli veröffentlichten Studie schreiben einleitend:
„Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass hochenergetische Teilchen aus dem Weltraum, die als galaktische kosmische Strahlen bekannt sind, das Erdklima beeinflussen, indem sie die Wolkendecke vergrößern und einen „Regenschirmeffekt“ verursachen.“ 64
Die Gruppe um Professor Masayuku vom „Research Center for Inland Seas“ an der Kobe University gibt an, dass in der Zeit während des letzten geomagnetischen Umkehrvorgangs der Erde vor 780.000 Jahren, als die galaktischen Strömungen zunahmen, dieser „Regenschirmeffekt“ der niedrigen Wolkendecke zu einem hohen Luftdruck in Sibirien führte. Dieser Vorgang führte zu einer Verstärkung des ostasiatischen Wintermonsuns. Dies sei der Beweis dafür, dass kosmische Strahlen Veränderungen im Erdklima beeinflussen. Diese Studie wurde am 28. Juli in der Online-Ausgabe des „Scientific Reports“65 veröffentlicht worden. Der Artikel endet mit den Worten:
„‚Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat die Einschätzung der Auswirkungen der Wolkendecke auf das Klima erörtert, dieses Phänomen wurde jedoch aufgrund seines unzureichenden physikalischen Verständnisses in den Klimavorhersagen nie berücksichtigt ‚, kommentiert Professor Hyodo." Diese Studie liefert eine Gelegenheit, die Auswirkungen von Wolken auf das Klima zu überdenken. Wenn die galaktische kosmische Strahlung zunimmt, nehmen auch die tiefen Wolken zu, und wenn die kosmische Strahlung ebenfalls abnimmt, kann die Klimaerwärmung durch einen Gegenschirmeffekt verursacht werden. Der durch galaktische kosmische Strahlung verursachte Regenschirmeffekt ist wichtig, wenn man an die gegenwärtige globale Erwärmung sowie an die Warmzeit des Mittelalters denkt.“
Ein neues Papier, das von Forschern der Universität Turku in Finnland veröffentlicht wurde, besagt im Abstract (der Zusammenfassung am Anfang ihrer Studie):
„In diesem Artikel werden wir nachweisen, dass GCM-Modelle, die im IPCC reportAR5 verwendet werden, die Einflüsse der Änderungen der geringen Wolkendecke auf die globale Temperatur nicht berechnen können. Das ist der Grund, warum diese Modelle eine sehr kleine natürliche Temperaturänderung ergeben, die eine sehr große Änderung für den Beitrag der Treibgase zur beobachteten Temperatur ergibt. Dies ist der Grund, warum die IPCC eine sehr große Empfindlichkeit heranziehen muss, um einen zu kleinen natürlichen Bestandteil zu kompensieren. Außerdem müssen sie die starken negativen Reaktion aufgrund der Wolken auslassen, um die Empfindlichkeit zu erhöhen. Darüber hinaus zeigt dieses Papier, dass die Änderungen in der niedrigen Wolkendecke die globale Temperatur praktisch steuern.“
Das Team schlägt vor, dass die Idee des vom Menschen verursachten Klimawandels eine bloße Fehleinschätzung oder ein Verzerren der Formeln durch das Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ist. Im Rahmen ihrer Beweisführung schreiben die Forscher:
„Die IPCC-Klimasensitivität ist etwa eine Größenordnung zu hoch, da in Klimamodellen eine starke negative Reaktion der Wolken fehlt. Wenn wir darauf achten, dass nur ein kleiner Teil der erhöhten CO2-Konzentration menschengemacht ist, müssen wir erkennen, dass der menschengemachte Klimawandel in der Praxis nicht existiert. Der größte Teil des zusätzlichen CO2 wird laut Henry-Gesetz aus den Ozeanen ausgestoßen. Die tiefen Wolken steuern praktisch die globale Durchschnittstemperatur. In den letzten hundert Jahren hat sich die Temperatur aufgrund von CO2 um ca. 0,1 ° C erhöht. Der menschliche Beitrag betrug etwa 0,01 ° C.”
Die Autoren argumentieren, dass das IPCC Berechnungsergebnisse verwendet hat, die nicht als experimentelle Beweise angesehen werden können, und machen dies zum Grund für widersprüchliche Schlussfolgerungen. Die Resultate ihrer Forschungen fassen Forscher J. Kauppinen und P. Malmi wie folgt zusammen:
„Wir haben bewiesen, dass die im IPCC-Bericht AR5 verwendeten GCM-Modelle, die in der beobachteten globalen Temperatur enthaltene natürliche Komponente nicht korrekt berechnen können. Der Grund dafür ist, dass die Modelle die Einflüsse eine niedrigeren Wolkendecke auf die globale Temperatur nicht ableiten können. Ein zu kleiner natürlicher Bestandteil führt zu einem zu großen Anteil für den Beitrag der Treibhausgase wie Kohlendioxid. Deshalb repräsentiert IPCC die Klimasensitivität um mehr als eine Größenordnung größer als unsere Sensitivität von 0,24 ° C. Da der menschengemachte Anteil am erhöhten CO2 weniger als 10% beträgt, haben wir praktisch keinen menschengemachten Klimawandel. In der Hauptsache regeln die Wolken die globale Temperatur.“66
Dass es aber tatsächlich eine globale Erwärmung gibt, ist sicher. So wird berichtet Wetter.com am 17.06.2019 von einer „Rekordeisschmelze auf Grönland. Diese Quelle vermeldet auf Grundlage der des Dänischen Meteorologischen Instituts (DMI):
„Noch nie seit Aufzeichnungsbeginn hat es dort schon Anfang Juni so wenig Meereis gegeben wie in diesem Jahr. Der Norden Grönlands ist entsprechend Schauplatz einer viel zu frühen Schneeschmelze.“67
Am 03.07.2019 stellt Focus online fest: „Schmelz-Schock am Südpol: Jetzt taut auch noch die Antarktis auf“ und schreibt im Artikel mit diesem dramatischen Titel:
„Von 2014 bis 2017 ist das Meereis in der Antarktis dramatisch zurückgegangen. Die Nasa-Klimaforscherin Claire Parkinson bezeichnet den Verlust als „ziemlich unglaublich“. Dabei hat Meereis große Auswirkungen auf den Rest des Klimasystems.
Das Meereis in der Antarktis schmilzt noch schneller als in der Arktis. Das berichtet die Klimaforscherin Claire Parkinson vom Nasa Goddard Space Flight Center.
Die Wissenschaftlerin hatte sich in ihrer Studie Satellitenaufzeichnungen von den letzten 40 Jahren angesehen. Seit 1979 war das antarktische Meereis bis 2014 gewachsen. Doch dann kehrte sich diese Entwicklung um. In nur drei Jahren verlor die Antarktis so viel Meereis, dass die durchschnittliche jährliche Ausdehnung 2017 ein Minimum erreichte. In dieser Zeit verschwand laut der Nachrichtenagentur „AP“ eine Eisfläche größer als Mexiko.“68
Der Focus stellt weiter fest, dass das Meereis hat große Auswirkungen auf den Rest des Klimasystems hat und die Antarktis hat in nur drei Jahren somit so viel Meereis eingebüßt wie die Arktis in mehr als 30 Jahren. So viel Eis in so kurzer Zeit sei verlieren ist der Klimaforscherin Parkinson zufolge „ziemlich unglaublich“.
Tatsächlich erwärmt sich die Erde global. Das ist eine Tatsache. Ob die Hauptursache aber der menschengemachte CO2-Ausstoß aber tatsächlich eine wesentliche bzw. gar die entscheidende Rolle spielt, ist nicht sicher. Warum die CO2-These in den Massenmedien gehypt wird, während andere von durchaus renommierten Wissenschaftlern erstellte Studien hierzulande nur in „Außenseiterpublikationen“ Erwähnung finden, mag der Leser für sich selbst entscheiden.
Dass diese „Klima-Hype“ soweit führt, dass junge geistig beeinträchtige Personen gestandene Politiker für ihr „Versagen“ in Sachen Klimaschutz in scharfer Form regelrecht maßregeln dürfen, dass ungestraft zu einem unerlaubten Fernbleiben der Schule aufgerufen werden darf und dass diese sogenannte „Klimaaktisten“ es nicht beim Demonstrieren belassen, sondern auch noch die Felder von Bauern niedertrampeln, hat weder mit Klima- noch mit Umweltschutz etwas zu tun, sondern eher mit still geduldeter Anarchie!
Zum Abschluss dieses Themas möchte ich noch einmal Edgar Cayce zitieren, der sagte:
„Es wird die Umwälzungen in der Arktis und der Antarktis geben, die Vulkanausbrüche in den heißen Gegenden verursachen werden, und es wird eine Verschiebung der Pole geben – so dass dort, wo zuvor die frostigen oder die subtropischen Gebiete waren, diese tropischer werden, und Moos und Farn werden wachsen.“69