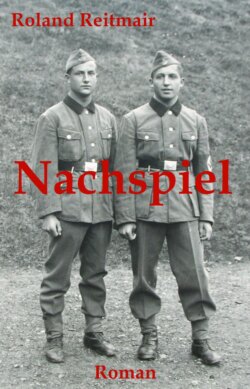Читать книгу Nachspiel - Roland Reitmair - Страница 5
III
ОглавлениеDie Marktgemeinde Thalheim bestand grob gesehen aus zwei Teilen – nördlich der ältere und historisch gewachsene Ortsteil an der Traun bis hinauf zum Schloss und der Kirche am höchsten Punkt, sowie der südliche Ortsteil dahinter am Kirchplateau und den angrenzenden Parzellen, wo sich erst seit kurzem die reichen Bürger der nahen Stadt Wels zwischen einzelnen alten Bauernhöfen ihre Villen bauen ließen.
Das Gemeindeamt befand sich im nördlichen und älteren Teil. Doch auch dieser gewachsene Ortsteil hatte eigentlich keinen Charakter. Erhaltenswerte „alte Bausubstanz“, Bürgerhäuser oder dergleichen gab es nicht. Der ganze Ort war ein bebautes Durcheinander ohne wirkliches Zentrum. Wo früher ausgedehnte Auen und Felder gewesen waren, wurde nun rigoros „umgewidmet“. Dort ein Einkaufszentrum, drüben das Dienstleistungszentrum, hier eine „Uferarkade“ zur Firmenansiedlung, und das Industriegebiet am Thalbach.
Nicht nur die Namen der Bauprojekte, sondern die ganze dahinterstehende Bebauungspolitik trieb seltsame Blüten. Wucherte wie bösartige Krebszellen. Gustl nahm den Gehweg durch den kleinen Wald oberhalb der Gemeindestraße hinauf zum Plateau. Über einige Steinstufen, die zur Umfriedung führten, erreichte man unweit der Kirche das wie eine Kapelle gestaltete Kriegerdenkmal. Meistens lagen dort Kränze. Kerzen brannten. Die Heimkehrer kümmerten sich rührend um die Gedenkstätten für ihre gefallenen Helden.
Gustl dachte an seinen Vater. Der war ein kommunistischer Widerstandskämpfer in diesem unseligen Krieg gewesen – außerdem hatte er überlebt. So gesehen schien er also sicher kein Held zu sein.
Der Vater. Mit seinen grauen, strähnigen Haaren. Als Mensch mochten ihn eigentlich alle, obwohl er mit seiner Einstellung überall aneckte.
Die eigenen Parteifreunde hatten es ihm verübelt, dass er bei einer Versammlung einmal sagte, Kommunismus und Christentum wäre nicht so verschieden, vor allem kein Gegensatz. Jeder wahre Christ wäre ihm lieber als die sogenannten Linken, die erst wieder nur den eigenen Vorteil im Auge hätten.
„Apparatschiks, die nichts Besseres im Sinn haben, als die neue Gesellschaft tot zu rüsten, um die andere Seite zu beeindrucken ...“
Die vom Vater in Schutz genommenen Christen hielten ihm dafür vor, dass er, wenn er auf Nächstenliebe vertrauen würde, ja wohl keine Revolution dazu brauche und keine Diktatur seines Proletariats. Dann könnte er doch auf die Kraft seines Glaubens bauen ... Aber den Glauben an einen lenkenden, denkend Gott hatte Gustls Vater spätestens in diesem Krieg verloren.
Ein paar Unverbesserliche wiederum – ewig Gestrige, mit denen er gelegentlich Karten spielte – schätzten ihn zwar, weil er nicht nachtragend war und darauf verzichtete „die alten Sachen wieder aufzuwärmen“, die sagten aber, dass er eben nur das andere Extrem gewählt hätte.
„Die Russen haben genauso viele Schweinereien gemacht, genau so viel Dreck am Stecken“, hielten sie ihm einmal vor. Da war der Gustl vielleicht sieben oder acht, saß neben seinem Vater auf der Wirtshausbank und kaute an einer Leberkäsesemmel herum.
„Naja, ich jedenfalls nicht“, sagte Vater. „Ja, wir auch nicht.“ Roland, einer der Kartenspieler, wurde immer leicht gereizt, wenn es um Politik ging. „– lassen wir das. Vierzig“, sagte er und spielte aus.
Das war beim Metzger, hinten im Stüberl, wo sich die Einheimischen am Samstag immer zum Kartenspielen trafen. Gespannt verfolgte der Gustl, was die Erwachsenen da plötzlich mit schneidender Stimme zu besprechen hatten. Er merkte, dem Adolf war nicht so ganz wohl in seiner Haut, „Trinkst auch noch einen?“, fragte dieser den Vater. Gustl verhielt sich still.
Erst daheim wollte er dann wissen, was mit dem Adolf in dem Moment los war, warum der so seltsam geschaut hatte.
„Ach weißt, Gustl“, sagte sein Vater, „der Adolf hat nicht nur den gleichen Namen wie der Schickelgruber, der hat sich damals viel von den angekündigten Neuerungen versprochen. Und er hat halt vieles nicht sehen wollen, was so passiert ist. Das tut ihm jetzt leid ...“
Was er denn getan hätte, wollte Gustl wissen, aber der Vater sagte nicht viel. Nur, dass Adolf im Grunde bestimmt nichts Böses wollte. Dass er halt wie so viele andere damals einfach mit den falschen Mitteln versucht hatte, die schlechte Zeit zu meistern ...
Den Adolf konnte der Gustl eigentlich immer gut leiden. Der kam früher auch oft zu ihnen nach Hause, mit seiner Frau, der Eva. Dann wurde Karten gespielt. Bauernschnapsen. Frauen gegen die Männer. Gustl saß daneben und „kiebitzte“. Während aber der Adolf noch lachen konnte, selbst wenn Gustl gar einmal seine Karten verriet, schimpften Eva und die Mutter schnell einmal.
Adolf erklärte ihm dann jedes Mal, dass die „Damen“ ohnehin schon so einen schweren Stand hätten. Und wenn die Frauen dann lautstark protestierten, lachte er noch mehr und drohte ihnen einen „Schneider“ an.
Und bevor Adolf mit der Eva heimging, steckte er Gustl meistens noch einen Fünfziger oder einen Hunderter zu. „Für die neue Angelrute“, sagte er und sagte es auch noch, als der Gustl schon längst eine neue gekauft hatte.
Das letzte was Gustl vom Adolf gehört hatte war, dass sein Sohn bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei. Viele aus dem Ort meinten damals, er hätte das Tunnelportal extra anvisiert, aus Liebeskummer.
„Der Adolf hat sich seither nicht mehr erfangen. Pausenlos redet er vom Umbringen, weil er in seinem Leben noch „nie nichts“ richtig gemacht hätte. Nicht einmal den Sohn hätt’ er vor seinem Schicksal bewahren können ... Die Eva ist schon ganz verzweifelt, dass er sich auch noch was antut“, hatte der Vater erzählt.
Gustl tat der Adolf leid, was er auch falsch gemacht hatte in seinem Leben, er war ein netter Kerl und vor allem war er immer nett zu ihm.
Dem Adolf sollte er wieder einmal schreiben ...
Gleich hinter dem Kriegerdenkmal lag Richtung Südost der Friedhof. Gustl musste kurz stehen bleiben und verschnaufen. Das Atmen ging immer schwerer.
Über die Friedhofsmauer lugten die Flachdächer der Siebzigerjahre-Siedlung herüber, daneben kam eine Reihenhaussiedlung aus der zehn Jahre späteren „Epoche“, dann die größeren Mehrfamilienhäuser, Baustil „Neue Heimat“. Dahinter standen schon die Häuser, in denen auch Gottfried und er ihre Wohnungen hatten.
Von Gustls Balkon aus konnte man in dieser Richtung die Kalkberge östlich vom Traunstein sehen. Priel, Warscheneck und Pyhrgas zum Beispiel, oder etwas weiter östlich das Sengsen-Gebirge. Dazwischen schien es nur Felder zu geben, Wälder und Wiesen. Die Sicht auf die Berge war wichtig für ihn, er war inmitten von Bergen aufgewachsen. Jetzt in der Ebene fühlte er sich immer ein bisschen unwohl, „da zerfließt irgendwie alles, da kommt man nirgends her und geht nirgends hin, ein Hügel um den anderen ...“
Es war für ihn einer der triftigen Gründe, sich diese Wohnung hier zu mieten: die Sicht auf die Berge. Obwohl sie viel mehr kostete als die Wohnung in der Stadt drüben. Freilich, gleich in der Senke hinter den Buchen am Hügel drüben, befand sich das Industriezentrum, aber das konnte man weder sehen noch riechen. Und wenn die entfernten Kalkfelsen in der Früh im ersten Licht der Sonne ganz rot leuchteten, fing der Tag schon anders an…
„Seit dieser Bürgermeister im Amt ist, entstehen nur mehr Zentren“, dachte er, „der ist schon ein besonderer Fall, zuerst geht er auf Stimmenfang und wenn er dann die Versprechen nicht halten kann, gibt er sich als wohltätiger Märtyrer aus, das muss man auch erst einmal können. Der Bürgermeister“, schüttelte er den Kopf.
Zu Hause entkorkte der Gustl eine Flasche Zweigelt, vom Weingut Hannes Igl, Niederösterreich. Biobauer stand auf dem Etikett. Er rief den Gottfried an. „Weiß eh, dass du nichts trinkst, aber ... kommst kurz rüber?“
Gottfried wusste, dass Gustl in solchen Momenten nur ein offenes Ohr brauchte, jemanden der seinen Gedanken und Ausführungen zuhört. Meistens sprach er in einem Monolog über Gott und die Welt. Manchmal hatte der Gottfried das Gefühl, die Vorzeichen hätten sich umgekehrt. Nun trank oft der Gustl viel zu viel Wein und Gottfried versuchte ihn zu stabilisieren.
„Er ist so ein oberwichtiger Wichtling, der Herr Ortsvorsteher, der Schrebergartendiktator, mit seinem Zahnpasta-Lachen ... Glaubt, der Ort ist seine Privatangelegenheit. Lebensqualität hört offenbar bei seinem Gartenzaun auf. Alles, was außerhalb liegt, ist ihm völlig egal. Er wäre dem Gemeindewohl verpflichtet? Das wird er anders gemeint haben ... uns hat er gemeint, die wir ihm beipflichten sollten ... Ja! Das hätte er gern. Brave Bürger, die ihn wählen und dann schalten und walten lassen, ohne auch nur nachzufragen. So sind diese Leute eben ... und die Welt wird sich wohl so schnell nicht ändern.“
Und noch ein Glas Wein vom Hannes Igl, Biobauer ... um des Genusses Willen – auch um betrunken zu sein, um zu vergessen. Vor allem aber wegen der Schmerzen.
Das letzte EKG war nicht unbedingt zur Zufriedenheit der Ärzte ausgefallen. Schonen sollte er sich, aber schonen, das hieß schon wieder so ein bisschen Mund zu und akzeptieren, damit dann so Leute wie der Bürgermeister ihre gesegnete Ruhe haben.
„In Wels drüben stehen Wohnungen frei. Ich hab beim Bauausschuss der Landesregierung angerufen, die sagen, dass im Bereich Wels ein gehöriger ,Wohnungsüberschuss‘ besteht. Für Thalheim ist angeblich überhaupt nur ein einziger Wohnungssuchender vorgemerkt – der in der Stadt drüben auf Anhieb fünf Wohnungen beziehen könnte ...
Und trotzdem soll da vor unseren Fenstern ein geförderter Wohnbau mit so um die vierzig Wohnungen entstehen ... für sozial Bedürftige, so ein Wahnsinn! Ich sag’s dir, der Bürgermeister und sein feiner Freund Fellinger von der Novum, die kassieren da mit. Die verdienen sich mit solchen Vergaben eine goldene Nase – die sind korrupt. Korrupte Hunde. So ist die Welt ...“
„He – mach mal einen Punkt!“, versuchte ihn Gottfried zu beruhigen, „wir werden tun, was wir tun können, dieses Projekt zu verhindern, aber wirklich wehren, dazu fehlen uns die Mittel – das letzte Wort hat der Bürgermeister ...“
„Ja, aber so ein Bürgermeister kann einem das Dasein verleiden. Vielleicht ist es ohnehin besser, wenn es dann einmal vorbei sein wird. Leben heißt leiden, sagen die Buddhisten. Sterben ist Erlösung, meinen die Katholiken ...“
Mit Gustl war nicht gut reden, wenn er in so einer Stimmung war. Dann kam er vom Hundertsten ins Tausendste. Er schenkte sich nach.
„Weißt du Gottfried, so ein klein wenig sind wir sicher alle wie dieser Bürgermeister ... suchen den geringsten Widerstand, sind auf den eigenen Vorteil bedacht. Aber Gelegenheit macht Diebe – und dieser Edtauer sucht jede Gelegenheit. Die einfachen Leute, die Masse, die arbeiten acht bis zehn Stunden am Tag, die haben dazu keine Gelegenheit. Die arbeiten hie und da einmal schwarz und verdienen sich einen Hunderter zusätzlich, das ist alles. Und sogar den Hunderter geben sie sozusagen im Sinn der seltsamen Volkswirtschaft aus – kaufen sich einen Fernseher oder sonst einen Blödsinn, weil sie für aktive Freizeitbeschäftigung zu müde sind. Da ist es schon leichter, sich berieseln zu lassen.
Und diese Berieselung zerstört die Menschen. Nimm das Fernsehen. Du brauchst nur bei einem der dämlichen Werbespots den Ton abdrehen und die Leute blöd grinsend durch die Gegend hampeln sehen, oder bei irgend so einer Seifenoper die Augen schließen und den wirklich schwachen, ewig gleichen Dialogen zuhören ...
Nach einer Schicht in der Fabrik, wo du acht oder zehn Stunden lang die produzierten Stücke gezählt hast. Das ist wie ein Leben lang auf einer Autobahnbrücke stehen und die Autos zählen, die vorbei fahren ... irgendwann springt man.
Handwerk ist nichts mehr wert. Rationell muss alles sein. Die Vereinfachung erhöht den Lebensstandard. Sagt man. Dabei zerstört sie das Denken. Der Bauer muss nicht hart am Feld schuften, sondern sitzt am Traktor. Der Maschinenschlosser fräst und dreht nicht mehr, er überwacht die Arbeiten eines Computers. Die Hausfrau putzt und schrubbt nicht mehr, sie saugt, die Wäsche erledigt auf Knopfdruck eine Maschine, vollautomatisch.
Trotz dieser Erleichterungen arbeiten alle wie die Blöden und vielleicht noch zusätzlich in der Freizeit schwarz, damit sie sich den Fernseher auch leisten können, mit dem sie dann ihren letzten Rest Freizeit verbringen. Oder das Fitnessstudio, weil sie sonst zu wenig Bewegung haben.
Zweifellos, die organisierte Welt bietet unendliche Vorteile und Möglichkeiten. Nutzen können diese Vorteile allerdings nur wenige. Nutzen können sie nur jene, die an den Schalthebeln sitzen – und wenn es die einer Gemeinde sind.
Aber der Edtauer ist schon so ein Kerl, der müsste doch eigentlich für seine Gemeindebürger da sein, stattdessen vertritt er nur das Interesse des reichsten Bauherren im Ort und so einer schimpft sich Sozialdemokrat ...“
Gottfried wurde es irgendwann zu viel. Er kannte den Text. Auch Gustl wiederholte sich mit seinen Ausführungen wie ein Schichtarbeiter am Fließband. „Ich geh jetzt rüber“, sagte er, „muss morgen wieder früh raus ...“
Gustl nickte nur, „Ok. Mach das. Gute Nacht – wir geben nicht auf, Gottfried! Wir geben nicht auf! Den werden wir biegen, den Vorgartentyrannen ...“
„Ja machen wir!“, lachte sein Cousin, dann fiel die Tür ins Schloss.
Gustl fühlte sich krank. Da war wieder dieses fiebrig-elektrische Kribbeln in der Magengegend, dieses Ziehen in der Schulter, den Arm entlang bis in die Fingerspitzen und das Druckgefühl oberhalb des linken Oberschenkels.