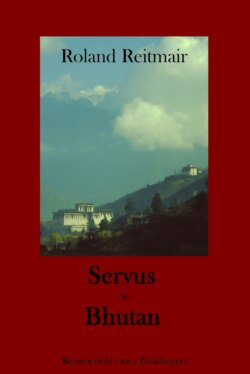Читать книгу Servus in Bhutan - Roland Reitmair - Страница 7
Licht ins Dunkel.
ОглавлениеErst 1616, als Shabdrung Namgey Nawang auf eine politische Einigung drängte und in einigen Kriegen „die südlichen Täler“ befriedete – wie das dann immer so schön heißt, wurde Bhutan geboren.
Shabdrung festigte seine Herrschaft durch die Errichtung von Klosterburgen, den Dzongs, je eine für jede Provinz.
Diese Dzongs sind selbst heute noch politische Verwaltungseinheit, als auch Klosterschulen, und vereinen weltliche und geistige Macht.
Der Name Bhutan kommt vom indischen Wort Bhotanta – „Ende Tibets“ – das heißt „Grenzgebiet zu Tibet“.
Die Bewohner Bhutans nennen ihr Land Drukyel, das Land des Drachen.
Die Herrschaft gemäß Shabdrungs System war eine Theokratie.
Im 19. Jahrhundert konnten sich die Bhutanesen auch erfolgreich gegen die Hegemoniebestrebungen Großbritanniens im Himalaya-Gebiet wehren. Sie behaupteten ihre Stellung, indem sie die politischen Verhältnisse nützten und als Vermittler zwischen Tibet und der englischen Krone auftraten. Bhutan ist somit das letzte und einzige der 7 Himalaya-Königreiche, das der aggressiven Expansionspolitik diverser Nachbarn standhalten konnte, beziehungsweise durch seine Abgeschiedenheit auch gar nicht interessant war.
Seit 1907 ist Bhutan eine Monarchie. Trotzdem gilt das Shabdrung-System immer noch als Vorbild in Verwaltung und Rechtssprechung.
Der Großvater des jetzigen Herrschers versuchte zu Beginn der 60er das Land aus dem Mittelalter in die Neuzeit zu führen.
Er gilt als Gründer des modernen Bhutans.
Erst 1962 begann Planung und Bau einer Verkehrsverbindung zwischen der Hauptstadt Thimphu und Phuentsholing, einer Grenzstadt zu Indien. Es folgten weitere Straßenbauprojekte, durch die das Land systematisch aufgeschlossen werden sollte.
Bhutan ist seit 1971 Mitglied der Vereinten Nationen und seit 1973 bei der Gemeinschaft Blockfreier Staaten.
Mit Indien stellten sich, aufgrund des diplomatischen Geschicks des Königs, auch westliche Industrieländer an, um Entwicklungshilfe zu leisten.
So bauten Dänen die Kanalisation für die Hauptstadt, Japaner installierten ein Telefonnetz, Schweizer beschäftigen sich mit moderner Land- und Forstwirtschaft und vieles mehr.
Das Land des Drachen machte seither einige radikale Veränderungen durch, und es schien nicht immer klar, ob der ab 1972 regierende König Jigme Singey Wangchuk, Erbmonarch und Vater des momentanen Königs Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, die Gratwanderung zwischen Kulturerhaltung und Öffnung zur Moderne schaffen würde.
Österreich beteiligte sich anfangs mit Kraftwerksprojekten und einem Tourismusprojekt, die Außenhandelsbilanz Bhutans aufzubessern und unterstützte damit die Unabhängigkeit des Landes (von Indien). Angesichts der Holzreserven des Landes (vom König gehütet, wie sein eigener Augapfel) wurde später die Idee zu einem Forstprojekt geboren, das die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder zum Ziel haben sollte.
In Bhutan fallen speziell im Sommer, aber auch im Winter ergiebige Monsunniederschläge. Der Boden ist sehr lehmig und durchfeuchtet. Sobald ein wenig Wald aufkommt, gibt er selbst so viel Schatten, dass nur mehr ein auf tiefe, kühle und feuchte Böden ausgesprochen spezialisierte Baumart überleben kann. Das ist der Grund für ausgedehnte Tannenurwälder in einer Höhe zwischen 3500m und 4000m.
„Never touch the firs!“ sagten die Experten einhellig, bevor das Forstprojekt gestartet wurde. Sie meinten damit eben den Forstbestand in den extremen Höhenlagen. Sie gingen von einer zu geringen Regenerationsfähigkeit der Wälder aus, als dass hier jemals eine wirtschaftlich rentable Holzernte stattfinden könnte – ohne dabei die Urwälder massiv zu zerstören.
Das Negativbeispiel Nepal zeigte „eindrucksvoll“, wie schnell und unwiederbringlich diese Wälder verschwinden können.
Die Königsfamilie in Bhutan war nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen in Nepal, über Maß für Ökologie und vor allem für die Wälder engagiert.
Es galt also – unter dem royalen Argusauge – Wege zu finden, die eine Holzernte ermöglichten und doch dem extrem empfindlichen Ökosystem Rechnung tragen würden.
Ura (eine Ortschaft in der zentral gelegenen Provinz Bumthang) wurde als Stützpunkt für das Projekt bestimmt. Die Gegend und auch der Neigungsgrad der Hänge, wo die Holzbringung organisiert werden sollte, erinnern an Waldrücken österreichischer Topographie.
Eine Forststraße müsste gebaut und der Holztransport bis zur Straße via Seilkran eingerichtet werden.
Die Rahmenbedingungen waren also wie geschaffen für österreichische Forstwirte und Ökologen.
Nach Jahren der Planung und Konzeptentwicklung begannen Spezialisten der Universität für Bodenkultur in Wien, gemeinsam mit Experten aus Bhutan systematisch die Projektziele zu erarbeiten. Damals war wirklich noch keine Rede von einem Projektdorf, damals hausten die „Pioniere“ tatsächlich noch in Zeltlagern.
Zu Beginn des Projektes beauftragte Österreich ein spezialisiertes Büro in Wien, einen sogenannten Implementing Agent, mit der reibungslosen Projektabwicklung.
Ein „Laison Office“ (ein Koordinationsbüro) wurde in Thimphu eingerichtet. Dann wurde mit dem Bau des „Projektdorfes“ in der Nähe von Ura begonnen. Quartiere, eine „Community-Hall“ und ein Bürogebäude wurden errichtet.
Dort würde ich hauptsächlich tätig sein, Löhne auszahlen, Buchhaltungsarbeiten durchführen und den Manager bei Organisationsentscheidungen unterstützen.
Das Projekt lief noch nicht wirklich (vor allem hatte man sich dem eigentlichen Kerngeschäft „Holzbringung“ noch kaum genähert), tauchten bereits bei der Schaffung der geeigneten Rahmenbedingungen gravierende Probleme auf.
Durch eine unglückliche Personalkonstellation auf Österreichischer Seite, beziehungsweise die unglückliche und unbedachte Art und Weise, wie man das zuständige Personal „zusammengewürfelte“ hatte, führte dazu, dass die Situation schwierig wurde.
Zum Beispiel rekrutierte man einen jungen Ökologen, frisch von der Uni, quasi als Kontrast zu einem alten, erfahrenen Mechaniker, kurz vor der Pension, als Chef der „Maschinenabteilung“ (der bisher vor allem in Afrika in der Entwicklungshilfe gearbeitet hatte). Beide hoch motiviert.
Eines Tages beobachtete der Ökologe, wie der Mechaniker Altöl auf dem sandigen Platz vor der Werkstatt verteilte. Mit hochrotem Kopf stellte er ihn zur Rede, „was machst du da? Bist du verrückt…??!“
Da war der Mechaniker noch relativ gelassen und ruhig. „Wir teeren den Platz quasi – es staubt immer so, da kriegt man ja Lungenkrebs…“
Einige Sätze weiter war der „unschlichtbare“ Streit fertig.
Mit Vorkommnissen wie dem geschilderten, stand plötzlich der ganze „Projekterfolg“ in Frage.
Angesichts der Probleme bestellten die zuständigen Herren im österreichischen Ministerium einen zusätzlichen Implementing Agent. Diesmal ein Tiroler Büro, das dem in Wien an die Seite gestellt wurde. Ersetzen ging offenbar nicht – was immer die (politischen) Gründe dafür waren. Nun hatte das Projekt quasi zwei österreichische „Chefitäten“.
Die Tiroler waren wenigstens in Sachen Entwicklungshilfe an sich sehr erfahren. Sie leiteten auch das Tourismusprojekt in Bhutan, das vom offiziellen Bhutan absolut geschätzt wurde.
Damit sollte Ruhe ins Projekt kommen.
Die Tiroler „overrulten“ einige Entscheidungen, bestellten einen neuen Mechaniker und übernahmen die Koordination des Projektes zwischen Österreich und Bhutan. Allerdings hatte der „alte“ Implementing Agent immer noch die Budgethoheit… Probleme vorprogrammiert.
Der Projektverantwortliche des neuen Tiroler Implementing Agents würde gerade im Lande verweilen, für notwendige Konferenzen und Besprechungen.
Er war noch in Ura und ich sollte in Thimphu zwei Tage warten bis er zurückkäme.
Ich würde also Zeit haben mich ein bisschen einzugewöhnen.
„… Soweit das nötige Technische“, sagte Gunther und lehnte sich zurück.
Gunther redete gern – schien aber auch zu wissen, was hier wie lief und er wusste zu allem noch eine Geschichte dazu. Die wandelnde Chronik.
All seine Geschichten hatten dabei genug Spielraum für Witz, ein Augenzwinkern und die dichterische Freiheit, ohne die das Projektvegetieren im Stumpfsinn enden würde.
Da kam es dann schon einmal vor, dass er von seinem morgendlichen Post-Gang erst nach einem Abendessen im Benez zurückkam.
Auch an jenem Tag war das beinahe so. Am Nachmittag plagte uns der Hunger und Gunther bestellte für sich und den Neuling „Momos“ (eine Nudelspeise, ähnlich unseren „Schlutzkrapfen“) mit Soße.
„Was ist das für eine Soße?“
„Tomatensoße - Hast du noch genug Bier?“ Ja ich hatte.
Dann wurden die Dinger serviert.
Mir ist bei Speisen, die ich nicht kenne, immer lieber vorsichtig abzuwarten. Wir hatten jeweils einen Blechteller mit einigen von diesen überdimensionalen Ravioli und noch je eine diskusgroße Schüssel mit Tomatensoße oder eben Tomatenmark der Konsistenz nach. Kein Besteck.
Ich wartete.
Gunther redete und machte keine Anstalten endlich zu essen.
Noch waren die Nudeln heiß. „Wie isst man das?“ fragte ich. Gunther nahm ein Momo in die Hand, tauchte es satt in die Tomatensoße, dass die Teigtasche einen überdimensionalen roten Gupf hatte, wie eine Weihnachtsmütze. Da fiel ihm schon wieder irgendwas zu erzählen ein…
Also nahm ich auch eines, tauchte es wie er ordentlich ein und steckte es in den Mund.
Ahhhrrrgchch. Tränen schossen mir in die Augen. Trotz Momo im Mund versuchte ich Luft zu holen. Dem Reflex alles wieder auf den Teller zu spucken, konnte ich gerade noch widerstehen.
Das war Chili pur. Mein Mund war wie verätzt. Das Zeug schlucken und schnell Bier nachtrinken. Doch mit Kohlensäure wurde alles nur noch schlimmer.
Nur langsam bekam ich wieder normal Luft, und wischte mir die Augen. Dachte, ich hätte den Geschmackssinn verloren.
Gunther freute sich diebisch. Er lachte. „Hast nichts gerochen? Dass das scharf ist?“
Nach einiger Zeit ging‘s aber wieder. Die „Momos“ schmeckten gut.
Mit Tomatensoßen und solchen, die Chili dafür ausgaben, war ich ab sofort vorsichtig.