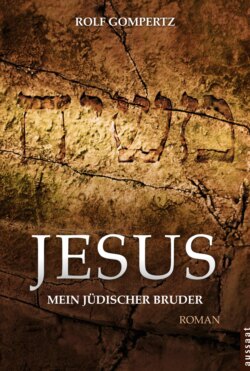Читать книгу Jesus - mein jüdischer Bruder - Rolf Gompertz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Kapitel: Der Messias
ОглавлениеAm nächsten Morgen verließ Judas das Haus des Schlachters und machte sich auf, die Stadt zu verlassen. Er näherte sich dem Stadttor, ohne zu wissen, wohin er eigentlich gehen wollte. Als er schließlich durch das Stadttor Magdalas trat, sah er, dass der senkrechte Balken des Kreuzes noch stand. Der Leichnam war abgenommen worden, doch der Balken war stehen geblieben.
Als Judas dort im Schatten des Kreuzes stand und darüber nachdachte, wohin er gehen sollte, sah er, wie zur Antwort, aus der Ferne einen Mann kommen. Irgendwie kam er Judas vertraut vor, und als der Mann schließlich näher herankam und Judas sein Gesicht erkennen konnte, wechselten sich Verblüffung und Freude ab.
«Jesus!», rief er, ging ihm entgegen und begrüßte ihn. «Schalom!»
«Schalom, Judas», antwortete Jesus und sah Judas erwartungsvoll an.
Ein Fremder, der die Szene beobachtet hätte, hätte diese beiden Männer für Brüder halten können. Beide waren etwa gleich groß, kräftig und sehnig, hatten dunkles Haar und trugen einen Bart.
Fast wie Zwillinge sahen sie aus, obwohl Jesus schon dreißig Jahre alt war und Judas erst Anfang zwanzig.
«Was führt dich hier her?», fragte Judas und wusste nicht wohin mit seiner Freude.
«Ich bin auf dem Weg nach Kapernaum», antwortete Jesus, «und du, mein Freund?»
«Ich bin nach Magdala gekommen…», Judas suchte nach einer Erklärung, suchte nach den richtigen Worten, doch als er Jesus in die Augen sah, war seine Antwort klar:
«Ich habe Barabbas aufgesucht, weil ich den Zeloten beitreten wollte», sagte Judas kleinlaut.
Jesus betrachtete ihn aufmerksam.
«Und…?»
«Ich konnte nicht töten!», erklärte Judas.
Jesus sah erleichtert aus. «Warum wolltest du dich ihnen anschließen?»
«Ich wollte die Römer aus dem Land vertreiben», gestand Judas und zögerte.
«Und was noch?», fragte Jesus und musterte Judas forschend.
«… und ich wollte, dass endlich das messianische Königreich beginnt», schloss Judas.
Jesus lächelte. Er schien erfreut. Dann sah er Judas wieder nachdenklich an.
«Meinst du, es ist nahe?», fragte er ihn.
«Ja», sagte Judas, «ganz Israel erwartet es.»
«Aber du, Judas, meinst du das auch?»
Judas zögerte, bevor er eine Antwort gab.
«Ich denke schon, ja», sagte er schließlich.
«Was hat dich dann gehindert, Judas?», fragte Jesus.
«Zu töten, meinst du?» Judas dachte nach. «Ich weiß es nicht genau, ich habe gedacht, dass ich es könnte, vielleicht war ich feige, vielleicht hat Gott es mir eingegeben. Ich weiß es nicht.»
«Die Zeloten werden das messianische Königreich nicht bringen», sagte Jesus plötzlich mit unmissverständlicher Autorität, «es gibt nur einen Weg, einen besseren Weg.»
Judas sah Jesus erstaunt an. Bei ihm hatte er das Gefühl, alles tun zu können, über sich hinauswachsen zu können, bedeutsam zu sein oder zumindest an etwas Bedeutsamen teilzuhaben. Die gleichen Gefühle von Macht und Autorität bei Jesus hatte er auch vor drei Jahren verspürt, als sie sich das letzte Mal in Jerusalem gesehen hatten.
«Wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst, mein Freund», sagte Jesus, «dann schließ dich mir an. Komm mit, begleite mich ein Stück.» Mit diesen Worten wandte sich Jesus um und Judas folgte ihm.
Während sie gingen, musste Judas an ein Abendessen vor drei Jahren denken, das im Hause seiner Eltern stattgefunden hatte:
Das Abendessen verlief wie erwartet. Nichts liebte Judas’ Mutter Dinah mehr, als dass es perfekt lief. Beim Einkauf den letzten modischen Schrei zu erwerben und dabei prominente Leute zu treffen, das war ihr Lebensglück. Auch wichtige Leute von Stand einzuladen, sie zu unterhalten und zu zeigen, was sie hatte, bereitete ihr das allergrößte Vergnügen. In gewisser Hinsicht gehörte beides zusammen, machte eins das andere nötig. Und beides geschah, weil sie sich daran ergötzte und sie somit ihren sozialen Status untermauerte. Sie zeigte sich gern, und sie zeigte gern, was sie hatte.
Dinah gab sich leicht beleidigt, weil Hannas, der ehemalige Hohepriester, und seine Frau ihre Einladung zum Abendessen nicht angenommen hatten. Hannas war bekannt dafür, dass er sich nicht für vorgeschobene Zwecke vereinnahmen ließ, und deshalb hatte Dinah bei ihm auch keinen Erfolg mit einer Einladung gehabt. Obwohl Hannas in seiner Amtszeit von den Römern vor zehn Jahren abgesetzt worden war, war er politisch dennoch immer noch die wohl einflussreichste Person in Jerusalem und im ganzen Land. Jeder wusste, auch die Römer, dass er der inoffizielle Sprecher der sadduzäischen Oberschicht und der Priesterschaft war. Jeder erkannte in ihm die treibende Kraft, die hinter seinem Schwiegersohn Kaiphas stand, der nach ihm das Amt des Hohepriesters innehatte. Eines Tages, so dachte Dinah, würde er ihre Einladung annehmen, und sie würden dann auch von Hannas eingeladen werden.
Deshalb hatte sie schließlich Kaiphas und seine Frau zum Abendessen gebeten. Aber es hatte auch noch andere Gründe für diese Entscheidung gegeben. Ihr Mann war ein angesehener Arzt in der Stadt und es kam öfter vor, dass er wichtige Patienten zu sich nach Hause einladen musste, um ihnen seine Wertschätzung zu zeigen. An diesem Abend war Rabbi Gamaliel mit seiner Frau geladen, denn schon seit einiger Zeit hatte sich Dinah gesellschaftlich verpflichtet gefühlt, den Rabbi wieder einmal bei sich zu bewirten. Dinah glaubte an geplante Beziehungen, doch es war nun einmal auch Tatsache, dass es nicht zu ihren Traumvorstellungen gehörte, den Abend nur mit Rabbi Gamaliel und seiner Frau zu verbringen. Dinah fühlte sich in der Gegenwart des alten Mannes einfach unwohl.
Erstens gehörte er nicht zu ihrer Gesellschaftsschicht, und zweitens traf er ganz gewiss nicht ihre Wellenlänge. Keiner konnte gut mit ihm, er war einfach grässlich.
Aus dieser Not heraus machte sie eine Tugend und lud zusätzlich den Hohepriester ein. Er vermochte mit Rabbi Gamaliel wenigstens halbwegs umzugehen. Die Gäste kamen und Dinah ging in ihrer Rolle als perfekte Gastgeberin auf. Sie geleitete die Gäste ihrer Wertschätzung nach an den Tisch, und diese Reihenfolge machte die Wertschätzung der Eingeladenen mehr als deutlich. Die mittleren Plätze des Sofas, die Ehrenplätze, belegten der Hohepriester und seine Frau Sarah. Links von ihnen, an zweiter Stelle der Rangfolge, stand eine Liege, auf der Gamaliel, Rebecca und Jesus zu Tisch lagen.
Die dritte Liege und somit der unbedeutendste Platz stand rechts von Kaiphas und war von Simon, Dinah und ihrem Sohn Judas besetzt.
«Ich sollte wirklich nicht», protestierte Rebecca, als sie eine weitere Portion Fleisch annahm, die Dinah ihr aufnötigte.
Gamaliels Frau war wunderschön. Zudem war sie für ihren ausgesprochen starken Gerechtigkeitssinn und ihre feste Werteorientierung bekannt. Sie hatte ausgeprägte Vorlieben und Abneigungen, konnte aber gut vor anderen verbergen, was sie dachte. Sie liebte ihren Mann und sie schätzte Dinah nicht, von der sie wusste, dass sie Gamaliel nicht mochte.
«Wenn Ihr schon einmal eingeladen seid, dann müsst Ihr auch essen», scherzte Simon, «sonst ist meine liebe Frau beleidigt und Ihr werdet nicht mehr eingeladen.» Was als Scherz gemeint war, enthielt doch viel an Wahrheit, und Rebecca hätte das durchaus gefallen. Laut aber schmeichelte sie, da sie die Formen der Höflichkeit nicht nur kannte, sondern auch geradezu perfekt beherrschte: «Ich fürchte, lieber Doktor, wenn ich zu viel esse, werde ich krank, und das wollt Ihr doch nicht.»
«Das ist gut für’s Geschäft!», lachte Simon.
Alle lachten mit.
«Simon!», Dinah wies ihren Mann mit gespieltem Vorwurf zurecht.
«Na ja, wir müssen ja auf irgendeine Weise zurückbekommen, was wir für dieses Essen bezahlt haben», sagte er herausfordernd. Wieder lachten alle, doch sie schienen nicht nur mit ihm, sondern auch über ihn zu lachen.
Simon war der Sohn Reuels, eines kleinen Händlers im nahe gelegenen Kerioth, und er hatte sich diese doch recht gehobene Position in Jerusalem erarbeitet. Ohne Frage, er war sehr fähig und hatte sich seine Stellung ehrlich verdient. Zudem war er ein sehr gefragter Arzt der Oberschicht. Dennoch, dachte nicht nur Rebecca, er handelte nach wie vor wie der Sohn eines Kaufmanns und hatte auch ein solches Benehmen. Nie hätte ein anderer Mann in dieser Position gewagt, einen solch unangebrachten Scherz zu machen.
«Oh, du bist entsetzlich», sagte Dinah mit gespielter Verzweiflung, «hört gar nicht so genau hin, was mein lieber Gemahl sagt.»
«Gerade weil ich das getan habe», sagte Kaiphas mit einem blinzelnden Auge, «nehme ich gleich noch eine Portion Eures köstlichen Lammes. Mal sehen, ob ich auf den Gegenwert unseres Honorars komme!»
War Kaiphas entspannt und bei Laune, gab er einen guten Gesellschafter ab, er hatte den Scherz aufgegriffen und so die Stimmung entspannt. Dinah schweifte mit ihren Augen zwischen den beiden Männern, die sie eingeladen hatte und die nicht unterschiedlicher hätten sein können, hin und her. Kaiphas auf der einen Seite konnte hervorragende Geschichten erzählen, war gesellig und charmant. Obwohl er gerade einmal dreißig Jahre alt war, hatte er bereits Intellekt und Weisheit eines betagten Mannes, setzte beides sehr vorteilhaft ein und war fraglos bereits ein fähiger Mann in Fragen der Gesellschaft, der Religion und der Politik. Er liebte die Macht und er hatte Macht. Er wusste, wie sie gebraucht wurde und er gebrauchte sie.
Rabbi Gamaliel andererseits war ein viel älterer Mann, aber sein Geist schien kein Alter zu kennen und war nicht zu ermüden. Sein Gesicht war geprägt durch zwei tiefliegende Augen, die in ständigem Lächeln zu blinzeln schienen. Seine Augenbrauen waren voll. Freundlichkeit formte seine Lippen. Seine kräftige, semitische Nase ragte stolz aus seinem breiten und doch fein geformten Gesicht. Er strahlte Lebens- und Sinnenfreude aus. Nur das silbrig-schwarze Haar, das obenauf bereits etwas gelichtet war, und sein leicht gewölbter Bauch verrieten sein Alter.
Rabbi Gamaliel war der Sohn des Simon und Enkel des großen Hillel. Er war der erste Gelehrte, der mit dem Titel Rabban geehrt wurde, was so viel bedeutete wie unser Lehrer und eine große Auszeichnung und Ehre darstellte. Er war Pharisäer und Vorsitzender des Großen Synhedrions, des höchsten religiösen Leitungsgremiums im Lande. Er war im Volk sehr beliebt und von seinen Kollegen hoch geschätzt, und doch konnte Dinah ihn einfach nicht leiden.
«Seid Ihr allein hierhergekommen?», fragte er und wandte sich dabei mit nicht zu verbergender Neugier Jesus zu.
«Nein», sagte Jesus, «mein guter Freund Judas hier hat mich begleitet.»
«Ihr kommt aus Galiläa», stellte Gamaliel fest, «Ihr sprecht in jenem Dialekt, der dort verbreitet ist.»
«Ja», gab Jesus zu, «ich bin zum Laubhüttenfest hierhergekommen, und da ich ein paar Tage zu früh bin, waren Judas’ Eltern so freundlich und gewährten mir ihre Gastfreundschaft.»
Kaiphas war gelangweilt. Er hatte keine Lust, sich mit einem Provinzler zu unterhalten. Da aber auch er den Regeln der Höflichkeit folgte, beteiligte er sich scheinbar interessiert am Gespräch.
«Woher aus Galiläa?», fragte er.
«Aus Nazareth», entgegnete Jesus.
«Oh», entwich es Kaiphas und er konnte nun doch seine Herablassung nicht mehr verbergen.
Doch Rabbi Gamaliel schien darüber hocherfreut zu sein und bevor irgendjemand auf die offensichtliche Unhöflichkeit des Hohepriesters reagieren konnte, sagte er sehr freudig und in herzlichem Ton:
«Ich bin dort einmal gewesen. Es ist eine liebenswerte und hübsch anzusehende Stadt.»
«Ja», sagte Jesus und erwiderte sein Lächeln, «ich finde sie auch sehr schön – vielleicht, weil es meine Heimat ist.»
Gamaliel lächelte. Die Antwort gefiel ihm.
«Habt Ihr dort eine Familie?», wollte Kaiphas wissen. Er versuchte höflich zu sein, für den Fall, dass das von Bedeutung wäre. Aber daran zweifelte er.
«Ja», sagte Jesus, «ich lebe dort mit meinen Eltern. Ich habe noch vier Brüder und zwei Schwestern.»
Der Hohepriester runzelte die Stirn.
«Sie sind nicht mitgekommen?» Kaiphas’ anklagender Ton war unmissverständlich.
«Sie konnten nicht», erwiderte Jesus ruhig, «sie haben mich als Stellvertreter der Familie geschickt.»
Nach dem Gesetz war das erlaubt, aber es bedeutete entweder, dass die Familie krank war, oder, dass sie einfach nicht die finanziellen Mittel für diese Reise hatte. Kaiphas schätzte, dass das Letztere zutraf.
«Welchen Beruf übt Euer Vater aus?», fragte Kaiphas.
«Er ist Zimmermann», gab Jesus bereitwillig Antwort, «es geht ihm in letzter Zeit nicht gut.»
«Ich verstehe». Kaiphas Ton war wieder herablassend. Seine Vermutung hatte sich bestätigt. Es machte keinen Sinn, sich mit Jesus zu beschäftigen. Es war reine Zeitverschwendung. Dinah hatte das Gefühl, sich für ihren offensichtlich unpassenden galiläischen Gast entschuldigen zu müssen.
«Meine und seine Mutter waren befreundet», erklärte sie. Sie war erleichtert, als Kaiphas duldsam zu ihr herüberlächelte.
«Also», sprach Simon, «wie steht’s, wie geht’s?»
«Womit?», fragte Kaiphas, der jedoch genau wusste, was der Arzt meinte.
«Mit dem neuen Prokurator, natürlich!», sagte Simon und stellte seinen Teller auf den Tisch.
«Pontius Pilatus», sagte Kaiphas mit einem Stöhnen in der Stimme. Er hätte diese Diskussion gerne vermieden, nicht wegen der Meinung Simons, sondern wegen Gamaliel. Simon war nur neugierig, er wollte nicht mehr als eine Bestätigung, dass alles in Ordnung war. Gamaliel aber wollte möglicherweise tiefergehende Informationen haben, eine Argumentation führen, diskutieren. Das war Kaiphas zu heikel und zu anstrengend und er wünschte sich, er wäre mit seiner Aufmerksamkeit bei Jesus und seinen Familiengeschichten geblieben.
«Ich bin zuversichtlich, dass wir mit ihm leben können», sagte der Hohepriester schließlich vorsichtig und eher verhaltend als mit Nachdruck.
«Wirklich?», sagte Simon neugierig, «meint ihr das!»
«Ja, das meine ich», sagte Kaiphas nun doch mit Nachdruck.
«Wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass er Römer ist, ja, und er wird einige Schwierigkeiten haben, uns und unsere Kultur, unsere Religion zu verstehen. Ich bin sicher, dass er seine Fehler hat, wie jeder andere auch, aber ich bin überzeugt davon, dass man mit ihm gut auskommen kann. Er macht ehrliche Versuche, sich uns anzunähern, und wenn wir ihm auf halbem Weg entgegengehen, sehe ich keine größeren Probleme auf uns zukommen.»
«Der Anfang seiner Amtszeit zeigte das ja ziemlich deutlich!», sagte Rabban Gamaliel trocken.
«Woran denkt Ihr?», fragte Kaiphas, obwohl er zu wissen meinte, von welchem Vorfall der Rabbi sprach.
«An die Tatsache, dass er seine Soldaten die römischen Standarten in Jerusalem aufstellen ließ», erwiderte Gamaliel sarkastisch, «ein wirklich guter Beweis für seine Mühe, mit uns gut Freund sein zu wollen.»
«Aber, aber, mein lieber Rabban», wiegelte Kaiphas ab, «das und was daraus folgte war doch nur das Ergebnis eines Missverständnisses. Die Standarten waren schließlich verhüllt, wie Ihr wisst. Er glaubte, es wäre alles in Ordnung, wenn er die Bildnisse des Kaisers bedeckt hielte. Er wollte niemanden beleidigen.»
«Und doch brachte er sie im Schutze der Nacht in die Stadt», erinnerte Gamaliel ihn ruhig, «und dass er es überhaupt für nötig hielt, Standarten aufzustellen, auch wenn sie verhüllt waren, wozu? Die Logik befiehlt, dass man zu dem Schluss kommen muss, dass Pontius Pilatus genau wusste, was er tat. Von Anfang an wollte er uns nicht freundschaftlich entgegenkommen, sondern seine Verachtung für uns ausdrücken!»
Der Hohepriester sah Gamaliel mit jenem nachsichtigen Lächeln an, das allzu clevere jugendliche Köpfe gern gegenüber starrsinnigen, alten Leuten zur Schau stellen.
«Ihr seid der beste Beweis für meine These», sagte Kaiphas, «dass viele von uns in allem gleich das Schlimmste sehen.»
«In allem Römischen meint Ihr wohl, lieber Kaiphas», vermutete Gamaliel.
«Ja», stimmte Kaiphas mit Bedacht zu, «wir sehen in allem Römischen immer gleich das Schlimmste. Wir treiben es so weit, dass wir es mit unseren Ansichten und unserem Widerwillen selbst hervorrufen.»
«Wie unterscheidet Ihr Anbiederung und Katzbuckelei von Diplomatie? Wie wollt Ihr Euch dem Römischen Reich nähern, ohne unsere Kultur und insbesondere unsere Religion zu verraten? Ich für meinen Teil glaube, der Grat ist schmal», entgegnete der Rabbi gelassen.
Dinah hielt die Luft an. Das war mehr als eine harmlose Kritik.
Doch auch in solch schwieriger Situation blieb Kaiphas ruhig, obwohl es unter seiner Oberfläche schwelte.
«Ich möchte mich nicht mit Euch streiten, mein Guter», sagte Kaiphas und schien die Kritik einfach zu überhören, «aber Pilatus handelte in gutem Glauben.»
«Ich hätte Pilatus nur zu gerne zugebilligt, einen harmlosen und unbedachten Fehler gemacht zu haben», sagte Gamaliel, «doch hat nicht der Kaiser selbst das Gebot erlassen, die religiösen Sitten und Gebräuche der verschiedenen Provinzen zu respektieren, solange sie Rom nicht bedrohen? Ihr könnt sagen, was Ihr wollt, aber ich glaube immer noch, dass Pilatus mit Kalkül gehandelt hat.»
«Aber hat er nicht gleich darauf die Standarten zurückgerufen?», fragte Kaiphas, der sich nun doch auf das Argumentieren einließ.
Gamaliel lachte.
«Gewiss», sagte er, «nachdem er sie aufgestellt hatte, diese Tatsache bleibt. Und, Kaiphas, habt Ihr denn den Aufstand vergessen, der ihn dazu zwang, diesen Schritt rückgängig zu machen? Glaubt Ihr wirklich, er hätte die Standarten von selbst wieder abgenommen? Ich sage Euch, nein, das hätte er nicht. Nie im Leben hat er damit gerechnet, dass so viele Juden nach Caesarea hinabziehen, als er seine Fünf-Tage-Konferenz abhielt, um dagegen zu protestieren. Erinnert Ihr Euch, wie er seine Soldaten die Menge umstellen ließ? Wie er hinausrief, dass die Standarten an Ort und Stelle bleiben würden? Doch wir haben nicht aufgegeben. Wir haben alle unseren Hals entblößt, haben Rom unser Leben angeboten und waren bereit, für unsere Sache, für unsere Religion und für unseren Glauben zu sterben. Auch damit hat Pilatus nicht gerechnet. Doch er wäre nicht der Statthalter geworden, wäre er nicht schlau genug für dieses Amt. Blitzschnell hat er seinen Plan geändert, hat so getan, als hätte er nicht gewusst, dass er uns und unseren Glauben damit verletzte. Das, mein lieber Kaiphas, war der Grund, weshalb er die Standarten und Bildnisse des Herrschers aus Jerusalem entfernte. Jeder, der dort gewesen war, kann das bestätigen!»
«Nun», lenkte Kaiphas ein, «das war eine unglückliche Situation. Er war schließlich ein Neuling. Jeder darf einmal einen Fehler machen – sogar ein Römer.»
Seine Bemühung, humorvoll zu wirken, fiel ins Wasser, obwohl Simon, Dinah und Sarah aus Höflichkeit lachten.
«Ich würde gerne glauben, dass es nur der unbedachte Fehler eines Neulings war», sagte Rabbi Gamaliel nun mit echter Besorgnis in der Stimme, «aber der Mann macht mir Angst. Aus zuverlässigen Quellen weiß ich, dass er grausam, hinterhältig und korrupt ist. Wir müssen mit großer Umsicht vorgehen.»
«Das ist ein guter Rat», pflichtete ihm der Hohepriester, ohne eine Miene zu verziehen, bei, «zumindest darin sind wir uns einig. Auch ich habe die Gepflogenheiten diplomatischen Umgangs gelernt und bin nicht mehr grün hinter den Ohren, das müsst Ihr mir glauben.»
«Ja», lächelte Gamaliel, «verzeiht meinen direkten Angriff, aber daraus spricht die Besorgnis eines alten Mannes, der schon viel Schlimmes erlebt hat.»
«Was ich deutlich machen möchte, Rabban, ist die Notwendigkeit, sich Rom gegenüber sehr flexibel zu verhalten», sagte Kaiphas, um mit seiner Meinung die Diskussion abzuschließen. Er war es gewohnt, das letzte Wort zu haben.
«Was ich lediglich klarstellen wollte», sagte Gamaliel, der es sich nicht nehmen ließ, dem Hohepriester dieses Privileg streitig zu machen, «ist meine Hoffnung darauf, dass Ihr unsere Interessen genauso fair vertretet wie die römischen. Kaiphas wollte sofort etwas erwidern, doch Gamaliel griff zu einem Stück saftiger Melone und sagte schnell:
«Aber ich stimme Euch aus vollem Herzen zu, wir müssen flexibel sein!»
Der Hohepriester war über die Ansichten und die Rede des Rabbis verärgert, doch dieses am Ende unerwartet geäußerte Zugeständnis erfreute ihn. Die Beleidigung übersah er geflissentlich, er wollte nicht mehr debattieren, sonders das köstliche Mahl genießen.
«In der Tat», sagte nun Gamaliel, der Kaiphas aus glänzenden Augen beobachtete, «ich muss gestehen, dass Ihr selbst Euch eben höchst flexibel gezeigt habt.»
Die Bemerkung war zwar vollkommen zweideutig formuliert, doch Kaiphas beschloss, sie als Kompliment zu verstehen. Die scheinbare Schmeichelei stimmte ihn milde. War Gamaliel trotz seines Titels eben doch nur ein alter Mann, der vom wirklich großen Geschehen nichts verstand?
«Nun», sagte er deshalb mit offenkundiger Ernsthaftigkeit, «ich halte mich nicht für einen Verteidiger Roms. Ich bin kein Römer. Ich bin Jude. Meine erste Verpflichtung gilt meinem Volk, nach Gott! Aber Rom ist eine Tatsache. Das römische Weltreich ist eine Tatsache. Auch unsere Unterwerfung durch Rom ist eine Tatsache! Wir sind ein besetztes Land, da muss man eben alles tun, um das Beste herauszuschlagen!»
«Ja», seufzte Rabban Gamaliel, «ja.»
«Rom», fuhr Kaiphas fort, «weiß die Fäden zu ziehen, um seine Interessen durchzusetzen. Rom will zweierlei: Macht und Geld. Es weiß, dass wir ein religiöses Volk sind. Es weiß deshalb, welche Fäden zu ziehen sind, um uns tanzen zu lassen. Wenn ich also kooperiere, wenn ich Frieden und Ruhe im Land gewährleiste, damit Rom seine Macht ausüben kann und dabei auch noch Geld verdient – ihr wisst alle, dass Krieg mehr kostet als Frieden –, dann haben wir alle Freiheiten, die nötig sind, um unsere Gottesdienste zu feiern und unserem Gott zu huldigen. Wenn ich nicht kooperiere, wenn es Unruhe im Land gibt, wird Rom jemand anderen finden, der kooperiert, oder aber Rom wird uns zu Tode würgen.»
Der Hohepriester hatte in ehrlichen und aufrichtigen Worten gesprochen und Gamaliel wusste nur zu gut, wie wahr er gesprochen hatte. Es war ein schreckliches Dilemma. Für einen kurzen Moment fühlten sich die beiden Männer wegen ihrer gemeinsamen Verpflichtung von dem jeweils anderen verstanden, doch darüber hinaus gab es keine Gemeinsamkeiten, weder in den politischen noch in den religiösen Fragen dieser Zeit.
«Ich hoffe immer noch, dass wir ohne Gesichtsverlust mit Rom verhandeln können», sagte Gamaliel schließlich nachdenklich, «aber ich fange an, Zweifel zu haben. Wir leben in zwei unterschiedlichen Welten. Rom ist weit weg, ist ganz anders, ist herrschsüchtig und groß. Wir sind das alte, auserwählte Volk, dessen Zahl gering ist. Uns sind andere Dinge wichtig als dem Kaiser. Wir können einander nicht wirklich verstehen.
Ich bezweifle, ob wir letztlich zu echten Übereinkünften kommen können. Irgendetwas wird geschehen, irgendeine unwiederbringliche Untat, eine kleine oder eine große. Dann wird Blut fließen, das Blut unseres Volkes. Ich habe Angst um uns.»
«Darum ist es so wichtig für uns, klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben zu sein», sagte der Hohepriester. «Wir müssen uns im Strom der Zeit bewegen und uns der Stimmungslage des Augenblicks anpassen. Ich sage es noch einmal. Wir müssen flexibel bleiben.»
«Ihr habt in den vergangenen Jahres einen vorsichtigen Kurs gesteuert», sagte Gamaliel nicht unfreundlich.
«Und ich gedenke, das auch für eine weitere, lange Zeit zu tun», erwiderte der Hohepriester nun auch freundlich, dennoch mit unüberhörbarer Festigkeit in der Stimme, «nur in einer gesunden Flexibilität liegt Hoffnung auf Gewinn.»
«Ja», sagte Rabban Gamaliel beiläufig, «ich hoffe, dass Ihr Eure so hochgelobte Flexibilität nicht auch auf andere Bereiche ausweitet.»
«Was genau meint Ihr damit?», fragte Kaiphas, der sofort auf der Hut war.
«Nun», erklärte Gamaliel, «Rom gegenüber flexibel zu sein ist eine Sache, die Thorah-Auslegung eine ganz andere.»
Diese Spitze saß. Kaiphas schoss das Blut ins Gesicht und er richtete sich auf.
«Das habe ich nie gesagt», zischte er wütend.
«Vielleicht nicht direkt, aber das ist nur eine logische Schlussfolgerung», argumentierte Rabban Gamaliel in aller Ruhe und mit einem schelmischen Zwinkern in den Augen, «wenn es für das eine gut ist, dann ist es das auch für das andere.»
«Ich glaube nicht an die flexible Auslegung des Gebotes, wie Ihr es vielleicht tut», rief der Hohepriester jetzt laut vor Erregung, «diese Worte legt Ihr in meinen Mund, Gamaliel!»
Aus einer einfachen Diskussion war nun eine handfeste Auseinandersetzung geworden. Beide waren starke Charaktere und keiner von beiden wollte nachgeben oder von seiner Meinung abrücken. Beiden standen mit ihrer Ansicht für unterschiedliche Anschauungen, die sich im Judentum entwickelt hatten. Sie repräsentierten jeweils zwei unterschiedliche Gruppierungen: Auf der einen Seite standen die Sadduzäer, die mit Kaiphas, dem Hohepriester, einen hochrangigen Fürsprecher hatten, auf der anderen Seite standen die Pharisäer, deren Kopf und Leiter ihres Großen Synhedrions Rabban Gamaliel war.
Die Priesterklasse und die Aristokratie unter den Juden waren Sadduzäer. Sie glaubten an die fest geprägte Gültigkeit der biblischen Schriften. Sie wollten keine Deutung zulassen, die nicht ausdrücklich auch aufgeschrieben stand. Sie hielten jene pharisäische Weise für töricht, wenn nicht sogar gefährlich, nach der neue Bedeutungen in Schriftworte hinein- oder aus ihnen herausgelesen wurden. Sie stimmten nicht mit solchen neuen Deutungen der Schrift überein, die die Pharisäer angeblich in der Bibel herausgelesen haben wollten. Die Gedanken der Unsterblichkeit der Seele beispielsweise, auch die Auferstehung von den Toten oder gar ein Leben nach dem Tod, in welchem Belohnung der Rechtschaffenen und Guten und die Bestrafung der Bösen stattfinden sollte, das waren sündhafte Auslegungen, das war Blasphemie.
Die Pharisäer andererseits hatten für ihr flexibleres Verständnis der Schriften einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Sie hatten schon vor langer Zeit zeigen können, welche Macht sie über das jüdische Volk hatten, waren sie doch nach der Zerstörung des Ersten Tempels und während der Babylonischen Gefangenschaft und des Exils vor 600 Jahren zu religiösen Führern herangewachsen.
In dieser Notlage hatte das Judentum auf dem Spiel gestanden. Sie waren heimatlos, verfolgt, unterdrückt, Menschen ohne Land, Priester ohne Tempel! Aber neue Probleme forderten neue Lösungen, neue Bedingungen forderten neue Interpretationen und eine neue Zeit forderte eine neue Sichtweise. Aus den Schreibern waren Lehrer geworden, die Häuser des Gebetes und der Versammlung eingerichtet hatten, in denen auch Platz für argumentierendes und interpretierendes Debattieren war. Sie hatten die Synagoge erfunden. Sie lernten, die Thorah zu deuten und sie auf die jeweilige Zeit und den jeweiligen Ort anzuwenden, so dass das Judentum stark von den Pharisäern geprägt und sogar als pharisäisches Judentum bezeichnet werden konnte.
Durch ihre große Nähe zum Volk erfreuten sich die Pharisäer verständlicherweise dessen Unterstützung und Achtung.
«Ja», nahm Rabban Gamaliel den Faden wieder auf, «ich für meinen Teil glaube an die flexible Deutung der Heiligen Schrift.»
«Dabei gibt es doch keinen Anfang und kein Ende», sagte der Hohepriester, «wo fangt Ihr an, wo hört Ihr auf?»
«Wenn Ihr jemals aufhört, riskiert Ihr Euer Leben», erwiderte Rabban Gamaliel ruhig.
«Ihr riskiert es eben jetzt!», antwortete der Hohepriester mit großem Nachdruck. «Das kommt von all den unverantwortlichen Ausflügen Eurer Phantasie!»
Rabban Gamaliel wollte etwas erwidern, beschloss aber, die Erklärungen des Hohepriesters nicht zu unterbrechen.
«Ich mache mir keine Sorgen um die unsterbliche Seele», sagte Kaiphas, «das ist nur so eine törichte Idee von Euch. Nein, ich rede vom Messias! Das ist ein wahrhaft gefährlicher Gedanke!»
«Er hat durchaus seine Risiken», gab Rabban Gamaliel zu, «aber er ist auch eine heilige Hoffnung, die sich durch alle unsere Schriften zieht, wenn sie auch nur an einem dünnen, fast unsichtbaren Faden beginnt.»
«Das ist genau das, was ich meine», sagte Kaiphas, «es beginnt mit einem Faden und plötzlich ist ein ganzer Mantel daraus geworden. Das kommt dabei heraus, wenn man einmal damit anfängt, nach einer «inneren» Bedeutung eines Wortes zu suchen. Ich sehe dafür keinen Nachweis in der Thorah.»
Dinah versuchte erfolglos ein Gähnen zu unterdrücken. Sie blickte erschrocken in die Runde. Niemand außer Sarah, Kaiphas’ Frau, schien es bemerkt zu haben. Dinah entschuldigte sich leise, aber Sarah lächelte nur. Ihr Blick sagte ihr deutlich: Ich bin genauso gelangweilt wie du.
Dinah blinzelte dankbar und rollte mit einem Ausdruck der Hilflosigkeit die Augen nach oben. Das stille Zwiegespräch tat beiden gut.
Es ist eine Schande, dachte Dinah bei sich, dass sie den ganzen Abend den Gesprächen über Religion und Politik zuhören mussten, doch das passierte immer, wenn Rabban Gamaliel mit eingeladen war. Natürlich, Politik und Religion waren an sich nichts Schlechtes. Es war eben das Thema der Männer, wenn sie nicht über Geschäfte redeten. Es machte ihr nichts aus, wenn ihr Mann oder Kaiphas über Religion und Politik sprachen. Es klang meist ganz vernünftig. Aber Gamaliel!
Er war einfach nicht realistisch! Er hatte unüberhörbar verrückte Ideen, die keinerlei Fundament besaßen. Er dachte so extrem! Das war’s! Er war ein Fanatiker! Es war wahrscheinlich nicht sehr freundlich gedacht, aber es stimmte. Persönlich fand sie ihn ganz nett, aber er war gefährlich! Gut zu wissen, dass es Leute wie Kaiphas gab, die dem immer noch entgegensteuern konnten, sonst hätten sie längst Ärger mit Rom bekommen.
Dinah bemerkte, wie Sarah an ihrem Halsband nestelte. Dinah hatte es schon den ganzen Abend bewundert.
«Neu?», formten ihre Lippen, als sie Sarahs Blick traf.
Sarah nickte. Sie freute sich über die Aufmerksamkeit.
«Wunderschön!», gab Dinah zu erkennen. Sarah lächelte.
Ihr Zwischenspiel war nicht unbemerkt geblieben. Schon das Gähnen nicht. Rebecca, Gamaliels Frau, sah sich nicht zum ersten Mal bestätigt, dass die beiden Frauen dumme, geistlose Kühe waren. ‹Wenigstens sind Kühe gebärfreudig›, dachte sie bei sich.
Gamaliel hätte das Thema inzwischen gerne fallen gelassen. Ihm war klar, dass ihre Positionen einander widersprechend gegenüberstanden. Er hatte nicht die Absicht, den sadduzäischen Hohepriester zur pharisäischen Sicht zu bekehren. Aber Kaiphas wollte das letzte Wort haben, wieder einmal.
«Es führt alles in eine gefährliche Verwirrung!», sagte Kaiphas. «Die biblisch begründeten Meinungen führen nicht nur zu inneren Widersprüchen, sie haben bereits zu wilden, unverantwortlichen und aufrührerischen Spekulationen verführt. Ich bin sicher, Ihr habt einige von ihnen bereits gelesen. Die Psalmen Salomos, die Himmelfahrt Moses, das Testament der Zwölf Stämme, das Buch der Jubiläen!»
«Natürlich», sagte Rabban Gamaliel zustimmend.
Kaiphas drängte: «Seht Ihr nicht die Gefahr? Nehmt zum Beispiel die Psalmen Salomos. ‹Gib uns einen Messias›, sagen sie. ‹Gürte ihn mit Kraft, um den ungerechten Herrscher zu vertreiben und um Jerusalem von den Völkern zu reinigen, die es zerstören.› Das schreit heute nach Unruhen! Und solche Sätze wie ‹Mit einer Rute von… von…›»
Kaiphas konnte sich nicht mehr genau an den Wortlaut erinnern und blickte hilfesuchend zu Gamaliel.
«Ja, ich habe davon gehört», erwiderte dieser nachdenklich, «mit einer Rute von…» Er hielt inne und überlegte, aber auch ihm wollten die richtigen Worte nicht einfallen.
«Mit einer Rute von Eisen wird er alles in Stücke schlagen!», sagte jemand. Plötzlich wandte sich jeder überrascht Jesus zu, der diesen Satz gesagt und das Zitat vervollständigt hatte:
«Er wird die gottlosen Völker zerstören mit dem Wort seines Mundes. Vor seinem Urteil werden Nationen fliehen und über Sünder wird er wegen der Gedanken ihres Herzens das Urteil sprechen.»
Alle verstummten für einen Moment.
«Ja», sagte Kaiphas langsam und konnte seine Verblüffung kaum verbergen, «ja, das ist es. Versteht Ihr nun, was ich meine, Gamaliel? Jedermann trinkt bereits von diesem verderblichen Zeug, das zu Kopfe steigt! Sogar dieser am-ha…»
Fast wäre ihm das Wort am-ha-aretz über die Lippen gekommen, ein Wort, welches ursprünglich die einfache Landbevölkerung meinte, die Bauern, das aber mittlerweile als Betitelung von Ignoranten und Trotteln benutzt wurde.
«Sogar solche Menschen, wie dieser junge Mann hier», war Kaiphas schnell bemüht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, «es ist heutzutage einfach nicht die Zeit für solche Gedanken.»
«Vielleicht sind es gerade Zeiten wie diese, die solche Gedanken hervorbringen», gab Rabban Gamaliel zu bedenken.
«Ich weiß. Es ist nicht leicht, in schwierigen Zeiten zu leben», sagte Kaiphas, «die Schrift ist voller Hoffnung. Warum müsst Ihr ausgerechnet auf messianische Hoffnung setzen?»
«Wenn das messianische Königreich zu Gottes Plan gehört, was ich glaube», sagte Gamaliel mit einem Lächeln auf den Lippen, «dann wird es nicht einfach verschwinden, nur weil Ihr Eure Augen vor ihm verschließt.»
«Für mich bedeutet es nichts als Ärger und ich habe nicht vor, mich zu ärgern», erwiderte Kaiphas. «Wir haben schon einmal Ärger bekommen, erinnert Ihr euch?»
«Das tue ich», antwortete Gamaliel ruhig.
«Jener Jude damals, dieser Galiläer, er hielt sich selbst für den Messias. In kurzer Zeit schaffte er es, einige aus dem Volk zu überzeugen», sagte Kaiphas. «Könnt Ihr mir sagen, wie viele Menschen die Römer seinetwegen gekreuzigt haben?»
Gamaliel überhörte den harten, anklagenden Ton in Kaiphas’ Stimme nicht.
«Zweitausend», entgegnete er leise.
«Zweitausend!», sprach Kaiphas mit scharfer Stimme. «Und? Sagt mir, war dieser Judas, der Galiläer, tatsächlich der Messias?» Gamaliel antwortete nicht.
«Also dann», lächelte Kaiphas süffisant, «vielleicht könnt Ihr mir sagen, woran wir denn den wirklichen Messias erkennen können?»
Gamaliel blickte gedankenverloren zu Boden, dann sah er Kaiphas an und sagte zu ihm: »Ich glaube, Gott wird uns ein Zeichen geben.»
«Glauben?», spottete Kaiphas. «Ich bin sicher, dass Judas, der Galiläer, auch glaubte. Dass er sogar fest davon überzeugt war, der Messias zu sein, und seine Jünger, die taten das auch. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass alles, was wir zukünftig in dieser Sache zu tun haben, lediglich das Debattieren ist – und nicht mehr, so wie wir es heute gemacht haben, um Kurzweil zu empfinden.»
Gamaliel lächelte, sagte aber nichts.
«Rabban», fragte Judas plötzlich und alle Augen wandten sich ihm zu, «wer wird Eurer Meinung nach der Messias sein?»
Gamaliel lächelte Judas freundlich an. «Einige sagen, immer wenn ein Kind in Israel geboren wird, könnte es der Messias sein», antwortete Gamaliel, «dieser Gedanke gefällt mir.»
Dinah erdrückte Judas ganz plötzlich mit einer Umarmung und überschwänglichen Küssen. «Ja, sogar mein Judas könnte es sein!» Sie lachte, doch sie hatte schon oft mit diesem Gedanken gespielt.
Judas entzog sich ihr. Er wollte auf keinen Fall die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und sagte schnell: «Oder mein guter Freund hier, Jesus!»
Sie lächelten alle. Das war nun wirklich nicht möglich. Ein einfacher Mann aus Nazareth, ein Zimmermann? Es wäre absurd.
Als sie später am Abend allein waren, wandte sich Judas an Jesus.
«Weißt du, worüber ich immer schon nachgedacht habe?», fragte er.
«Worüber?» Jesus sah ihn an.
«Woher einer es selber weiß, ob er der Messias ist!»
Jesus seufzte nachdenklich.
«Ich meine», sagte Judas, «würde er es von seiner Geburt an wissen?»
«Ich kann es mir nicht vorstellen», antwortete Jesus.
«Wie würde er es herausfinden?», wollte Judas wissen.
«Vielleicht wie bei Moses», sagte Jesus, «wie die Propheten – ein brennender Busch, ein Ruf in der Nacht, eine heilige Vision.»
«Ein Ruf von Gott?», meinte Judas skeptisch.
«Ja, ich denke, so in der Art», sagte Jesus.
«Wann kommt dieser Ruf?» Judas ließ der Gedanke nicht los.
«Zu jeder Zeit, denke ich», meinte Jesus.
«An jedem Ort?», fragte Judas.
«An jedem Ort», sagte Jesus.
«Mmmmh», Judas dachte nach.
«Nur eins steht fest», sagte Jesus gedankenvoll.
«Was?», wollte sein Freund wissen.
«Der Ruf wird unmissverständlich sein», sagte Jesus.
Dann hatten sie geschwiegen und jeder hatte seinen Gedanken nachgehangen.
«Komm mit mir nach Kapernaum», sagte Jesus erneut zu Judas und riss ihn somit aus seinen Gedanken.
Judas fiel in Gleichschritt, als sie zusammen losgingen. Sie ließen den Ort Magdala hinter sich. Sie ließen das Kreuz hinter sich, das draußen vor dem Stadttor stand.
«Drei Jahre sind vergangen.» Judas sprach aus, woran er gedacht hatte: «Seitdem ist eine Menge geschehen.»
«Ja, wirklich», sagte Jesus.
«Wie geht es deiner Familie?», wollte Judas wissen.
«Mein Vater, seine Seele möge in Frieden ruhen, ist gestorben», erwiderte Jesus.
«Das tut mir leid. Mögest du Trost finden», murmelte Judas.
«Ich danke dir.» Jesus atmete tief ein.
Es gab viel zu besprechen, das spürte Judas, aber er würde warten, bis Jesus den Zeitpunkt für gekommen hielt.
Ihre Wanderung verlief schweigend. Gegen Mittag hielten sie bei einem Obstgarten an und aßen einige der heruntergefallenen Früchte.
«Judas», sagte Jesus schließlich, als sie sich ein wenig erfrischt hatten, «ich habe den Schlüssel gefunden. Der Schlüssel heißt Liebe!»
«Der Schlüssel? Liebe?» Judas sah Jesus leicht verwirrt an.
«Ja, Liebe!», entgegnete Jesus.
Während sie weitergingen, begann Jesus zu erklären.
«Jedes menschliche Wesen möchte glücklich werden. Die Frage ist – wie kann ein Mensch unter so vielen verschiedenen Bedingungen glücklich sein? Was macht einen Menschen glücklich? Tief im Herzen eines jeden Menschen wohnt der Wunsch, anerkannt zu sein, wertgeschätzt zu werden oder, um es anders zu sagen, geliebt zu werden.»
Jesus wartete einen Moment, dann fuhr er fort:
«In der Tat, dieser Wunsch lebt tief im Herzen eines jeden Menschen, auf jeder Stufe des Seins, im ganzen Universum. Geliebt zu werden und selbst zu lieben! Aber, was ist Liebe? Sie ist mehr als ein Gefühl oder eine innere Bewegung. Sie ist mehr als das, was zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern geschieht. Zwar ist sie das auch, aber sie ist mehr, viel mehr. Sie ist etwas, das ständig geschieht, das überall geschieht.
Liebe ist Geben und Empfangen. Indem du gibst, empfängst du. Indem du empfängst, gibst du. Liebe ist das innerste Wesen der Natur, des Lebens. Wohin auch immer du blickst, gibt es ein ständiges Geben und Empfangen – ohne Ende. Liebe ist das tiefe und grundsätzliche Gesetz des Lebens. Alles andere entspringt ihr. Ist es nicht wundervoll? Wir sind umgeben von Liebe! Wir schwimmen in einem Meer der Liebe! Wir geben und empfangen, lieben und werden geliebt, andauernd und zu jeder Zeit, wir mögen es merken oder nicht! Wir müssen lernen, uns dessen bewusst zu werden! Wir müssen lernen, es mehr und mehr zu entdecken!»
Jesus sprach nun schneller und der Eifer in ihm wuchs.
«Das ist notwendig: lieben und geliebt werden. Jeder Augenblick ist in gewisser Hinsicht ein Geben und Empfangen, ein Lieben und Geliebtwerden. Das ist das tiefste Glück, das wir finden können. Dass wir wissen, wie man liebt, und dass wir wissen, wir werden geliebt, das ist der tiefste Sinn des Lebens, mehr geht nicht. Das ist unsere Aufgabe: einander lieben!»
Judas sah seinen Freund aufmerksam an. Er hing an seinen Lippen.
«Aber es gibt einen noch größeren Anlass zur Freude», fuhr Jesus in seinen Erklärungen fort, «wenn Liebe der Urgrund der Schöpfung ist, dann ist sie es auch im Schöpfer. Wenn Liebe der Urgrund des Lebens ist, dann ist das Gesetz der Liebe auch der Urgrund der Quelle des Lebens. Gott ist ein Gott der Liebe. Andauernd und ewig gibt er und empfängt er Liebe!
Die Menschen haben Anteil an Gottes Liebe, dadurch sind sie mit ihm verbunden und ihm gegenüber verantwortlich – jeder, jedes einzelne Wesen der Schöpfung. Keiner gehört einem anderen. Wir gehören nur Gott.
Wir haben andauernd Liebe nötig. Kein menschliches Wesen kann uns diese andauernde Liebe geben. Gott kann. Nur er kann.
Wir müssen einander verstehen. Kein menschliches Wesen kann uns andauerndes Verständnis geben. Gott kann. Nur er kann.
Wir brauchen ständige Vergewisserung unseres Wertes. Kein menschliches Wesen kann uns diese Vergewisserung gaben. Nur Gott kann es.
Der Mensch greift in seiner Erkenntnis zu kurz. Gott nicht.
Menschen enttäuschen uns. Gott nicht.
Menschen sterben. Gott nicht.
Unsere Aufgabe ist es, Gott zu dienen. Nur das ist unsere Aufgabe. Es ist die Aufgabe eines jeden Wesens, das ins Dasein gerufen wurde. Es gibt für uns nichts Bedeutungsvolleres. Jede Haltung, jede Tat ist eine Art, Gott zu dienen. Auf diese Weise wird unser Leben in jedem Moment wichtig und bedeutsam.»
Judas spürte, wie er selbst im Geiste auf das innere Leuchten in Jesu Geist antwortete.
«Verstehst du?», fragte Jesus und suchte im Gesicht seines Freundes nach Erkenntnis.
Judas verstand.
«Wir müssen dafür sorgen, dass andere auch verstehen!», sagte Jesus, und als ob er einem inneren Ruf folgte, rief er laut aus: «Wenn sie es einmal verstanden haben, wird es ihr Leben verändern, Judas! Wenn sie einmal gesehen haben, was allein sie glücklich macht, wenn sie einmal gesehen haben, was sie wirklich glücklich macht, werden sie sich ändern. Sie werden glücklichere Menschen werden. Sie werden bessere Menschen werden. Sie werden einander mit Liebe anstecken, Judas. Zuerst einer, dann noch einer und ein weiterer! Juden und Heiden! Bis die ganze Welt sich geändert hat! Ein Neuer Himmel, eine Neue Erde! Das, Judas, ist der Weg zum…»
«…messianischen Reich!», brachte Judas den Satz erstaunt zu Ende. Er zitterte, als er seine eigenen Worte hörte.
«So ist es», sagte Jesus in ruhiger Überzeugung, «das, Judas, ist unsere Aufgabe. Wir müssen andere sehend machen. So wird es geschehen.»
Judas blickte Jesus lange an. Er hatte eine ängstliche Frage in den Augen und formte sie mit den Lippen, fand aber nicht den Mut, sie auszusprechen. Beide spürten die Frage und die Antwort.
«Ich bin lange fort gewesen», sagte Jesus ausweichend, «ich ging, um Johannes den Täufer zu sehen. Als ich im Jordan stand, sah ich plötzlich den Himmel offen. Die Schechina, der göttliche Geist, kam wie eine Taube auf mich herab. Ich hörte eine Stimme vom Himmel herab sagen: ‹Du bist mein geliebter Sohn, in welchem ich gesegnet sein werde.›»
«Das Zeichen!», rief Judas aus. «Du hast den Ruf gehört!»
Ihre Augen trafen sich prüfend. Jesus schwieg. Judas fühlte in sich eine aufschäumende Freude und übermächtige Ehrfurcht aufsteigen. Er wagte kaum zu atmen, um den Zauber nicht zu brechen. Er wollte mehr hören, aber er traute sich nicht zu fragen. Wieder würde er warten, bis Jesus das Schweigen brach. In Wirklichkeit war er einfach nicht in der Lage zu sprechen.
Jesus sagte indessen nichts. Er zog sich ganz in seine eigenen Gedanken zurück.
Er vergegenwärtigte sich noch einmal jenen Tag und die Tage, die folgten, jene Tage in der Wüste. Mit seiner Seele hatte er gerungen…
«Du bist also der Messias!», hatte Satan gesagt. «Nun, dann beweise es der Welt. Vollbringe deine Wunder!»
Und Satan hatte ihn versucht. Er hatte gehöhnt: «Lass doch die Natur überreichlich Früchte bringen, so dass alle von ihrem Überfluss leben können. Wenn du der Sohn Gottes bist, mach aus diesen Steinen Brot.»
In dieser Sekunde hatte Jesus sich gefragt, ob es das war, was Menschen von ihm erwarteten, doch gleich darauf war er überzeugt davon gewesen, dass das nicht der richtige Weg war: «Nein», hatte er dem Satan geantwortet, «nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt von jedem Wort, das Gott spricht.»
Und wieder hatte Satan ihn versucht. Er hatte gehöhnt: «Dann zeige doch ein großes Wunder in der Heiligen Stadt, bei dem dich jeder sehen kann. Steige auf die Zinne des Tempels. Spring herunter! Denn die Schrift sagt: ‹Er wird für dich Engel schicken, die dich auf ihren Armen auffangen und tragen. Du wirst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen.›»
Da hatte Jesus sich gefragt, ob das der Weg sei, auf dem er sich zu erkennen geben und auf einen Schlag das Himmelreich eröffnen sollte.
Doch er hatte sich schnell entschieden: «Nein, die Schrift sagt klar: ‹Du sollst Gott, deinen Herrn nicht versuchen!›»
Satan hatte ihn ein drittes Mal versucht. Er hatte gehöhnt: «Es wurde doch gesagt, dass du die Völker beherrschen wirst. Stehe auf und erobere sie! Israel wartet! Israel ist bereit! Israel wird siegen! Du wirst herrschen in Herrlichkeit! Der Weg der Welt und alle Schätze der Welt sind dein!»
Und Jesus hatte sich gefragt, ob das die Richtung war, in die er zu gehen hatte, bis er schließlich erkannte, dass er nicht durch Macht und Gewalt siegen durfte, sondern durch Gottes Geist allein gewinnen sollte.
So sagte Jesus schließlich: «Weg mit dir, Satan. Die Schrift sagt: ‹Du sollst deinen Gott verehren und ihm allein dienen!›»
Er hatte sich entschieden, die Liebe für sich selbst sprechen zu lassen. Alles andere würde sich zu seiner Zeit ergeben. Liebe war das Wunder! Liebe würde Wunder wirken!
Als seine Gedanken wieder in der Gegenwart angekommen waren, blickte Jesus Judas an. Er schien vor Angst nicht sprechen zu können.
«Was belastet dich?», fragte Jesus ihn aufmunternd.
«Ich habe Angst, es auszusprechen!» Judas atmete schwer.
«Sprich!» Wie selbstverständlich sprach er mit Autorität.
Judas Entsetzen wandelte sich in Ehrfurcht: «Ich glaube, du bist der Messias!»
Jesus sah Judas unendlich liebevoll an.
«Bitte», drängte Judas ihn, «sage mir, ob es so ist. Und wenn es nicht so ist, möge unser Vater im Himmel mir vergeben!»
«Es ist so», sagte Jesus. Seine Stimme war sanft.
Die Augen Judas’ füllten sich mit Tränen. Aber seine Worte waren klar:
»Gesegnet seiest du, Herr unser Gott, König der Welt, der du gut bist und Gutes tust und der du uns gute Botschaft offenbart hast.»
Er verneigte sich und ging wie vor einem König drei Schritte rückwärts. Dann fügte er hinzu: «Gelobt seiest du, Herr unser Gott, König der Welt, der du die Tage des Messias eingeleitet hast!»
Jesus lächelte und sagte: «Du bist gesegnet, Judas Ischarioth, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Es wurde dir von unserem Vater im Himmel eingegeben.»
«Ja», nickte Judas, «ich habe es noch nicht gewusst, als ich dich beim letzten Mal sah.»
«Unser himmlischer Vater legt nicht alle Dinge sofort offen dar», erklärte Jesus.
«Hast du es gewusst, in all der Zeit vorher? Vor drei Jahren?», wollte Judas wissen.
«Nein», sagte Jesus, «nicht, bevor ich den Schlüssel gefunden hatte. Nicht, bevor ich den Weg vor mir gesehen habe, der Liebe heißt!»
«Und das Zeichen», fügte Judas ehrfurchtsvoll an.
«Und das Zeichen», sagte Jesus.
Judas nickte. Er hatte verstanden. Es war alles ein Wunder.
«Komm!», forderte Jesus Judas auf. «Lass uns unsere Arbeit in Kapernaum beginnen.»