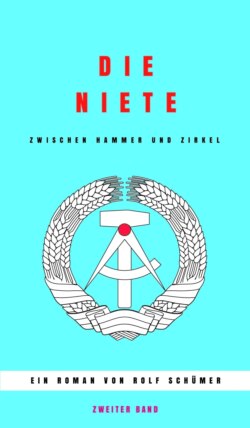Читать книгу Die Niete - Rolf Schümer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3. Die Westabteilung der FDJ
Ihren Ursprung hatte sie im Jahr 1950. Ein Jahr nach Ende der Berlin-Blockade und der erfolgten Gründung zweier deutscher Staaten, von denen jeder in Anspruch nahm, für das ganze Deutschland zu sprechen, tobte in Berlin der Kalte Krieg, in Korea ein heißer. Antikommunistische Gruppen aus dem Westen schickten nachts ihre Mitglieder mit Pinseln und Farbeimer bewaffnet über die Sektorengrenze, um das Wort „Freiheit“ an möglichst viele Mauern und Wände des Ostens zu schreiben. Die FDJ schickte ihre Mitglieder zur selben Zeit in Richtung Westberlin, um dort an vielen Orten das Wort „Frieden“ zu pinseln. Damit sollte die Bewegung gegen die von Bundeskanzler Adenauer angekündigte Wiederbewaffnung der Bundesrepublik unterstützt werden. Diese sogenannten Nacht-und-Nebel-Aktionen waren nicht ungefährlich. Auf beiden Seiten mussten die Teilnehmer mit Gefängnisstrafen rechnen, wenn sie auf frischer Tat ertappt wurden. So kam es vor, dass an vielen Stellen durch Herannahen der Polizei die Aktion abgebrochen werden musste. Statt des gesamten Wortes rieben sich Passanten verwundert die Augen, lasen sie „Frei“ im Osten oder „Frie“ im Westen, was zumindest die Englisch-Lehrer erzürnte. So entstand auf beiden Seiten die Idee, lediglich den Großbuchstaben „F“ zu malen. Das Risiko, erwischt zu werden, gerecht verteilt und minimiert, ohne jeglichen Zusammenhang zur fast gleichnamigen Motte. Trotzdem wurden in Ost und West „F“-Schreiber von der Polizei verhaftet. Natürlich gab es auch auf beiden Seiten vorbereitete Kampagnen, die Freiheit für die Eingekerkerten forderten, aber auf die Dauer nutzte sich das ab und die Gefangenen fehlten der jeweiligen Seite als Aktive in der nächsten Nacht. Hans Modrow, der damalige Chef der Groß-Berliner FDJ, rief seinen Vorstand zur Krisensitzung zusammen. Einer hatte die durchschlagende Idee:
„Da auf beiden Seiten F geschrieben wird, wie wäre es, wenn wir uns mit der Gegenseite verständigten und jeder malt die Fs in seinem Sektor?“
Ein Sturm der Entrüstung brach los.
„Unser F steht für Frieden, das hat nichts mit dem F der imperialistischen Kriegstreiber zu tun!“
„Zwei Fs sind nicht dasselbe.“
„Ihr F ist nicht unser F!“
„So ist es, aber die Passanten sehen doch nur das Ergebnis, sie wissen nicht, wer das F geschrieben hat. Wenn wir weniger Verluste haben wollen, sollten wir mit der Gegenseite sprechen. Aber wer übernimmt das? Und das muss natürlich streng vertraulich bleiben.“
Es wurde beschlossen, eine kleine Gruppe besonders zuverlässiger FDJ-Funktionäre damit zu beauftragen. Damit niemand Verdacht schöpft, bekam sie den Namen Zentrale Arbeitsgruppe. Die Verhandlungen endeten erfolgreich. Da die jeweilige Polizei natürlich die eigenen Leute nicht verhaftete, konnten die F-Schreibaktionen auch tagsüber durchgeführt werden. Doch damit ging der Abenteuerreiz verloren, die Teilnehmerzahlen sanken. Nur den Ideengeber ließ es nicht ruhen, er konnte zumindest 1969, als neuer Chefredakteur der Fernsehprogrammzeitschrift der DDR, ihr den Titel „FF-dabei“ geben.
Ein anderes Aufgabenfeld der ZAG entstand ebenfalls 1950. Die antikommunistische KgU (Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit) hatte bereits mehrfach Frösche verschossen, um SED-Kundgebungen in der DDR zu stören. Frösche hießen Raketen, die bei ihrer Explosion Propagandaflugblätter auf die Köpfe der Teilnehmenden rieseln ließen. Das können wir auch, hieß es bei der ZAG. Sie kümmerte sich um die Herstellung und Übergabe solcher Flugblattschleudern an die neuen Raketentrupps der FDJ in Westberlin.
Ihr erster Einsatz erfolgte vor dem Schöneberger Rathaus, dem Amtssitz des Westberliner Senats am 24. Oktober 1950 bei der symbolischen Übergabe der Freiheitsglocke. Fast eine halbe Million Menschen hatte sich versammelt. Die Raketentrupps sollten von umliegenden Hinterhöfen, aus den Mülltonnen heraus, ihre Flugkörper abschießen. Jeder bekam zwei Raketen, mehr waren unauffällig nicht zu transportieren.
Ein FDJler, Spitzname Pippifax, erreichte den ihm zugeteilten Hof und wurde dort von Polizeipräsenz überrascht: Zwei Pferde der berittenen Polizei. Damit hatte er nicht gerechnet. Was sollte er tun? Beim Krach der startenden Raketen würden die Gäule vielleicht nicht nur scheuen, sondern sich und ihn in aufkommender Panik verletzen. Pippifax mochte Pferde. Kurzerhand nahm er sie bei den Zügeln, führte sie in einen benachbarten Hof und band sie dort an. Er ging in den ersten Hof zurück und zündete auftragsgemäß seine Raketen. Dann fielen ihm wieder die Pferde ein. Damit sie nicht vergessen werden, vielleicht die Fütterung versäumen, brachte er sie wieder an ihren alten Platz zurück.
Am nächsten Tag titelte eine Westberliner Zeitung: „Ostzonaler Pferdedieb auf frischer Tat ertappt!“ Die Versorgungslage in der Ostzone müsse schlimmer sein, als bisher berichtet, hieß es im Artikel. Und weiter: „Doch die Rechnung ohne den Wirt hatte der 26-jährige Ostberliner Heinz F. gemacht, als er sich ausgerechnet an zwei Pferden der Berliner Schutzpolizei vergreifen wollte, um seine ostzonalen Hungertöpfe aufzufüllen." Weil er noch Blätter einer DDR-Zeitung bei sich hatte (darin waren die Raketen eingewickelt), wurde Pippfax als Ost-Berliner eingestuft. Der politische Schaden blieb gering, da Pippifax seine Raketentrupp-Zugehörigkeit bei der Vernehmung verschwieg. Er kam schnell wieder auf freien Fuß, das Verfahren wurde später sogar eingestellt. Die Plakate und Flugblätter mit der Überschrift „Freiheit für Pippifax" brauchten nicht gedruckt zu werden.
Gemeinsame Arbeit von Ost- und Westberliner FDJlern gab es auch 1961 bei der „Aktion Ochsenkopf“, als die FDJ im Ostberliner Bezirk Treptow dafür nicht genug Freiwillige fand. Die Westberliner aus Neukölln kamen zu Hilfe. Sie taten, was sie nie (außer Tante Alma) auf den von ihnen bewohnten Häusern getan hätten: Sie stiegen nachts auf die Ostberliner Dächer und rissen die für den Empfang des Westfernsehens ausgerichteten Antennen heraus. Diese DDR-weite Aktion wurde bald wieder eingestellt, weil sie weder auf Dauer den Empfang von Westfernsehen verhindern, noch zum Anstieg der Sympathie für FDJ und SED beitragen konnte.
Der Kranz
Einmal befreite mich die ZAG aus einer wirklichen Klemme. Eine Delegation von Westberliner FDJlern und Mitgliedern der Gewerkschaftsjugend sollte an einer Gedenkfeier im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen teilnehmen und dabei einen Kranz niederlegen. Diesen hatte ich besorgt. Zur Übergabe und zum Durchsprechen des Ablaufs trafen wir uns im Stadtvorstand am Vorabend. Daraus entwickelte sich ein fröhlicher Umtrunk bis nach Mitternacht. Wie immer bei solchen Gelegenheiten wurde viel gesungen. Trinken ohne Gesang wäre kulturloses Saufen gewesen. Wir sangen Arbeiterlieder, aber auch eigene Texte zu bekannten Melodien. Bei „Glory, Glory, Hallelu-ja“ hieß es:
„Wir rüsten die Gewerkschaft mit Maschinenpistolen aus“ und „wir hängen alle Nazis in der Müllerstraße auf.“
Ursprünglich wurde „Sozis“ statt „Nazis“ gesungen, doch die politische Linie hatte sich geändert, die Sozialdemokraten sollten für die Aktionseinheit gewonnen werden. An die alte Fassung erinnerte nur noch die Müllerstraße, in der sich die SPD-Zentrale befand.
Inbrünstig schmetterten wir „und wir füllen unser Stadtbad mit dem Blut der CDU.“ Nach dreimaligen Singen der Textzeile, der zuletzt „am Tag der Revolution“ hinzugefügt wurde, kam der „Glory,Glory“-Refrain, der ebenfalls mit dem ersehnten Tag endete.
Als ich am nächsten Morgen in den Stadtvorstand kam, traute ich meinen Augen nicht. Der Kranz lag immer noch da. Es war neun Uhr und die Delegation musste bereits am Treffpunkt Bahnhof Friedrichstraße sein. Es gab nur eine Möglichkeit, ihr den Kranz noch rechtzeitig zu bringen. Ich legte ihn in den Kofferraum meines Autos und fuhr zur Grenzübergangsstelle Invalidenstraße. Dank meines Dauerpassierscheins kam ich schnell durch und flitzte auf der Ostseite zum Bahnhof. „Überholen ohne einzuholen geht also doch“, dachte ich. Ich parkte den Wagen, schnappte mir den Kranz und traf die Gruppe beim Verlassen der Kontrollstelle. Die Teilnehmer wunderten sich über mein Eintreffen, niemand hatte bisher das Fehlen des Kranzes bemerkt. So war die Freude um so größer.
Erleichtert ging ich zum Auto zurück. Zwei Volkspolizisten standen davor. Der eine musterte das Westberliner Kennzeichen, der andere äugte misstrauisch ins Wageninnere.
„Können Sie nicht lesen?“, fragte mich dieser, als ich mit dem Autoschlüssel in der Hand den Wagen erreichte. Er zeigte auf ein Parkverbotsschild mit dem Zusatz „außer VP-Fahrzeuge“.
„Oh, doch, ich bin FDJ-Funktionär und ich dachte, VIP, also ,very important person', gelte auch für mich.“
„Die Straßenverkehrsordnung der Deutschen Demokratischen Republik kennt keine fremdsprachigen Verkehrszeichenzusatzschilder. Außerdem steht hier nicht Wipp, sondern Fau-Peh und das heißt Volkspolizei. Weisen Sie sich bitte aus.“
„Nichts lieber als das, doch seit wann kann man das selbst machen, ohne vorherige Antragstellung? Also, auf in den Westen!“
Nach dieser humoristischen Entgegnung wollte ich die Autotür aufschließen, doch er packte meine Hand:
„Bürger, Sie zeigen mir sofort ihre Papiere!“
Inzwischen stand sein Kollege ebenfalls neben mir.
„FDJ mit Westauto, das gibt es nicht.“
Sollte ich jetzt die mangelhafte politische Schulungsarbeit bei der Volkspolizei ansprechen und ihn über die Existenz der FDJ in Westberlin aufklären? Bevor ich eine Entscheidung traf, schob er seine Nase dicht an meinen Mund und fragte:
„Haben sie Alkohol getrunken?“
„Auf keinen Fall, es ist noch vor 10 Uhr, da trinke ich keinen Alkohol.“
„Der Geruch ist eindeutig, passend zu den verworrenen Angaben und dem auffälligen Verhalten. Wir nehmen Sie zur Alkoholprobe mit aufs Revier. Steigen Sie bitte in unser Dienstfahrzeug ein.“
So fuhr ich erstmalig in einem Wagen der Volkspolizei. Die Alkoholprobe auf der Wache ergab 0,5 Prozent. Das war der Restalkohol vom Vorabend.
„In der DDR gilt die Null-Promille-Regel, Sie dürfen kein Fahrzeug führen.“
„Aber in Westberlin ist es erst ab 0,8 Promille untersagt. Lassen Sie mich doch das kurze Stück bis zur Grenze fahren.“
Ich erhielt keine Antwort, erneut wurden meine Papiere begutachtet, mehrfach hielt ein Polizist den Dauerpassierschein gegen das Licht.
„Setzen Sie sich mit der Zentralen Arbeitsgruppe beim Zentralrat der FDJ in Verbindung. Dort kann man meine Angaben bestätigen“, meldete ich mich zu Wort. Ich wartete über eine Stunde auf die Antwort. Endlich hieß es:
„Die FDJ hat Ihre Angaben bestätigt und wir werden daher eine Ausnahme machen. Ein Fahrzeug der Volkspolizei wird Sie zum nächsten Grenzkontrollpunkt eskortieren. Aber in Zukunft halten Sie sich bitte an die Straßenverkehrsordnung der DDR.“
Wieder ging es mit dem Polizeiwagen und den beiden Uniformierten zum Bahnhof Friedrichstraße. Dort stieg ich in mein Auto und fuhr dem Volkspolizeifahrzeug hinterher. Ich war genervt. Eine Kirchenglocke in der Nähe schlug 12 Uhr, der halbe Tag für nichts und wieder nichts vorbei. Als der Grenzübergang in Sicht kam, brannten mir die Sicherungen durch. Der Polizeiwagen verlangsamte seine Fahrt und der Fahrer gab mir aus dem Fenster das Handzeichen, ihn zu überholen. Ich blieb hinter ihm, allerdings ohne ab - zubremsen. Mit lautem Knall rammte ich den Wagen, schob ihn gegen die rechte Sperrmauer neben der Schranke des Grenzübergangs. Die beiden Volkspolizisten sprangen aus ihrem Auto, einer riss meine Tür auf, der andere zerrte mich wutschnaubend heraus.
„Was fällt dir ein? Haste noch alle Tassen im Schrank?“
Der Aufprall gegen die Sperrmauer hatte auch die Grenzsoldaten aufgeschreckt, die nun heraneilten. Es hatte hier in der Vergangenheit einen Fluchtversuch gegeben, bei dem versucht wurde, mit einem Omnibus die Grenze zu durchbrechen. Sie stutzten, als sie die Westkennzeichen meines Autos bemerkten. Absichtlich lallend rief ich ihnen zu:
„Holdrijo, ich kann nichts dafür. Diese beiden Vopos da setzten mich ans Steuer, obwohl ich Alkohol im Blut habe.“
Und zu den Volkspolizisten sagte ich vorwurfsvoll:
„Warum lasst ihr mich auch fahren mit 0,5?“
Die beiden wären am liebsten weiter auf mich losgegangen, aber ein Offizier der Grenzer führte mich bereits in den Durchsuchungsraum vom DDR-Zoll, ließ sich meine Papiere geben und verschwand. Ein anderer Grenzer bewachte mich und ich konnte aus dem Nebenzimmer die wütenden Stimmen der beiden Volkspolizisten hören:
„Das hat der mit Absicht gemacht!“
„So viel hat der nicht intus, der spielt das nur!“
Durch ein Fenster konnte ich sehen, wie mehrere Grenzsoldaten das Volkspolizeifahrzeug von der Stoßstange meines Autos hievten. Dellen zierten das Polizeiauto, die Rücklichter fehlten. An meinem Wagen sah ich keine Schäden, ich fuhr ein solides schwedisches Fabrikat. Schweigend verbrachte ich eine Stunde in dem Raum, bis endlich die Tür aufging und eine Krankenschwester hereinkam, um mir eine Blutprobe zu entnehmen. In ihrem Kittel bemerkte ich zwei Reagenzgläser mit dunkelroter Flüssigkeit.
„Von meinen grünen Freunden?“, fragte ich mit dem Kinn auf den Nebenraum deutend. Sie schwieg, kniff aber Augen und Lippen zustimmend zusammen, ohne dass es mein Bewacher sehen konnte. Dann blieb ich mit diesem wieder lange allein, bis mein Freund Orje von der Stasi eintrat. Meine rechte Hand reagierte mit sofortigem Phantomschmerz. Er winkte den Grenzer hinaus, sah mich kopfschüttelnd an, grinste und vergaß glücklicherweise, mir die Hand zu geben.
„Da hast du dir ja ein dolles Ding geleistet. Das hat noch keiner gemacht. Wenn ich das den Genossen erzähle, werden die sich totlachen. Ich muss natürlich einen Bericht schreiben. Du bist unabsichtlich statt auf die Bremse auf das Gaspedal getreten, okay? Die zweite Blutprobe ergab übrigens 0,0 Promille, die erste stufen wir als fehlerhaft ein. Du kannst also gleich weiterfahren. Ob es seitens deiner Partei ein Nachspiel haben wird, das wirst du mit deinen Genossen selbst klären müssen.“
Was war ich dankbar, einen Freund bei der Stasi zu haben! Ich machte den Fehler, Orje spontan die Hand in seinen Schraubstock zu legen. Erst in Alt-Moabit legten sich die Schmerzen und ich konnte wieder normal schalten.
Der Schmuggler
Ich hatte mal wieder einen dicken Umschlag von der Ostberliner SED-Bezirksleitung abgeholt. In Vorbereitung der XI. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Kuba planten wir eine Veranstaltung im Westberliner „Quartier Latin“ (heute „Wintergarten“). Jeder Teilnehmer sollte sich mit kubanischen Cocktails den Magen und wir uns mit den Einnahmen die Verbandskasse füllen. Den echten kubanischen Rum der Marke „Havanna Club“ gab es nur in der DDR. Er war zwar nicht billig, aber mein Umschlag prall gefüllt. Ich klapperte die Geschäfte ab und kaufte die Bestände auf. Die Flaschen versteckte ich unter der Rückbank und eine Lage legte ich in den Kofferraum. Darüber und auf die Sitzbank stapelte ich große Stofftiere, die ich in Spielzeugläden käuflich erworben hatte, wie es gern die Ostdeutschen formulieren, anstatt kaufen zu sagen..
Auch ein Dauerpassierschein befreite nicht von den üblichen Kontrollen an der Grenze. Zunächst hatte ich Glück. Der Spiegel auf Rädern bemerkte nichts Verdächtiges unter dem Auto, der Benzinmessstab kitzelte keinen Flüchtling im Tank und die Rückbank musste nicht hochgeklappt werden. Erleichtert fuhr ich in Richtung Westen. Hier stand ein Uniformierter mitten auf der Straße. Damit hatte ich nicht gerechnet. Die Kontrolleure der Westberliner Seite saßen meist nur gelangweilt in ihrem Häuschen oder stellten sich untätig daneben. Ich musste anhalten.
„Guten Tag!“, grüßte ich und fragte scheinheilig: „Stimmt etwas nicht?“
„Deutscher Zoll“, lautete die Antwort. Ich hatte keine Zeit, mich über den darin enthaltenen Alleinvertretungsanspruch zu ärgern.
„Was haben Sie in den Stofftieren?“
Ich stutzte kurz.
„Woher soll ich das wissen? Ich frage Sie doch auch nicht, was Sie im Kopf haben?“
„Aber Sie wissen, dass Beamtenbeleidigung eine Straftat ist?“
Auf die rhetorische Frage erübrigte sich eine Antwort. Der Zöllner ging zur Beifahrerseite, öffnete die Tür und begann die Stofftiere abzutasten.
„Ich mache eine Stichprobe auf versteckte Drogen“, erklärte er und nahm einen Hund, einen Teddy und den einzigen Elefanten mit in das Kontrollhäuschen. Was er Stichprobe nannte, erwies sich als reines Massaker. Als er mit den Stofftieren zurückkam, hing der Kopf des Teddys nur noch an einem Faden am Körper. Das scheint bei Stoffteddys die Sollbruchstelle zu sein. Der Elefantenrüssel fehlte, er steckte im weit aufgerissenem Hinterteil des Hundes. Ich war an einen Perversen geraten!
„Es ist alles Ordnung“, log dieser, „Sie können weiterfahren oder ins Wachhäuschen kommen, falls Sie einen Beleg brauchen, um eine Entschädigung zu beantragen.“
Nicht einen Schritt würde ich in diese Richtung machen!
„Nein, nein, ich werde alles reparieren“, entgegnete ich und packte die kaputten Stofftiere auf den Beifahrersitz. Dann fuhr ich ein paar Straßen weiter und hielt an. Es hatte alles geklappt. Knapp vierzig Flaschen Havanna Club erfolgreich durch zwei Kontrollen geschmuggelt. Jetzt brauchte ich etwas für die Nerven. Ich befreite eine Flasche aus ihrem Versteck und nahm daraus einen großen Schluck. Beim Absetzen fiel mein Blick auf den misshandelten Hund. Ich zog ihm den Elefantenrüssel aus dem Hintern und sagte:
„Armes Ding“, immerhin hast du bewiesen, dass man seinen Arsch auch für die kubanische Revolution hinhalten kann.“
Vor dem Sieg Fidel Castros 1959 hatten viele Kubaner als Strichjungen für reiche Yankees gearbeitet und galten als konterrevolutionär. Mit dieser Begründung werden Homosexuelle immer noch auf Kuba diskriminiert.
Das Schmuggeln ging aber auch in die umgekehrte Richtung. Dieter von der ZAG rief an. Im „Stadion der Weltjugend“ würden dringend Ersatzteile für die Flutlichtanlage benötigt. Die neue Anlage war im Westen gekauft worden, nur dort gab es die Teile.
„Null problemo“, sagte ich, „was braucht ihr, damit die Partei- und Staatsführung in besserem Licht dastehen kann?“
Ich wusste, dass das Stadion für die Oberliga-Derbys BFC Dynamo gegen FC Union genutzt wurde und Mielke gern zusah. Dieter gab mir alle technischen Daten und den Ablauf durch. Am Sonnabend, dem 27. Mai 1978 solle alles im FDJ-Gästehaus in Caputh angeliefert werden. Dafür werde das Auto von unserem Vorsitzenden am Grenzkontrollpunkt avisiert. Denn dieser müsse sowieso zum Gästehaus, um dort seine Rede für die Kuba-Veranstaltung mit dem Chef der Westabteilung „abzusprechen“.
Ich brauchte zwei Tage, um alle Ersatzteile bei verschiedenen Händlern zu ergattern. Entweder hatte die ZAG geglaubt, dass ich nicht alles bekäme oder sie hatten das Volumen des jeweiligen Teils falsch eingeschätzt. Die vielen Kartons passten nicht in Volkers Auto. Also verstaute ich die restlichen in meinem Wagen und rief unserer Sekretärin zu, die gerade telefonierte: „Ruf bei der ZAG an, dass mein Auto auch avisiert wird.“
Sie hielt ihre Hand auf die Sprechmuschel und nickte. „Gut“, dachte ich, „sie hat es verstanden.“ Ich war schon auf der Straße, sonst hätte ich ihre Nachfrage „Was hast du gesagt?“ noch gehört. Ich fuhr Volker hinterher und mir fiel auf, dass sehr viele Polizeiwagen unterwegs waren und in Mausefallen Autofahrer und Insassen kontrolliert wurden. Volker und ich hatten Glück, wir erreichten unbehelligt den Grenzkontrollpunkt im Süden der Stadt, der auf der Westseite Dreilinden und auf der Ostseite Drewitz hieß. Bei der DDR-Ausweiskontrolle hielten wir, erst beim Zoll wurden „Avisierte“ durchgewunken. Das gelang aber nur zur Hälfte. Mir machte der Zöllner unmissverständliche Handzeichen heranzufahren und zu halten. Jetzt musste ich schnell handeln. Volker war durchgefahren und konnte nicht mehr sehen, was sich hinter ihm abspielte. Sollte ich stoppen und den Wagen durchsuchen lassen? Ich trat lieber auf das Gaspedal und rauschte am Zöllner vorbei. Mein erster Gedanke: „Werden sie auf mich schießen?“
„Kommunist auf der Flucht in den Osten erschossen“, das wäre mal im Westen was Neues. Im Rückspiegel konnte ich nichts erkennen. Ich blieb auf dem Gas und nahm die Autobahn Richtung Michendorf. Vorbei an der Raststätte fuhr ich über die Ausfahrt Ferch von „hinten“ nach Caputh. Im FDJ-Gästehaus wurde ich schon erwartet.
„Ich weiß alles“, schimpfte Knolle. Seine Überheblichkeit hatte mich schon immer gestört. Knolle hieß eigentlich Gunter Rettner, seinen Spitznamen verdankte er seiner großzügig ihm Gesicht verteilten Nase.
„Warum hast du nicht am Zoll gehalten? Wir hätten das mit einem Anruf geklärt. Jetzt hast du eine Großfahndung ausgelöst!“
„Dann stelle ich mich und erkläre alles.“
Volker, der neben ihm stand, zeigte mir einen Vogel. Knolle ließ seine Zunge unter der Oberlippe hin und her gleiten.
„Dafür ist es zu spät. Zu viel Staub ist aufgewirbelt, wir entscheiden operativ, Jochen ist auf dem Weg.“
Erneut schnürte seine Zunge ihre Wander-Knospen.
„Du lädst die Teile aus, dann muss der Wagen verschwinden. Du bekommst natürlich einen neuen.“
Ich sah mich schon mit einem Trabi, Wartburg, Wolga, Moskwitsch, Lada, Saporosch oder Polski Fiat durch Westberlin tuckern. Oder würde ich ein beschlagnahmtes Fluchthelfer-Westauto mit professionell gefälschten Papieren erhalten? Knolle schien meine Gedanken gelesen zu haben: „Über Volker bekommst du Geld für einen Gebrauchtwagenkauf im Westen.“
Jochen von der Stasi, der ziemlich gestresst aussah, betrat den Raum.
„Zwei Großfahndungen an einem Tag“, stöhnte er.
„Wieso zwei?“, fragte ich neugierig.
„Das kannst du morgen in der Westpresse lesen“, wiegelte er ab, „jetzt klären wir deine Geschichte.“
Er und der Gästehausleiter Erich halfen mir beim Ausladen, dann fuhr ich auf Jochens Geheiß den Wagen ans Ufer. Das Gästehaus befand sich auf einem Wassergrundstück an der Havel, das Ufer war vom Wasser aus nur schwer einsehbar, von der Straße überhaupt nicht. Das letzte Stück schoben wir zu dritt das Auto bis es schmatzend im Wasser versank. Mein schönes Schmuggelauto, wie gern hätte ich es behalten. Erich legte seinen Arm um meine Schultern. „Mensch, du hast es doch gut. Gebrauchtwagen an jeder Ecke. Und die große Auswahl!“
Er hatte recht. Und wenn die Westabteilung bezahlt, dann könnte der nächste Wagen auch etwas teurer sein.
„Wo ist eigentlich Orje?“, fragte ich Jochen, da die beiden sonst gemeinsam unterwegs waren.
„Der musste dringend zu einem Einsatz nach Erfurt“, antwortete er und legte einen Finger auf die Lippen.
In der DDR-Presse stand in den nächsten Tagen darüber nichts und ich erwartete auch keinen Hinweis, der Orjes Aufenthalt in Erfurt erklärte. Aus der thüringischen Stadt wurde nur der Erfolg des Pressefestes in der SED-Bezirkszeitung „Das Volk“ gemeldet. Ohne es zu wissen, war ich nicht weit von der Wahrheit entfernt. Auf dem Pressefestgelände hatte es eine Massenschlägerei gegeben. 200 Jugendliche verprügelten erkennbare SED-Mitglieder und leisteten Widerstand, als die Volkspolizei mit „Sonderausrüstung“ (Schlagstock, Schild, Helm mit Visier) brutal gegen die Jugendlichen vorging. Orje wurde dort gebraucht, weil er zu der Stasi-Gruppe gehörte, die die Massenkrawalle vom Alexanderplatz analysiert hatte.
Im Oktober 1977 hatten tausende aufgebrachte Jugendliche randaliert, dabei einen Volkspolizisten erstochen und einen anderen mit einem vollen Bierkasten erschlagen. Die Volkspolizei ging massiv vor, mehrere Wasserwerfer kamen zum Einsatz. Ich kannte die Vorfälle aus einem vertraulichen Bericht, der nur Funktionären zuging und war über das Ausmaß der Gewalt, die Tötung der Volkspolizisten, schockiert. Ich gab mich mit der im Bericht enthaltenen Erklärung zufrieden, dass diese Gewalt von alkoholisierten Fußballfans des 1. FC Union ausgegangen war.
Die Westpresse berichtete ausführlich von der gelungenen Befreiung des Terroristen Till Meyer aus der Haftanstalt Moabit. Er und seine Helfer seien spurlos verschwunden, hieß es und mir dämmerte, warum Jochen einen so anstrengenden Tag gehabt hatte. Till Meyer, der damals in der DDR untertauchte, habe ich erst 1990 getroffen, als wir gemeinsam mit Dirk Schneider und Claus Croissant die Gründung der Westberliner „Linken Liste“ als Partnerin der PDS für die Wahlen vorbereiteten.
Die Stinkbomben
Berlinale 1979. Die Jury-Mitglieder aus sozialistischen Ländern hatten gegen den Film „Die durch die Hölle gehen“ (The Deer Hunter) protestiert und verließen das Filmfestival. Er sei eine Beleidigung des heroischen vietnamesischen Volkes, hieß es dazu in der offiziellen Erklärung von sowjetischer Seite. Wir beschlossen im Sekretariat des Jugendverbandes, mit einer spektakulären Aktion den kriegsverherrlichenden Charakter des Films zu entlarven und die Aufführungen empfindlich zu stören. In den Kinos sollten zeitgleich Stinkbomben von unseren als Zuschauer getarnten Mitgliedern zerdrückt werden. Die daraufhin hinausströmenden Zuschauer sollten dann von den draußen wartenden Genossen Flugblätter erhalten.
Die Beschaffung von Stinkbomben war in Westberlin kein Problem. Nicht weit vom Stadtvorstand der FDJW, in der Hermannstr. gehörten sie zum Sortiment eines Ladens für Scherzartikel und Zauberbedarf. 200 Stinkbomben sollten insgesamt zum Einsatz kommen, zwei für jeden Getarnten. Wir besprachen die Aktion.
„Ob der überhaupt so viele in seinem Laden hat?“, gab einer zu bedenken.
„Wenn nicht, dann kann er welche bestellen, wir koofen sie ja bestimmt nicht uffn letzten Drücker.“
„Genau, das ist das Problem“, griff Volker in die Debatte ein:
„Eine große Bestellung könnte bei bestimmten Stellen Verdacht erregen, so kurz nach dem Berlinale-Skandal. Außerdem haben wir auch nicht unbegrenzt Zeit, der Film wird ja nicht wochenlang laufen. Wir besorgen sie eben aus der Hauptstadt.“
Damit war mein Verantwortungsbereich angesprochen.
„Es gibt keine Stinkbomben, in der DDR und auch in anderen sozialistischen Ländern nicht“, sagte ich.
Ein Genosse meinte: „Bist du sicher? Das kann doch nicht so schwer sein, welche herzustellen.“
„Vielleicht würde bei der schlechten Luft ihre Wirkung verpuffen“, antwortete ich. Volker runzelte kurz die Stirn.
„Fahr morgen rüber, die ZAG soll sich etwas einfallen lassen. Sag den Genossen auch, dass die Freunde unsere Aktion sehr begrüßen würden.“
Aha, daher wehte der Wind. Die „Freunde“, das waren die sowjetischen Genossen. Wir hatten oft Kontakt mit der sowjetischen Militärmission in Westberlin und auch mit der sowjetischen Botschaft Unter den Linden. Aber nur selten erteilten sie uns direkte Aufträge. Das überließen sie sonst der Westabteilung. Schon wenige Tage später konnte ich die Ware in Ost-Berlin in Empfang nehmen: 200 kleine, unbeschriftete Pappschachteln.
„Sei vorsichtig damit“, sagte Dieter, „wir mussten improvisieren. Die Dinger müssen sehr behutsam aus der Schachtel genommen werden. Und nicht in die Hosentasche stecken, sondern in die Brusttasche.“
Es kam der Tag der Aktion. In mehreren Kinos, fünf Minuten nach Hauptfilmbeginn, griffen die Genossen zu den Schachteln, um die Stinkbomben herauszuholen, auf den Boden zu legen und zu zertreten. Ein Materialfehler ließ es nicht so weit kommen. Das die Stinkflüssigkeit umhüllende Glas zerbrach bereits beim Griff in die Schachtel. „Raus, ihr Stinktiere!“ war noch die freundlichste Reaktion der Zuschauer. Das brauchten sich unsere Genossen nicht zweimal sagen zu lassen. Denn die Flüssigkeit, die sich über sie verteilte, übertraf den Gestank der handelsüblichen West-Stinkbomben deutlich.
„Die Flugblätter könnt ihr vergessen“, wurde mir und anderen Genossen vor dem Kino zugerufen, „das war eine Scheißaktion!“
Nur ein Passant klatschte Beifall. Ein Hertha-Fan, der „Scheiß-Union“ verstanden hatte.
Die Sache hatte in der DDR ein Nachspiel. Nach dem Anfertigen und Versenden der Berichte über das Versagen der Stinkbomben ereignete sich folgende und denkwürdige Episode bei einer Sitzung der Staatlichen Plankommission, von der mir Friedel Lewin berichtet hatte:
Günter Mittag ruft den Tagesordnungspunkt 24 auf.
„Genossen, es geht nun um die Frage, ob und in welcher Anzahl die Produktion von im NSW (Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet) als Stinkbomben bezeichneten Scherzartikel aufgenommen wird. Die dafür benötigten Rohstoffe sind kein Problem, da in vielen Volkseigenen Betrieben stark riechende Rückstände bei der Produktion entstehen.“
Wegen deutlich vernehmbaren Kicherns im Raum, unterbricht Mittag seine Einleitung:
„Genossen, auch Scherzartikel verlangen Ernsthaftigkeit.“
Die Diskussion entbrennt.
„In unserer Produktionspalette ist kein Platz für Artikel zweifelhaften Gebrauchswertes.“
„Wenn das zuträfe, wären unsere Sitzungen nur halb so lang.“
Mittag interveniert:
„Zur Sache, Genossen. Es ist nichts entschieden, aber Fakt ist, dass solche Stinkbomben auch in der DDR von unseren Menschen manuell gefertigt werden, es gibt also einen Bedarf.“
Die Runde beruhigt sich wieder und Mittag fragt:
„Wie sollen sie heißen? Wir können sie doch nicht Bomben nennen, angesichts der Friedenspolitik unseres Staates.“
„Natürlich nicht. Aber wenn wir sie ,Bonner Mief“, ,RIAS-Gestank' oder ,Duft der freien Welt' nennen würden, käme das der sozialistischen Erziehung unserer Menschen zugute.“
Darauf entgegnet der Vertreter der Stasi:
„Von solchen Namen ist Abstand zu nehmen, das würde feindliche Elemente ermuntern, sie bei Veranstaltungen des Staates oder der Massenorganisationen einzusetzen. Wenn überhaupt, dann muss der Name neutral und sachlich sein.“
Die Diskussion setzt wieder ein:
„Geruchsverstärker“, „Odorant'“ „Riechling“ „Nase-zu“ „After-Air“ „Stinki“
„Wie wäre etwas mit Anti?“ „Anti-Parfum!“ „Anti-FA“ „Anti-Luft!“ „Andys Duft!“
Mittag klopft mit dem Kugelschreiber auf den Tisch.
„Genossen, so kommen wir nicht weiter! Ich unterbreche die Sitzung für eine kurze Kaffeepause.“
Doch auch während der Pause dreht sich alles um TOP 24. Wie viele Stänker werden gebraucht und wo sollen sie in den Verkaufsstellen im Regal liegen? Bei den Deko-Artikeln neben FDJ-Fahnen und Winkelementen? Oder bei Spielwaren? Wie wird die Volksbildung reagieren, wenn Schüler sie im Unterricht benutzen? Die Pause ist vorbei und Günter Mittag ergreift das Wort:
„Genossen, ich habe während der Pause einen Anruf erhalten. Die Sammlung und Verpackung jeglicher Geruchsproben fällt in die ausschließliche Kompetenz des Ministeriums für Staatssicherheit. Der Punkt 24 ist somit ersatzlos gestrichen.“
Nie wieder beschäftigte sich die Plankommission mit Stinkbomben.
Der Verräter
Am Tag nach den Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus 1981 rief mich Dieter an. In einer Stunde sollte ich gegenüber sein, es sei dringend. „Gegenüber“ war die Bezeichnung für eine konspirative Wohnung in der Straße „Unter den Linden“. Dort angekommen begrüßte mich nicht nur Dieter, sondern auch Orje und Jochen. Ich war überrascht. Worum sollte es gehen? Was wollten sie von mir?
Zuerst sprachen wir über das Wahlergebnis. Die SEW hatte nur 0,6 Prozent erreicht, die Alternative Liste zog mit 7,2 Prozent und 9 Abgeordneten erstmals ins Westberliner Parlament.
„Das ist nur ein Strohfeuer“, meinte ich, „die haben jetzt schon interne Streitereien wegen der Abgeordneten Kohlhepp.“
Ich hatte das von einem ehemaligen Mitschüler gehört, dessen Mutter ebenfalls zur ersten AL-Fraktion gehörte.
„Kein Wunder“, meinte Jochen, „wenn man Kontakte zu Rechtsradikalen hat.“ Er wusste mehr als ich. Hatte die Stasi ihre informellen Mitarbeiter bei der AL? Man muss mir meine Verwunderung angesehen haben. Denn Orje ergänzte: „Warum sollen die Kräfte des Klassenfeindes nur von wenigen Hanseln gebunden werden, wenn woanders mehr Leute zur Verfügung stehen?“
Mit den „Hanseln“ waren wir gemeint und ich sagte beleidigt: „Wir sind bestimmt nicht hier, um die Wahlen auszuwerten. Also worum geht es?“
Dieter räusperte sich kurz und fragte:
„Kannst du dich an unseren ZAG-Mitarbeiter Hans-Joachim erinnern? Er hat vor einem halben Jahr eine Studienfahrt betreut, die du geleitet hast.“
Ich nickte.
„Letzte Woche fuhr er mit einer FDJ-Delegation zu den Falken nach Nordrhein-Westfalen. Die Delegation kam am Wochenende zurück, aber Hans-Joachim war nicht mehr dabei.“
Nun wusste ich, warum die Stasi hier war. Ein politischer Mitarbeiter des Zentralrats der FDJ hatte sich in den Westen abgesetzt.
„Jedenfalls hat er nicht gewartet, bis er stellvertretender Vorsitzender wurde“, scherzte ich auf die Flucht Heinz Lippmanns anspielend, der 1953 als Stellvertreter Honeckers mit 400.000 Westmark aus der FDJ-Kasse in den Westen abgehauen war. Jochen fuhr mich an:
„Rolf, dir scheint der Ernst der Lage nicht klar zu sein. Es geht hier um die Klärung eines Sachverhalts.“
Diese Formulierung kannte ich und die Alarmglocken schrillten in meinem Kopf. So leitete die Stasi Festnahmen und Verhöre ein. Was sollte mir hier angehängt werden? Ich beschloss, vorerst nur zuzuhören. Dieter nahm eine Schriftmappe zur Hand.
„Hier habe ich den Bericht Hans-Joachims über die besagte Studienfahrt. Demnach hattet ihr ein intensives und langes Vieraugen-Gespräch über die aktuelle politische Lage in der DDR. Was hat er gesagt und wie hast du reagiert?“
Ich erinnerte mich noch gut an diese Unterhaltung. Zum ersten Mal hatte ich aus dem Mund eines FDJ-Funktionärs gehört, dass nur 10 % der DDR-Bevölkerung für den Sozialismus, andere 10 % entschiedene Gegner seien und den verbleibenden 80 % sei es scheißegal, solange man sie in Ruhe ließe. Ich beantwortete die Frage wahrheitsgetreu.
„Das ist nur die Antwort auf den ersten Teil der Frage“, sagte Jochen, „wie hast du reagiert?“
„Vorsicht, Falle!“, schoss mir durch den Kopf. Ich hatte Hans-Joachim gesagt, dass ich mir das gut vorstellen könne. Aber warum sollte er mich in seinem Bericht anschwärzen? Um weiter Karriere zu machen, damit sich eher Fluchtmöglichkeiten ergeben? Aber dann hätte er seine vorherige Einschätzung auch nennen müssen und das hätte ihn selbst belastet.
„Ich habe seine Behauptungen entschieden als falsch zurückgewiesen und ihnen keine größere Bedeutung beigemessen. Es war spät in der Nacht nach einem üblichen Umtrunk.“
Orje und Jochen sahen mich skeptisch an, dann blickten sie zu Dieter.
„Im Bericht steht nichts von 10-10-80“, sagte er.
„Das wäre auch ziemlich dumm für jemanden, der von der ZAG mit einer Delegation in den Westen geschickt werden will“, zog ich meinen Hals aus der Schlinge. Sie schienen mir zu glauben.
„Rolf, gab es irgendwelche Anzeichen, die auf Hans-Joachims Republikflucht hindeuteten?“, fragte Orje.
Ich verneinte und das entsprach auch der Wahrheit.
„Zumindest ist jetzt klar, zu welchen 10 % dieser Verräter gehört“, sagte Jochen, „vielleicht solltest in Zukunft besser aufpassen, wem du vertraust und mit wem du Freundschaft schließt.“
Ich hatte Hans-Joachim nur bei einer einzigen Studienfahrt kennengelernt, da konnte von Freundschaft keine Rede sein. Aber ich erwiderte nichts. Es war eine Fangfrage, um mir weiter auf den Zahn zu fühlen.
„Dann ist unser Gespräch beendet“, sagte Dieter und ordnete die Papiere wieder ein.
„Und es hat nie stattgefunden“, ergänzte Orje.
Ich verabschiedete mich und fuhr zurück nach Westberlin, um in einer Kneipe bei einem Glas Bier über Hans-Joachim nachzudenken, den ich als offen und ehrlich eingeschätzt hatte und der nun als Republikflüchtling zum Klassengegner übergelaufen war.
Gehörte er wirklich schon während der Studienfahrt zu den 10 % Feinden? Ein abgebrühter Verräter? Oder könnte es ganz andere Gründe gegeben haben? Vielleicht fehlten ihm die Kraft und die Überzeugung daran zu glauben, dass die Missstände in der DDR überwunden werden könnten und eine Mehrheit der Bevölkerung für die sozialistischen Ideen immer noch zu gewinnen sei. Oder kannte er die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR besser, um sich nur von einem sinkenden Schiff zu retten? Aber als Ratte konnte er bei mir auch keine Pluspunkte einheimsen. Stärker beschäftigte mich die erlebte Verhör-Situation, das mulmige Gefühl, wie schnell meine politische Karriere in einer Stasi-Zelle enden könnte.
Um auf andere Gedanken zu kommen, musste ich etwas Verrücktes tun. Im Stadtvorstand aß ich alle Blumen, die als Tischdekoration in Hertas Büro standen. Sie schmeckten sogar. So begann meine Karriere als Blumenfresser. Wenn ein Genosse zur Auszeichnung rote Nelken bekommen hatte; ich aß sie auf. Wenn wir auf Delegationsfahrten mit einem Blumenstrauß begrüßt wurden; ich aß ihn auf. Einmal waren allerdings Osterglocken dabei, die vertrug ich nicht. Ich bekam Ausschlag und einen brennenden Hals. Selbst bei internationalen Konferenzen geschah es, dass meine Genossen sagten: „Rolf, da sind Blumen.” Dann war es meine Aufgabe, mich an jemand heranzuschleichen, um ihm seinen Strauß abzuknabbern.
Um so lustiger war es natürlich, wenn es sich dabei um den hohen Funktionär eines anderen Landes handelte. In Sofia verschlang ich den Blumenstrauß von KP-Chef Todor Schiwkow, dessen Namen wir mit „Schwipskopf“ verhohnepiepelten. Irgendwann waren meine Geschmacksnerven so abgestumpft, dass ich es fertigbrachte, einen vorher abgespülten Beckenstein eines Urinals in den Mund zu stecken und zum Vergnügen der anderen in mein Bierglas fallen zu lassen. Dem verdankte ich zeitweilig den Spitznamen „Graf Beckenstein”. Erst als ich in der Zeitung las, dass ein Berliner, der sich lange Freibier in den Kneipen dadurch erpresste, indem er Gläser aß, an einer geschluckten Scherbe verstorben war, hörte ich damit auf.