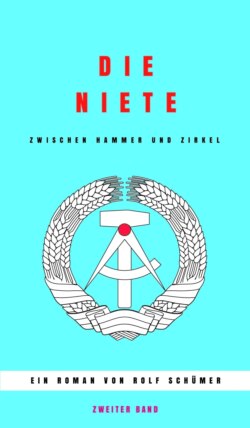Читать книгу Die Niete - Rolf Schümer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4. Jetzt kommt Harry mit Fisch
Als Vorsitzender der Pionierorganisation hatte ich ein einziges Mal die Gelegenheit, als Gast an einem SED-Parteitag teilzunehmen. Zwanzig Westberliner SEW-Funktionäre durften dabei sein. Die Tage verbrachten wir im „Palast der Republik“, die Abende und Nächte im „Hotel Unter den Linden”, weshalb später der Abriss beider Gebäude zeitgleich begann.
Alles war perfekt organisiert. Fast alles. Jeder Sitzungstag begann mit dem Abspielen von Arbeiterliedern. Am ersten Tag um Punkt 9 Uhr öffnete sich ein kleiner Vorhang hinten auf der Tribüne des Präsidiums, als das Lied „Auf, auf zum Kampf erklang”. Exakt an der Textstelle „vielleicht ist er schon morgen eine Leiche” trat Erich Honecker durch die Öffnung. Ein Regie-Fehler oder Absicht? Wäre es ein Fehler gewesen, würde am nächsten Tag ein anderes Lied eingespielt werden oder der Generalsekretär käme etwas früher oder später durch die Öffnung. Gespannt erwartete ich den Ablauf am zweiten Tag. Kurz vor neun, „Auf, auf zum Kampf”. „Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche”, Applaus brandete auf, Honecker schritt durch den Vorhang. Also kein Zufall! Was sollte ich machen? Wenn ich meine Beobachtung melden würde, bekäme der verantwortliche Tontechniker Riesenärger und vielleicht nicht nur er. Außerdem hatte niemand außer mir den Skandal bemerkt. Aber würde das am dritten Tag auch noch so sein? Es waren schließlich auch gewiefte Westjournalisten im Saal, die würden doch sofort über Intrigen im Politbüro spekulieren und Honeckers guten Gesundheitszustand anzweifeln. Ich musste einen Weg finden, Erich Honecker aus dieser peinlichen Situation zu befreien, jedoch ohne mit jemandem darüber zu sprechen. Die einzige Möglichkeit bestand darin, die Delegierten im richtigen Augenblick abzulenken. Aber wie? Der Saal war groß und darin saßen ein paar Tausend Leute. Ich wollte eine Art Sprechchor wie in einem Fußballstadion anstimmen. Denn einfache Hoch- und Jubelrufe schieden aus, weil die sowieso schon von anderen ständig angestimmt wurden.
Der dritte Tag. „Auf, auf zum Kampf“, kurz vor neun: Der Vorhang öffnete sich und „vielleicht ist er…” erklang. Mein Text musste kurz und leicht verständlich sein und trotzdem klarmachen, dass Honecker gesundheitlich und politisch auf der Höhe ist. Ich sprang von meinem Platz hoch und schrie so laut ich konnte:
„Ha, ho, he, Honni ist okay!”
Die Genossen links und rechts von mir dachten wohl, dass ich vom abendlichen Umtrunk nicht ausgenüchtert sei und griffen entsetzt nach meinen Händen, um mich in den Sitz zurückzuziehen. Doch ich kam wieder nach oben, zog dabei die beiden mit hoch. In der Aufregung nicht mehr textsicher, brachte ich die Reihenfolge der Anfangssilben durcheinander und brüllte: „He, ha, ho, ..” Verdammt, was reimte sich darauf?
„He, ha, ho, Erich, weiter so!”
Dabei hatten mich meine Platznachbarn wieder ein Stück hinuntergezogen, aber ich riss sie bei „Erich, weiter so” noch einmal nach oben. Inzwischen reagierten die Delegierten im Saal. Dank meiner lauten Stimme hatten sie das Auf und Nieder bemerkt und eiferten uns nach. In kürzester Zeit gingen wellenartigen Bewegungen durch alle Ränge. Der Ruf „Erich, weiter so” schwoll an, glitt an den Plätzen des Parteitagspräsidiums hoch, brach sich dank der wunderbaren Akustik an Decken und Wänden, um als mehrstimmiges Echo in die Tiefe des Plenums zurückzukehren. Heinz-Florian Oertel hätte es so oder ähnlich kommentiert. Das eingespielte „Auf, auf zum Kampf” war übertönt, keiner hatte den peinlichen „Leichengang” Honeckers bemerkt.
Später erfuhr ich, dass unser Parteivorsitzender von Honecker zu dieser spontanen Aktion beglückwünscht worden war. Allerdings mussten viele Sessel danach repariert und sogar ausgetauscht werden, denn Übergewicht war bei SED-Delegierten nicht selten und die Sitze im Palast auf derartige rhythmische Belastungen nicht vorbereitet. Deshalb sollte aus volkswirtschaftlichen Gründen bei ähnlichen Anlässen auf diese „Welle” verzichtet werden. Außerdem sei die Idee eigentlich nicht neu, denn schon 1953 gab es eine Hockauf-Bewegung in der DDR, benannt nach einer Zittauer Weberin, die den Plan übererfüllte.
So hatte ich zwar unabsichtlich die „La Hola” erfunden, aber wegen des Verbots durch Honecker wurde sie erst 1986 durch einen SED-Delegierten und Sportfunktionär zur Fußball-WM nach Mexiko gebracht, wo sie dann auch ihren Namen erhielt.
Ansonsten blieb der Parteitag langweilig und der Personenkult um Honecker nervte. Kein Redner begann seinen Beitrag einfach mit „liebe Genossinnen und Genossen”, sondern jeder drehte sich zunächst zu Honecker um, redete ihn fast unterwürfig mit „sehr geehrter Genosse Generalsekretär Erich Honecker" an, um erst dann zu den Delegierten zu sprechen. Alle Reden berichteten von Erfolgen, von Fehlern war nur die Rede, wenn sie bereits korrigiert, kurz vor ihrer Überwindung standen, von untergeordneten Leitungen oder dem Klassenfeind zu verantworten waren. Die Politik des Zentralkomitees war stets richtig, sie musste nur besser umgesetzt oder verstanden werden. Das kannte ich von den Polit-Butterfahrten. Es war die gleiche unmarxistische Darstellung wie in Fürnbergs Lied „Die Partei hat immer recht”. Darin wird die Partei als Mutter der Massen besungen, die Umkehrung wäre richtig gewesen. Bei Marx bringen die (Arbeiter-)Massen die Partei hervor. Aber danach wäre die SED in der DDR eher Waise gewesen (Achtung! Bei Lesungen bitte auf das „ai“ hinweisen, sonst ändert sich der Sinn!).
Viele Redner leierten hohle Phrasen herunter, die alle im Saal auswendig beherrschten. Die „Hauptaufgabe“, die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, musste in jeder Rede erwähnt werden. Es reichte, von der „Hauptaufgabe” zu sprechen, die restliche Formulierung ließ der Redner weg, die kannte sowieso jeder. Ich staunte, wie sich die Funktionäre bemühten, selbst das Silbenverschlucken Honeckers zu kopieren. Dieser sagte nie „Republik”, sondern nur „Replik” und die größte Gefahr ging immer vom „Impralismus” aus. Besondere Höhepunkte bildeten die Wörter, die aus dem Französischen stammen. Von einer erfolgreich durchkreuzten „Kampansch” des Klassengegners wurde gern berichtet. Darauf stieß man am Abend mit „Schampansch” an.
Ich beobachtete die Delegierten auch in den Pausen. Gab es spezielle Schulungen, vielleicht auch Castings, die das wirkungsvolle Auftreten des Parteifunktionärs zum Inhalt hatten? Eines Tages gelangte ich in den Besitz entsprechender Unterlagen. Hier ein Auszug:
„Der Funktionär mit Zigarette
Der bewusste Umgang schafft ihm besondere Ausdrucksmöglichkeiten. Wer seine Zigarette nur nebenbei, etwa hastig und unaufmerksam raucht, hat schon verloren. Der Funktionär dagegen stützt seinen rechten Arm mit dem Ellenbogen auf die Tischplatte, die Zigarette klemmt zwischen Zeige- und Mittelfinger, die Hand liegt so dicht am Mund, dass der Daumen unter das Kinn drückt. Gibt es nichts Wichtiges zu bemerken, wird der Rauch nach Vorklappen von Zeige- und Mittelfinger an der Hand vorbei geblasen. Ein Positionswechsel der Hand zur rechten Schläfe schafft Abwechslung. Bei dichter Haartracht ist Vorsicht geboten. Durch dieses Verhalten entsteht der Eindruck des aufmerksamen Zuhörers, was bei späterer Würdigung der geleisteten Arbeit (Nachruf, Biografie, Parteiausschluss) gern erwähnt wird.
Bei einem Redebeitrag ist nur der Anfang wichtig. Völlig falsch beginnt man den Satz mit „Ich möchte etwas sagen”, „Ich würde meinen” oder gar „Ich denke“. Der richtige Anfang lautet: „Ich möchte einige Bemerkungen machen.” Die nummerierte Reihenfolge lässt die Gedanken geordnet erscheinen, aber noch wichtiger: Du sprichst mit dieser Wortwahl aus der Position des Lehrers, der Schüleraufsätze korrigiert hat. Der zweite Satz beginnt also mit: „Erste Bemerkung:“ Den Doppelpunkt auf keinen Fall aussprechen. Ihn stellst du mit der Wirkung deiner Zigarette dar: Zum Sprechen werden Zeige- und Mittelfinger nur soweit nach rechts geklappt, dass der Mund frei ist. Nach einigen Sätzen, wenn eine Gedankenpause oder der Eindruck einer solchen benötigt wird, klappt die Hand wieder vor den Mund, um an der Zigarette zu ziehen. Beim Ausstoßen des Rauches sind unbedingt Ringe zu vermeiden. Sie wirken verspielt, unterstellen dem Sprecher Konzentration auf dieselben, machen die Wirkung seiner Worte zunichte.
Denke daran, dir kurz vor deinen Bemerkungen eine frische Zigarette anzuzünden, damit du genug Redezeit hast. Ungehemmtes Herumstochern im Aschenbecher beim Ausdrücken lenkt völlig ab. Einzige Ausnahme: Du sprichst an dieser Stelle über den Umgang mit Konterrevolutionären, Sozialdemokraten, Faulenzern oder Udo Lindenberg. Wenn du dir angewöhnt hast, lange zu reden, solltest du wie Fidel Castro auf Zigarren umsteigen.
Der Funktionär ohne Zigarette
Für ihn ist der Einsatz seiner Zunge für eindrucksvolle Mimik wichtiger als der Zungengebrauch beim Sprechen. Nach einem Satz oder vor besonders wichtigen Aussagen unterbrichst du deinen Redefluss, um mit der Zunge unter der Oberlippe von rechts nach links zu fahren. Das erhöht die Spannung darauf, was du als Nächstes sagen wirst. Allerdings nur, wenn es von allen Zuhörern gesehen wird. Darum wird die Zunge zuerst in der Mundhöhle einmal zur Wange gestreckt bis sich eine von außen sichtbare Ausbeulung bildet. (Niemals mehrfach! Dadurch ändert sich die Aussage!) Dann wird sie so weit unter die Oberlippe geschoben, bis sich hier eine deutliche Beule bildet, die dann unter der Lippe entlang wandert. Vor besonders wichtigen Aussagen steigerst du diese Technik, indem du erst weiter sprichst, wenn die Zunge an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt ist, also die Beule zweimal wanderte. Versuche niemals, die Zunge unter der Unterlippe entlangzuführen. Das wirkt unsicher, als würdest du verlegen Nahrungsreste zwischen den Zähnen entfernen wollen. Und noch etwas: Niemals zu viel Zunge unter der Lippe ausbeulen. Ein Ausrutscher, das unfreiwillige Bläken, könnte Heiterkeit bei den Zuhörern auslösen und Aufmerksamkeitsdefizite zur Folge haben.“
Die Reden auf dem Parteitag langweilten mich immer mehr. Problemen erging es wie Fehlern. Sie gab es nur im Zusammenhang mit ihrer erfolgten oder unmittelbar bevorstehenden Meisterung. Im letzteren Fall folgten die hochtrabenden Versprechungen, wie die Werktätigen ihre Anstrengungen zur Planerfüllung vervielfachen werden. Viele Redner versprachen ein Feuerwerk von Erfolgsziffern. Die nicht enden wollende Aufzählung derselben machten es zu einem Monsunregen. Zum Abschluss der Rede überreichten viele Delegierte eine Kassette mit Selbstverpflichtungen von Brigaden oder anderen Gruppen. Beim ersten Mal schaute ich noch genau hin. Ich fand die Idee gut, dem Honecker etwas auf Band zu sprechen. Schließlich bestanden oft Papierengpässe und so konnte auch unnütze Schreibarbeit vermieden werden. Doch warum überreichte der Redner einen Gegenstand, doppelt so groß wie ein Schuhkarton, den ich als Verpackung für eine Tonkassette als völlig überdimensioniert einstufte? Auch in der DDR waren Tonkassetten nicht größer als im Westen. Ein Sprecher lüftete das Geheimnis. In der Packung lagen die schriftlichen Verpflichtungen, es gab überhaupt keine Tonaufzeichnungen. Die Bezeichnung „Kassette” war der Name der Box. Es sollte sich nur besser anhören, als zu sagen: „Genosse Erich Honecker, wir haben dir schon was in die Kiste gelegt“.
Ich fragte mich, was anschließend damit passieren würde. Ich stellte mir vor, dass jemand den Auftrag bekam, zunächst alle Kisten zu stapeln. Danach müsste er sie nach und nach öffnen, alles sortieren und lesen. Nach fünf Jahren wäre es geschafft. Jetzt können die Brigaden überprüft werden, ob sie ihre Versprechungen eingehalten haben. Doch weil alle fünf Jahre ein SED-Parteitag stattfindet, schreiben diese bereits wieder, um neue „Kassetten“ zu füllen und das Spiel beginnt erneut ohne dass eine einzige der vorherigen Verpflichtungen auf ihre Verwirklichung überprüft worden war. So konnte jede Brigade Schreibarbeit sparen, indem sie nur eine Kopie des alten Textes in die neue Kiste legte.
Ich beschloss, meine Westberliner Genossen, die sich nicht minder langweilten, mit kleinen Briefen zu unterhalten. Ich erfand die Figur eines jungen DDR-Pioniers, der beim Parteitag sitzt und seiner Mutter schreibt, was er erlebt. Es entstand eine beachtliche Sammlung der sogenannten „Liebe Mama-Briefe”, was allerdings für mich fast ein böses Nachspiel gehabt hätte.
Als nächster Redner war der DDR-Gewerkschaftsvorsitzende Harry Tisch angekündigt worden. Ich schrieb:
„Liebe Mama! Mir geht es gut. Es ist sehr schön hier, aber ich habe ziemlich großen Hunger. Doch bald kriegen alle was zwischen die Kiemen, denn gleich kommt Harry mit Fisch. Dein Pionier”.
Der Brief ging von Genosse zu Genosse und das Kichern ermutigte mich zu weiteren. Als ein schwarz uniformierter Bergarbeiter von der WISMUT sprach:
„Liebe Mama! Hier darf einfach jeder unvorbereitet reden. Jetzt spricht sogar ein Schornsteinfeger. Er hat viel Freude im Schacht mit seinen Wermut-Kumpels. Dein Pionier”
„Liebe Mama! Das ist so anstrengend hier, dass viele nicht mehr mit dem Klassenfeind, sondern mit dem Schlaf kämpfen. Nur bei dem SEW-Vorsitzenden Horst Schmitt ist es anders. Der schläft schon seit Stunden im Präsidium. Dein Pionier”
„Liebe Mama, wie oft hast du gejammert, dass man nie wisse, ob der Konsum auf oder zu sei. Eben wurde verkündet: Der Handel steht geschlossen hinter der SED. Dein Pionier P.S. Kann ich deine Einkaufsnetze für die Altstoffsammlung bekommen? Du brauchst sie ja nicht mehr.“
Die Öffnungszeiten im Einzelhandel waren im DDR-Alltag ein richtiges Problem. Oft hing ein Schild mit der Aufschrift „Wegen Warenannahme geschlossen“ in der Tür. Dies konnte mehrere Stunden dauern und ich beschloss in solchen Fällen am nächsten Tag wiederzukommen. Doch statt des erwarteten reichhaltigeren Angebots hatte nur die Verkäuferin eine neue Frisur.
Wenn es nichts vom Parteitagsgeschehen zu kommentieren gab, widmete ich mich einzelnen Mitgliedern meiner Delegation. In Westberlin gab es zu jener Zeit eine sogenannte parteifeindliche Strömung in der SEW, viele wurden ausgeschlossen oder erklärten selbst ihren Austritt. Da auch der Chef der Schiedskommission zu unserer Delegation gehörte, der mit diesen Fragen zu tun hatte, stand im Brief:
„Achim ist ein begeisterter Abzeichensammler. Er hat schon einen richtig großen Karton voll. Leider kann man gar nicht mit ihm tauschen, denn er sammelt nur eine Sorte, die SEW-Nadeln.”
Über zwanzig Briefe gingen auf die Reise und es wunderte mich, dass keiner zurückkam. In der Pause nahm mich Achim beiseite: „Hör mit den Briefen besser auf. Der Delegationsleiter hat alle beschlagnahmt und will ein Parteiverfahren gegen dich einleiten. Wir werden das aber verhindern, denn schließlich haben wir uns alle amüsiert. Und gegen uns alle kann er nichts machen.”
Ich bekam meine Briefe zurück und es gab kein Parteiverfahren. Die Solidarität hatte gesiegt. Ich war meinen Genossen dankbar und wieder einmal stolz darauf, in der richtigen Partei zu sein.
Während der Abende im „Hotel Unter den Linden” herrschte ausgelassene Stimmung. Hier saßen auch die Funktionäre der DKP, die ebenfalls als Gäste am Parteitag teilnahmen. Plötzlich klang aus ihren Kehlen: „Gehn wir mal rüber, gehn wir mal rüber, zu Schmitt seine Partei“ und sie setzten sich zu uns. Gemeinsam sangen wir die alten FDJ-Lieder aus der Nachkriegszeit. „Go home, Ami, Ami go home, spalte für den Frieden dein Atom“ durfte nicht fehlen und das Thälmann-Lied wurde natürlich mit der letzten, in den aktuellen Liederbüchern nicht mehr enthaltenen Strophe und ihrer Zeile „wird auch der Rhein wieder frei” geschmettert. Wir hatten denselben Traum: Ein wiedervereinigtes, sozialistisches Deutschland.
In Sibirien
Wieder einmal sollte ich die Sowjetunion besuchen. Eine Delegation des Parteivorstandes, geleitet vom SEW-Vorsitzenden Horst Schmitt, fuhr nach Sibirien zur Baikal-Amur-Magistrale, kurz BAM genannt. Hier entstand eine neue Bahntrasse parallel zur transsibirischen. Einige Genossen Betriebsräte, Gewerkschafter, ein Redakteur der Parteizeitung und ich als Pioniervorsitzender gehörten zur Reisegruppe.. Eine Woche Seite an Seite mit dem Parteivorsitzenden, zum einen fühlte ich mich geschmeichelt, zum anderen dachte ich, dass das auch schiefgehen könne.
Wir flogen über Moskau, Omsk, Irkutsk nach Tschita. Nach jeder Zwischenlandung ein Empfang, Abendessen, Übernachtung. Der Wodka floss reichlich, die sibirischen Genossen nannten ihn Wanderstäbchen für den nächsten Tag. In Tschita erfuhren wir einiges über die extremen Arbeitsbedingungen. Im Winter bei minus 50 Grad wechselten die Bauarbeiter stündlich zwischen Arbeit im Freien und Aufwärmen in der Baracke. Zuerst hätten sie gravierende Fehler gemacht, erklärten die sowjetischen Genossen freimütig. Die Häuser wurden ohne Fundamente auf dem Dauerfrostboden gebaut. Als ihre Bewohner im Winter heizten, taute der Boden auf und die Häuser neigten sich, einige brachen völlig zusammen.
„Also ein ziemliches Affentheater“, fasste ich zusammen, „habt ihr der Stadt deshalb den Namen von Tarzans tierischem Gefährten gegeben?“
Ich lachte als einziger in der Runde.
„Unser Pioniergeneral hat einen sehr speziellen Sinn für Humor“, entschuldigte der Parteivorsitzende.
„Pioniergeneral“- was wollte er damit sagen? General ohne Truppen? Natürlich wusste er, dass wir nur knapp 300 Pioniere in Westberlin hatten. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Mit der Eisenbahn ging es auf der bereits fertiggestellten Trasse nach Tynda. Eine schier endlose Fahrt durch die sibirische Tundra. Hort Schmitt blickte aus dem Fenster und sagte: „Man denkt die Landschaft ist immer gleich, aber sie verändert sich doch.“
„Was auch für die Partei zutrifft“, scherzte ich. Schmitt sah mich strafend an: „Du weißt, wie die enden, die das wollen.“
Natürlich wusste ich, dass Schmitt auf die innerparteiliche Opposition angespielt hatte. Schmitt lachte nicht, sondern murmelte etwas wie „ab jetzt nur Pionierleutnant“.
In Tynda besichtigten wir das Gebäude der Parteileitung, das Kaufhaus mit seinem Riesenangebot an bei sowjetischen Frauen beliebten Pelzmänteln und eine Schule. Im Raum, in dem die Kinder Deutsch lernten, hingen neben der Tafel zwei handgemalte Landkarten, eine von der Bundesrepublik und eine von der DDR. Hier war die DDR größer als die BRD. Die Schüler durften sich melden, um uns Fragen stellen. In der DDR und in Westberlin gab es in den Schulen eigentlich keine starren Regeln für das „Aufzeigen“, da ging der Zeigefinger hoch, manchmal auch die ganze Hand oder manche Schüler schnipsten sogar mit den Fingern. Nicht so in der Sowjetunion. Alle Schüler mussten ständig beide Ellenbogen auf dem Tisch haben, die rechte Hand auf dem linken Unterarm liegend. Zum Aufzeigen wurde der rechte Unterarm so nach oben geschwenkt, dass der Ellenbogen auf der Tischfläche blieb. „Und die sowjetische Reformpädagogik darunter“, dachte ich.
Mit einem Hubschrauber flogen wir danach zu einer Pelztierfarm, die von sibirischen Ureinwohnern, den Ewenken, betrieben und einem Russen geleitet wurde. Dieser verband seinen Begrüßungstrinkspruch mit einem Witz: „Treffen sich zwei Ewenken. Sagt der eine: ,Willst du einen politischen Witz hören?' ,Nein, danke', sagt der andere, ich will doch nicht in die Verbannung.“
Das wäre die Gelegenheit gewesen über die Geschichte der BAM zu informieren. Das Bahnprojekt startete bereits in den 30er Jahren und die berüchtigten Zwangsarbeitslager GULAG säumten es.. Aber davon hörten wir während der gesamten Reise nichts. Der Hubschrauber brachte uns zu einer Baustelle der BAM. Eine kleine Wohnsiedlung mit Gästehaus, in das wir einquartiert wurden, erwartete uns.
„Die Bauarbeiter mit ihren Familien kommen aus allen Teilen der Sowjetunion, das ist eine große Völkerfamilie hier“, informierte ein sowjetischer Parteifunktionär. Von den Arbeitern fehlte jedoch jede Spur. Ich schlug den Genossen Betriebsarbeitern vor, selbständig Kontakte herzustellen. Wir verließen das Gästehaus und schlenderten durch die Siedlung. Aus einem Holzhaus hörten wir Gesang und klopften an die Tür. Wir wurden sofort willkommen geheißen. Dicke Teppiche lagen nicht auf dem Boden, sondern hingen an den Wänden. In der Mitte des Raumes stand ein reich gedeckter Tisch.
„Esst und trinkt mit uns, erzählt, woher ihr kommt und was ihr macht“, luden uns die Gastgeber ein. Es waren viele Männer und einige wenige Frauen. Noch bevor wir Platz genommen oder die Fragen beantwortet hatten, wurde die Eingangstür von außen mit lautem Knall aufgetreten und einer von unseren sowjetischen Betreuern stürmte mit zwei Milizionären herein.
„Sofort zurück ins Gästehaus!“, befahl er. Wir gehorchten. Auf dem Weg fragte ich ihn, warum er denn nicht angeklopft habe.
„Wir haben laute Stimmen gehört, da dachten wir, dass ihr in Gefahr seid. Wir haben da unsere Erfahrungen.“
Also nur friedlich und ohne Konflikte schien die BAM-Völkerfamilie nicht zu leben. Unsere kleine Gruppe versammelte sich zu einem Umtrunk in meinem Zimmer, auch um über das Erlebte zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass wir keinen Wodka mehr hatten. Da ich wusste, wo sich der Lagerraum des Gästehauses befand, holte ich eine Flasche. Die Tür war nicht verschlossen und ich würde unsere „Notlage“ am nächsten Morgen erklären.
Beim Eintreffen zum Frühstück ergoss sich eine Standpauke von Horst Schmitt über uns. Diebstahl, Vertrauensbruch, Missbrauch sowjetischer Gastfreundschaft. Der Schuldige solle den Mut haben, sich zu melden. Ich meldete mich, bekam aber keine Gelegenheit, das Wort zu ergreifen, um das Ganze wie beabsichtigt zu erklären. Schmitt sprach nur sein Schlusswort: „Ich entschuldige mich im Namen der Delegation für das Verhalten unseres Pioniergefreiten und wünsche guten Appetit beim Frühstück.“
Zwei Tage später waren wir zurück in Westberlin. Unsere Gruppe hatte sich aufgelöst, nur mit den drei Genossen Betriebsarbeitern ging ich in eine Weddinger Pizzeria, weil wir noch Hunger hatten. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, aber wir spielten sowjetische Delegation, die zu Besuch in Westberlin ist. Einer war der Dolmetscher, wir anderen die Russen. Die Kellner nahmen es für bare Münze und freuten sich über die Geschenke aus der Sowjetunion. Wir hatten so viele Abzeichen, Teebeutel und Souvenirs bekommen, dass wir gern davon abgaben. Das machte solchen Spaß, dass wir es anschließend in der U-Bahn fortsetzten. In gebrochenem Deutsch mit russischem Akzent wandte ich mich an die Leute im Wagen:
„Genossen Fahrgäste“, wir chaben Gäschähnke fir euch von Mitterchen Russland.“
Wir verteilten Teepackungen und steckten den Fahrgästen Lenin-Abzeichen an.
„Wir chaben nur finfzähn Minuten gebraucht bis Kurfirstendahm, bei Krieg hat gedauert länger. Wann kommt Germannplaatz? Wir chaben gestellt Panzer in Parkhaus.“
Die Fahrgäste blieben unaufgeregt, freuten sich über die Geschenke, wenn es Tee war.
„In KaDäWä nicht mähr können einkaufen, iest jetzt Kagäbä.“
„Jetzt müsst ihr aussteigen, hier ist Hermannplatz“, unterbrach mich eine Frau..
Beim Verlassen der U-Bahn entdeckte ich zwischen den Fahrgästen einen Funktionär vom Parteivorstand der SEW. Er steckte seinen Kuli ein und murmelte: „Alles gesehen, alles gehört.“
Es muss noch jemand mitgeschrieben haben. Zwei Jahre später kam Udo Lindenberg mit „In fünfzehn Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm“ in die Charts.