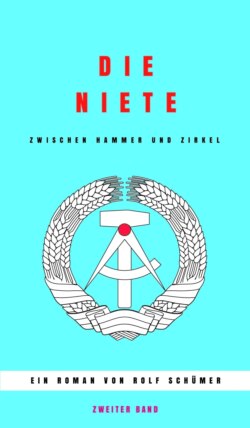Читать книгу Die Niete - Rolf Schümer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Die Sternstunde des Toastens
Einmal im Jahr traf sich die Leitung der Westberliner FDJ (FDJW) mit der Führung der DDR-FDJ. Im Gästehaus in der Pistoriusstraße in Berlin-Weißensee wurde getafelt, eine Singegruppe beklatscht und viel getrunken. Das Trinken war eine wichtige Zeremonie. Der Reihe nach brachte jeder einen Trinkspruch aus. Dieser musste politisch korrekt, aber auch pointenreich sein. Wenn es dem Redner nicht gelang, am Ende seiner Ausführungen die Versammelten zu Beifall und Gelächter zu bringen, rutschte sein Name in der Kaderliste auf die Abstiegsränge. Diese Gefahr wuchs zu vorgerückter Stunde, wenn sich bei einigen die klaren Gedankengänge wegen des Klaren oder des Weinbrands eingetrübt hatten.
„Ich möchte meinen Toast ausbringen”, war die am Anfang zu verwendende Formulierung. Natürlich hatte niemand die Absicht eine Scheibe gegrillten Weißbrotes in den Garten zu führen. Oder eine Mauer zu bauen. Jeder Trinkspruch hieß vornehm Toast. Das erhob ihn aus den Niederungen Met schlürfender Germanen, verlieh ihm staatstragende Bedeutung und ging einher mit scharfzüngigem politischen Verstand.
In der Mitte der Tafelrunde saß Egon Krenz, Vorsitzender der FDJ, neben ihm Wolfgang Herger, sein Stellvertreter. Egon würdigte die enge Freundschaft zwischen FDJ und FDJW. Das Wort „unverbrüchlich“ wurde nur im Zusammenhang mit der Sowjetunion verwendet. Er beendete seinen Trinkspruch folgendermaßen:
„Das Mittelalter brachte wenig Fortschritt, aber ich möchte meinen Toast ausbringen auf seine Ritter, deren Faustregel noch heute gilt: Dem Feinde das Schwert, dem Freunde die Scheide.“
Das war gelungen, freudige Zustimmung und Zuprosten überall. Klassenkämpferisch mit Wortspiel unter der Gürtellinie. Da hatte es Volker, Vorsitzender der Westberliner FDJ, als nächster Trinksprecher schwer. Er beendete seinen Toast: „Wir sind die Fans von Egon Krenz.”
Spärlicher Beifall, gezwungenes Lachen. Das war zu simpel, wirkte anbiedernd. Als ich an der Reihe war, vollendete ich mit dem Satz:
„Und es schallt aus jedem Kerker, wir sind die Fans von Wolfgang Herger!”
Zunächst herrschte betretenes Schweigen. Herger war als Stellvertreter für Sicherheitsfragen verantwortlich und damit auch für die Zusammenarbeit mit der Stasi. Dann platzte Egon Krenz schier vor Lachen, die anderen taten es ihm nach. „Mit welch offensiver Ironie hat der Westberliner Genosse die Arbeit meines Stellvertreters gewürdigt und gleichzeitig die Anbiederung des Vorredners zurückgewiesen“, wird Egon Krenz gedacht haben. Ich hatte nur nach einem passenden Reim gesucht. Dass wegen Hergers Arbeit einige Leute in DDR-Gefängnissen hockten, kam mir überhaupt nicht in den Sinn.
Das Kulturprogramm mit Singeklub beendete den offiziellen Teil. Danach gaben auch wir uns den Sangesfreuden hin. „Junge Pioniere bauen den neuen Staat, wo nur zählt, wer etwas leistet, dem Schmarotzertum erklären wir den Krieg” fehlte nie, ebenso das Lied der Stasi „Denn zu jeder Stunde schützen wir die Republik”. Solche Abende gingen mit dem Erzählen von Possen und Witzen in die letzte Runde. Possen wurden angeblich wahre Begebenheiten genannt, bei denen jemandem etwas misslang, eine Art anekdotenhafter Selbstkritik. Wenn keiner mehr Possen zu erzählen wusste, schlug die Stunde der Witze. Diese waren polen-, russen-, religions- oder frauenfeindlich, der jeweils aktuellen politischen Lage angepasst. Hier ein Burner aus der Zeit, in der der polnische Parteichef Kania nach Meinung der SED zu lasch mit der erstarkenden Gewerkschaft Solidarnosc umging:
Ein Angler sitzt masturbierend am Spreeufer. Plötzlich taucht vor ihm ein goldener Hai im Wasser auf.
„Ich kann dir drei Wünsche erfüllen!“, sagt der Fisch. Der Angler überlegt nicht lange:
„Zuerst möchte ich meinen bestellten Trabi.“
Zack, der Wagen parkt vollgetankt hinter ihm.
„Dann einen Sack voll mit Westgeld.“
Zack, ein praller Geldsack steht neben ihm.
„Und als dritten Wunsch“, der Angler zögert einen Moment, sein Blick fällt auf sein noch steifes Glied, „als Drittes wünsche ich mir eine riesengroße Fotze.“
Zack, der Hai taucht unter, Kania steigt aus dem Wasser.
Bei den Russen-Witzen rangierten diese beiden unter den Top Ten:
Ein Mann kommt ins Rathaus und sagt, dass er Hundesteuer bezahlen wolle. Die Angestellte sieht in den Unterlagen nach und fragt verwundert:
„Aber Sie haben doch gar keinen Hund.“
„Na, und? Haben Sie einen Russen zu Hause?“
Der andere:
„Was brummt nicht und passt nicht in den Arsch?“
„Ein sowjetischer Arschbrummapparat.“
An den Jahrestagen der DDR nahmen wir mit einer Delegation teil. Auf der Ostberliner Ehrentribüne stehend, ließen wir den Geburtstags-Fackelzug der FDJ an uns vorbeiziehen. Wir standen neben den Funktionären der FDJ und auch ich rief aus vollem Hals: „DDR, mein Vaterland!”. Dabei schwenkte ich mein Winkelement. Das wird Wink-Element ausgesprochen, es hat nichts mit Winkeln zu tun! Als Winkelemente bezeichnete man in der DDR blaue oder rote Stofftücher. Sie waren so groß wie Tempo-Taschentücher im entfalteten Zustand, aber wegen der zur Herstellung verwendeten Kunststofffasern nicht zum Schnäuzen geeignet. Sie verliehen dem Element eine Glätte, die jede Haftung ausschloss.
Mein Tribünen-Nachbar hatte kein Tuch bekommen oder es vergessen. Da erblickte er die pralle ALDI-Tüte zu meinen Füßen. Als Plastikprodukt eines kapitalistischen Supermarktes konnte er sie nicht erkennen, da wir es uns zur Angewohnheit gemacht hatten, die Tüten mit dem Werbeaufdruck nach innen zu wenden, wenn wir in die DDR fuhren, um keine Gelüste auf westliche Ware zu wecken.
„Was haste in der Plaste-Tiete?”, outete er sich als Voll-Ossi.
„Reis“, antwortete ich wahrheitsgetreu, da ich direkt nach dem Fackelzug im Osten zu einer Nachtvorstellung der „Rocky Horror Picture Show” in einem Kino im Westen mit Kumpels verabredet war. In der Szene, in der Brad und Janet einer Trauung beiwohnen, warfen alle Zuschauer Reiskörner in Richtung Leinwand.
„Wozu isn der?“ „Zum Werfen.“
„Und warum wirfste nich?” „Ist für später.”
„Dann ist doch alles vorbei! Jetze ran an den Speck!”
Bevor ich etwas unternehmen konnte, griff er sich die Tüte und warf den losen Reis Handvoll für Handvoll über die Köpfe der Vorbeimarschierenden. Es zischte und knackte, wenn Reiskörner auf eine brennende Fackel trafen.
„Endlich mal was Neues!”, jubelte er.
Gut, dass kein Mais in der Tüte war. Die ausbrechende Popcorn-Euphorie hätte womöglich die 500er Marschblöcke an den Rand der Auflösung oder den Zug zum Stehen gebracht. Es dauerte nicht lange, bis mein Nachbar vergnügt mit der leeren Tüte wedelte. Es machte mir nichts aus, denn meine Kumpel brachten ebenfalls immer Reis zur „Rocky Horror“ mit. Das würde auch für mich reichen.
Wer wagt, gewinnt
Im Westberliner Jugendverband wurde wieder einmal eine sogenannte „spektakuläre Aktion" vorbereitet. Mit solchen Aktionen sollte Aufsehen erregt werden, der Jugendverband und seine Aktivitäten in die Presse kommen, was sonst nie der Fall war, abgesehen von Berichterstattungen in der Parteizeitung „Wahrheit“. Diesmal ging es um den Berlin-Besuch von Hanns-Martin Schleyer, dem Chef des bundesdeutschen Arbeitgeberverbandes. In der Meinekestraße wollte er eine Hotelschule besichtigen und ich als Schuljugendverantwortlicher bekam den Auftrag, ihn als unerwünschte Person aus der Stadt zu weisen. Ich teilte drei Genossen ein, die mit „Sandwichs“ vor der Schule stehen sollten. Sandwich hieß ein Doppelposter, von dessen eine Hälfte die Brust und die andere Hälfte den Rücken des Trägers bedeckte. Darauf standen einige seiner Missetaten, nicht des Trägers, sondern des Arbeitgeberchefs. Auch seine frühere Zugehörigkeit zur SS. Ich hielt nur eine Mappe mit der selbst gestalteten Ausweisungsurkunde in der Hand, war ausnahmsweise seriös gekleidet, um nicht als Störenfried eingestuft zu werden. So konnte ich, ohne von irgendwelchen Sicherheitsleuten behelligt zu werden, am Tag der Aktion an Schleyer herantreten und ihm die Urkunde überreichen.
„Hiermit weise ich Sie aus Westberlin aus.“
Er lächelte freundlich, nahm die Urkunde und wäre sofort weitergegangen, wenn sich nicht einer seiner Jackettknöpfe an meinem Mantelärmel verhakt hätte. Ich zog an meinem Ärmel, er riss an seinem Jackett. Sein Knopf fiel zu Boden, er hob ihn nicht auf, sondern eilte ins Schulgebäude, begleitet von den Sicherheitsleuten, die sich vorher auf die Sandwich-Genossen konzentriert hatten. Der „Wahrheit“-Fotograf hatte sein Foto geschossen, andere Pressevertreter waren nicht gekommen. Ich nahm den Knopf und beschloss, künftig bei jeder Aktion etwas als Souvenir zu behalten. Heute habe ich eine beachtliche Sammlung solcher Gegenstände, nur den Schleyer-Knopf habe ich nicht aufbewahrt. Ich warf ihn kurz nach der Schleyer-Entführung weg, da ich befürchtete, dass die Polizei bei der Fahndung nach den Tätern auch Spürhunde einsetzen würde, die sie zu mir führen könnten.
Das zweite Souvenir habe ich dagegen immer noch. Es ist der Hut einer kleinen pommerschen Trachtenpuppe. Mit der Aktion „Zeitfracht“ stieg ich zur Nummer Eins der Aktionsspezialisten im Jugendverband auf:
Wir führten eine „Anti-Ostkunde-Kampagne“ durch. Die deutschen Grenzen von 1937 sollten aus Schulbüchern und Atlanten verschwinden, die DDR als souveräner Staat eingezeichnet, Bezüge auf ehemalige deutsche Ostgebiete aus den öffentlichen Gebäuden entfernt werden. Im Rathaus Charlottenburg gab es einen Pommern-Saal und im Foyer hatte die pommersche Landmannschaft, ein Vertriebenenverband, eine Vitrine aufgestellt. Ich mietete einen Pritschenwagen und kaufte drei blaue Kittel. Im Branchentelefonbuch fanden wir den Eintrag einer Spedition „Zeitfracht“. Wir kopierten ihn, schnitten die Kopien aus und klebten sie auf die Kittel, die wir uns anzogen Der Fahrer blieb im Wagen, der Genosse Friedrich und ich stiegen aus und gingen grüßend am Rathauspförtner vorbei. An der Vitrine angekommen deckte ich eine Plane darüber. Dann hoben wir den Kasten an und trugen ihn in Richtung Ausgang. Der Pförtner sah uns und stürzte aus seiner Loge. War jetzt alles vorbei? Würde er wissen wollen, was wir da aus dem Rathaus schleppten? Mitnichten. Er beeilte sich nur, uns die Tür aufzuhalten. Wir bedankten uns freundlich, luden die Vitrine auf den Wagen und fuhren direkt zur Müllstation der Stadtreinigung in der Britzer Gradestraße. Dort versenkten wir die Vitrine samt Inhalt. Übrig blieb nur der Puppenhut, den ich mir heimlich in die Tasche stopfte. Der Bezirksbürgermeister stellte Strafantrag gegen Unbekannt und das stand sogar in der Westzeitung „Tagesspiegel“.
Alle Jahre wieder erhöhten die Berliner Verkehrsbetriebe die Fahrpreise. Grund genug für uns, mit Aktionen dagegen zu protestieren. In einigen westdeutschen Städten, wo ebenfalls die Fahrpreise stiegen, gossen Studenten Zement in die Straßenbahngleise.
„Das können wir hier auch tun“, scherzten wir, „die Polizei würde uns nicht daran hindern.“
Es gab haufenweise Gleise, die zwar flach durch die Stadt verliefen, aber der Straßenbahnbetrieb war bereits 1967 endgültig eingestellt worden. Also malten wir nachts irgendwo Protestparolen.
Dabei befanden wir uns einmal nach dem Überklettern des Parkhaus-Gittertores auf dem Dach des Kaufhauses am Hermannplatz. Eine zirka siebzig Zentimeter hohen Brüstung umrandete es. Um unsere Losung „Keine Fahrpreiserhöhungen!“ zu malen, hielten zwei von uns einen dritten an den Beinen fest. So pinselte er Buchstabe für Buchstabe. Als wir am nächsten Morgen auf dem Hermannplatz stehend unser Werk bewunderten, stellten wir fest, dass nur die Passanten unsere Forderung lesen konnten, die auf den Händen zur Arbeit gehen, aus buddhistischem Ehrgeiz im Kopfstand auf dem Platz meditieren oder Hegelianer sind, die sich ihre idealistische Dialektik nicht von Marx auf die Füße stellen lassen wollen.
Die vorhandene Druckkapazität im Stadtvorstand der FDJW reichte nicht mehr aus. Bisher wurden die Flugblatttexte auf Wachsmatrizen getippt, Überschriften oder Illustrationen mussten mühsam und vorsichtig eingeritzt werden, damit die Matrize nicht einriss. An einer solchen Stelle wäre zu viel Farbe durchgekommen und hätte den ganzen Druck verdorben. Fotos konnten mit dieser Technik zunächst gar nicht vervielfältigt werden. Als es dann diese Möglichkeit durch das Brennen gab (eine Nadel, die die auf einer Metallwalze eingespannte Vorlage auf die daneben eingeklemmte Wachsmatrize übertrug), war die Qualität sehr schlecht und bei hohen Auflagen ging die Matrize kaputt.
Eine Offset-Druckmaschine musste her und da viel gedruckt werden sollte, wurde ein Drucker gebraucht. Volker fragte mich, ob ich für das gleiche Geld, dass ich im Supermarkt verdiene, nicht im Stadtvorstand der FDJW arbeiten wolle. Wenn nichts zu drucken sei, könne ich die Zeit für politische Aktivitäten nutzen, mein Verdienst würde dadurch nicht geringer sein. Ich sagte zu und wurde als Offset-Drucker angelernt. Ich lernte nicht nur die Bedienung der Maschine, sondern auch das Beheben von Fehlern. Manchmal kam es vor, dass auf dem bedruckten Blatt an einer Stelle die Buchstaben nur schwach zu lesen waren, sich fast ein weißer Fleck bildete, trotz korrekt geregelter Farbzufuhr für die Walzen. Das bedeutete, dass das Gummituch nicht gleichmäßig vom Gegendruckzylinder abgerollt wurde, es nicht überall die gleiche Stärke hatte. Dann musste genau diese Stelle gefunden und ein Stück Papier zum Ausgleichen exakt dahinter geklemmt werden. Welch eine Fummelei, aber entsprechend wuchs mein Stolz, wenn es mir gelang. Ein Jahr lang arbeitete ich als „Druckmope“ in der Allerstraße. Ich druckte inzwischen nicht nur Flugblätter, sondern auch Broschüren und Zeitungen. Oft nahm sich ein Genosse, der Schriftsetzer gelernt hatte, die Zeit, mir Neues beizubringen. Lay-Out, Spiegeln, Umbruch, Korrekturzeichen blieben für mich keine Fremdwörter mehr.
Plötzlich, wie sie begonnen hatte, ging meine Druckerkarriere zu Ende. Für die Reinigung der Maschine gab es strenge Sicherheitsbestimmungen. Bei der Verwendung des leicht entflammbaren Reinigers durften die Walzen nur von Hand gedreht, der Netzstecker musste vorher gezogen werden. Ich säuberte die Maschine auch immer auf die vorgeschriebene Weise, doch einmal ritt mich der Teufel. Verwegen ließ ich die Maschine auf Touren kommen und goss dabei das Reinigungsbenzin über die Walzen. Die Stichflamme überraschte mich völlig.
„Die Maschine brennt! Die Maschine brennt!",
rufend rannte ich durch den langen Flur. Der erste Genosse, der mich sah, rannte wiederum vor mir her und schrie:
„Der Schürling brennt, der Schürling brennt!"
Sekretärin Herta hatte immer einen gefüllten Wassereimer neben dem Schreibtisch zu stehen, seit sie das Amt der Brandschutzverantwortlichen bekleidete. Von ihr bekam ich 10 Liter Wasser über meine Haartracht bzw. was davon noch übrig war. Von der Druckmaschine dagegen blieben keine Reste. Es wurde keine neue gekauft, trotzdem bekam ich mein Geld weiter. Unsere Druckaufträge erhielt nun der Genosse, der mich angelernt und inzwischen eine eigene Schnelldruckerei gegründet hatte. Die vielen linken Gruppen und Organisationen unserer Stadthälfte garantierten ihm reichliche Nachfrage, sein Unternehmen wurde bekannt wie ein bunter Hund und unter diesem Namen druckt er noch heute.
Zu Jahrestagen des Mauerbaus rechneten wir mit antikommunistischen Aktionen. Nicht zu Unrecht. Einmal wurde die Eingangstür zum Stadtvorstand von Mitgliedern der „Jungen Union“ symbolisch zugemauert. Dies geschah zwar zu der Zeit, als sie sowieso das ganze Jahr verschlossen blieb, aber das Foto von der erfolgreichen Einmauerung wurde in der Springer-Presse veröffentlicht. Darum postierten wir Wachen in allen Räumen des Jugendverbandes in jeder Nacht zum 13. August.
Inzwischen gab es in allen Stadtbezirken von uns angemietete Ladenlokale oder Fabriketagen, die in der Regel als „Sozialistische Klubs“ firmierten, sowie das Kulturensemble der FDJW, das in der Etage eines Geschäftshauses am Hermannplatz residierte.
Nach einer solchen Nacht ohne besondere Vorkommnisse, abgesehen davon, dass ein Wachgenosse mit brennender Zigarette einschlief, den wir mit Hertas Eimer löschten, ging ich mit meinem Kumpel Friedrich zum Frühschoppen in eine Kneipe in der Schillerpromenade. Seit der Pommern-Aktion waren wir eng befreundet. Wir hatten erst an unseren Biergläsern genippt, da steckten der Wirt und seine Frau die Köpfe zusammen und tuschelten in unsere Richtung blickend. Danach kam der Wirt an unseren Tisch und griff nach den Gläsern: „Ich zahle euch aus, ich will keinen Ärger.“
Mit diesen Worten legte er einen Zehnmarkschein auf den Tisch.
„Geht woanders einen trinken, wir haben gerade erst alles wieder renoviert.“ Friedrich und ich gingen und wunderten uns, was uns da geschehen war. Offenbar hatten uns die Wirtsleute mit irgendwelchen Kneipen-Rowdys verwechselt. Merkwürdigerweise passierte uns dasselbe ein paar Tage später in einer Kneipe am U-Bahnhof Britz-Süd noch einmal.
Mit Friedrich unterwegs zu sein, war schon etwas Spezielles. Er kannte Kneipen, in denen sich täglich viele Jahre Knast versammelten. Er trug gern einen Trenchcoat wie die Banditen in Sergio Leones „Spiel mir das Lied vom Tod“. Das schien zu wirken, denn in einer Stampe am Potsdamer Platz wurde uns ein echter Revolver zum Kauf angeboten. Obwohl er nicht viel kosten sollte, lehnten wir ab. Uns fehlte die Schulung für den bewaffneten Kampf. Auf dem Weg zur U-Bahn fragte mich Friedrich: „Kannste dit ooch?“
Ich sah zuerst nichts. Dann bemerkte ich eine feuchte Spur hinter ihm auf dem Bürgersteig.
„Im Trenchcoat kannste beim Loofen pissen“, erklärte er mir.
In der U-Bahn sahen wir eine Frau, die vom Aussehen her vom Balkan stammte. Sie ging von Fahrgast zu Fahrgast und zeigte einen Zettel. Friedrich riss ihn ihr aus der Hand und rief in den Wagen: „Wat steht hier? Bin stumm, obdachlos und meene Frau is jestorben.“
Dann wandte er sich an die Bettelnde: „Denn jeh mal nach Hause und sag deinem Ollen, ditta die Zettel vawechselt hat.“
Oder wir tauschten die in Mode gekommenen Sponti-Sprüche aus, wenn uns selbst keine neuen einfielen. Hatten die einen als Verhohnepiepelung der maoistischen Forderung „Sieg im Volkskrieg“ durch „Sieg im Volkstanz“ einen politischen Hintergrund, waren andere glatter Nonsens: „Indien den Indianern“, „Zypern den Zypressen“, „Libanon als ja“.
Gemeinsames Wohnen
Meine Freundin Carola und ich beschlossen nach dreijähriger Beziehung, es mit dem gemeinsamen Wohnen zu probieren. Wir mieteten eine Wohnung in der Neuköllner Herrfurthstraße. Von hier erreichte ich zu Fuß in wenigen Minuten den Stadtvorstand. Die Wohnung lag im ersten Stock des Vorderhauses. Sie hatte vier Zimmer, eine Dreizimmerwohnung des Vorderhauses war mit einer Einzimmerwohnung des Seitenflügels zusammengelegt worden. Links von der Wohnungstür ging es in die Küche mit Fenster zum Hof. Rechts zwei Zimmer zur Straße, das erste sollte Wohn-, das zweite Schlafzimmer sein. An den Flur schloss sich ein Berliner Zimmer an, das künftige gemeinsame Arbeitszimmer. Dann musste man zwei Stufen hinabsteigen, um in ein weiteres Zimmer zu gelangen, die ehemalige Stube der Einzimmerwohnung. Dahinter lag das Bad, die ehemalige Küche. Der Platz reichte für mehr als zwei Personen, aber vielleicht würden wir irgendwann Nachwuchs haben.
Wir mussten viel renovieren. Die gesamten elektrischen Leitungen waren noch Aufputz verlegt. Ich ackerte mit der Putzsäge, um Nuten für neue Kabellitze zu fräsen. Carola stand auf der Leiter und kratzte die alten Tapetenschichten ab. Sie trug Jeans, eine bunte Bluse und hatte sich ein Kopftuch in der Art umgebunden, wie ich es bei russischen Arbeiterinnen gesehen hatte. „Meine kleine Sowjetfrau“, dachte ich verliebt, „wie schön wäre es, mit ihr auch Kinder zu haben.“
Doch offene Beziehungen, wie die unsere, bargen auch Risiken. Im „Casaleon“, einer linken Kneipe in der Hasenheide, in der sich abends Schüler, Studenten und Künstler trafen, verliebte ich mich in eine Studentin, wieder einmal ein Elke-Typ. Wir verbrachten die Nacht zusammen und ich habe heute noch ihren Duft in der Nase, wenn ich ein Glas Marmelade öffne. Sie roch so herrlich nach Pfirsich. Am nächsten Morgen fiel mir ein riesiger, holzgetäfelter Spiegel im Flur auf.
„Den kannst du haben“, sagte sie. Ich verspürte große Lust, dieser Nacht noch weitere folgen zu lassen, auch ein Ende der Beziehung mit Carola erwog ich in meiner Verliebtheit. Ich sprach mit Friedrich darüber. Ich folgte seinem Rat, die Beziehung mit Carola nicht zu gefährden. Die Erfüllung des Kinderwunsches in einer soliden Beziehung solle mir gefälligst wichtiger sein, als ein noch so heißes Liebes-Strohfeuer, argumentierte er. Aber den Spiegel habe ich abgeholt und bei ihm ein Jahr im Keller zwischengelagert. Dann kam er nach meinem Fremdgeh-Geständnis in die Herrfurthstr.
Trotz der politischen Arbeit fand ich Zeit für mein Lieblingshobby: Stundenlang und ausgelassen zu tanzen. Mal war ich alleine unterwegs, mal mit Carola oder mit Freunden, entweder aus dem Jugendverband oder von der Fritz-Karsen-Schule. Ob ich ins Ballhaus Spandau nach JWD (berlinerisch für janz weit draußen) fuhr oder in Neukölln im „Rock-It“ am Karl-Marx-Platz schwofte, überall kostete es kaum Eintritt, bis zu einer bestimmten Uhrzeit gab es Bons für Freigetränke und man konnte unkompliziert Bekanntschaften machen. Doch einmal wurde es brenzlig.
Carolas Mutter hatte uns ein Auto geschenkt, einen Mazda 323, das erste Modell, das in Deutschland von seinem japanischen Hersteller verkauft wurde. Ich konnte diesen Wagen nicht leiden, weil ich lange Beine habe und die Sitzeinstellungen nur den Spielraum für asiatische Körpermaße gewährten. Geklappt wie ein Schweizer Taschenmesser saß ich am Lenkrad. Ich befand mich auf dem Weg nach Steglitz zu einer Hardrock-Disko. Vielleicht würde ich „Straps-Harry“ treffen. Der Achtzigjährige tanzte dort oft in Straps und mit freiem Oberkörper. Ich nahm einen Anhalter mit, der dasselbe Ziel hatte. Wir standen beide vor dem Eingang. Ich hatte geklingelt und von innen wurde der „Spion“, das Guckloch in der Tür, geöffnet. Plötzlich hielt der Anhalter einen Revolver vor das Loch und schoss hindurch. Einen Moment lang war ich wie gelähmt. Von drinnen hörte ich wütendes Gebrüll. Die Tür flog auf und ich rannte zum Mazda. Ich hatte panische Angst. Zitternd schloss ich die Tür auf und startete den Motor. Eine Gestalt tauchte wie auf dem Nichts neben dem Auto auf. Ich sah den Teleskopschläger und verriegelte geistesgegenwärtig die Tür von innen. Der Schlag traf die Windschutzscheibe, die sich sofort in Milchglas verwandelte. Nur dort, wo der Schläger getroffen hatte, klaffte ein kleines Loch.
„Panzerfahrer sehen auch nicht mehr“, dachte ich und fuhr los. Ohne Zwischenfälle schaffte ich es in die Herrfurthstraße. Nach diesem Erlebnis benutzte ich lieber die öffentlichen Verkehrsmittel für meine Disko-Abende. Und oft begann die Party schon im Bus.
Ich kam die Treppe hoch und sah, dass alle Plätze im Oberdeck der Linie 19 besetzt waren. Stehen war nicht gestattet und durch einen Spiegel konnte der Busfahrer sehen, was oben geschah.
„Komm runter, Amigo, sonst fliegst du“, gab er prompt über sein Mikrofon durch. Das nahm ich wörtlich. Ich blieb oben im Gang stehen.
„Dear passengers, liebe Fluggäste! Beachten Sie bitte unsere Sicherheitshinweise!“
Ich zeigte die Notausgänge und bat darum, die heruntergefallene Sauerstoffmaske zuerst bei sich anzulegen und erst danach beim Kind. Alle machten mit! Beim Anlegen der Schwimmwesten zogen sich einige ihre Jacken verkehrt herum an. Beim Üben der Absturzposition brüllte der Busfahrer „brace, brace“ ins Mikro. Als ich ausstieg, rief er mir launig hinterher: „War dit für vasteckte Kamera?“
Die Geschichte des Berliner Nahverkehrs ist reich an Anekdoten. Von tragikomischen, wie der vom angetrunkenen Mann, der von einem U-Bahnsteig in hohem Bogen auf eine unabgedeckte Stromschiene uriniert und das mit seinem Leben bezahlt, bis zu der folgenden amourösen:
Eine Berlinerin, die sich frisch in einen Zugführer der S-Bahn verliebt hatte, stieg zu ihm in den Führerstand am S-Bhf. Nikolassee. Für einen Quickie bis zum nächsten Halt in Richtung Westkreuz, dem Bahnhof Grunewald, verblieben immerhin acht Minuten. Jede S-Bahn ist mit einem SiFa (Sicherheitsfahrschalter) ausgerüstet, der eine Zwangsbremsung auslöst, wenn er nicht alle zweieinhalb Sekunden betätigt wird. Also betätigte der S-Bahner den Schalter mit seinem nackten Hintern. Der knapp bemessene Sekundentakt löste eine derartige sexuelle Hingabe aus, dass die wartenden Fahrgäste am Bahnhof Grunewald sich erstaunt die Augen rieben, als der Zug ohne Halt mit Liebesakt im Führerstand an ihnen vorbeirauschte.
Urlaub zu zweit
Als in Deutschland der Katastrophenwinter 1978/79 begann, flogen Carola und ich zum Ski-Urlaub in die Sierra Nevada nach Spanien. Dort befindet sich das südlichste Skigebiet Europas. Die Pisten sind daher zwei Stunden länger geöffnet als in den Alpen. Wir hatten das Reiseziel deshalb gewählt und weil Carola Spanisch studierte und dort ihre Sprachkenntnisse verbessern wollte.
Während viele deutsche Ortschaften in Schneemassen versanken und extreme Kälte herrschte, verlebten wir warme und sonnenreiche Tage. Der einzige Nachteil für Ski-Sportler: Der Schnee fehlte. Nur in den höchsten Lagen des Mulhacen (knapp 3.400 m über dem Meeresspiegel) gab es zwei geöffnete Pisten. Dementsprechend lange Schlangen bildeten sich am Sessellift, zwei Stunden Anstehen war normal. Da zogen wir es vor, in einer Ski-Bar zu sitzen. Ich lernte ein Heißgetränk aus Kakao und Rum kennen und lieben: Lumumba, benannt nach dem ersten frei gewählten kongolesischen Premierminister, für dessen Ermordung 1961 durch belgische Soldaten der CIA-Chef Dulles persönlich grünes Licht gegeben hatte.
Die Ski-Station, in der wir ein Studio-Apartment gemietet hatten, bot nichts für kleine Geldbörsen. Die Spanier, die sich hier Urlaub leisten konnten, gehörten zu den Wohlhabenden ihres Landes. Bei Gesprächen mit Zufallsbekanntschaften fiel Carola auf, dass sie als Anhänger des Diktators Franco uns Deutsche sympathisch fanden, weil Hitler seine Legion Condor zur Unterstützung der Putschisten geschickt hatte. Bei der Bombardierung Madrids wurde der Stadtteil Salamanca, in dem die Reichen wohnten, sorgfältig verschont. Zum Dank schenkte Franco den Deutschen ein ganzes Dorf bei Cadiz. Bei Kriegsende flohen viele Nazis dorthin und noch heute wehe auf dem Marktplatz die Hakenkreuzfahne, erzählte einer.
Auf solche Gesprächspartner verspürten wir wenig Lust und entdeckten glücklicherweise eine Busverbindung nach Granada. Nach einer Stunde Fahrt erreichte der Bus die Stadt am Fuß der Sierra. Wir besichtigten die faszinierende Alhambra, den Königspalast aus der Zeit, als die muslimischen Mauren herrschten. Wir spazierten durch die Altstadt und entdeckten eine Straße mit einer gemütlichen Bar neben der anderen. Wenn man etwas zu trinken bestellte, gab es eine Kleinigkeit zu essen gratis dazu, die Tapa. Es wimmelte von jungen Leuten, die an der Universität Granadas studierten. In einer abgelegenen Kneipe lernten wir Anarchisten kennen. Sie luden uns erst zum Calimocho, halb Rotwein, halb Cola, ein und danach zur Party in einem Haus. Alle Gäste trafen schwarz gekleidet ein, einige trugen T-Shirts mit dem Logo der deutschen RAF, der Rote-Armee-Fraktion von Baader und Meinhof. Einer fummelte an der Tonanlage und ich erwartete Punk oder Hardrock. Weit gefehlt! Flamenco-Musik erscholl in voller Lautstärke und die wilden „Schwarzen“ volkstanzten sich in Ekstase. Leider konnten wir nicht lange bleiben, sonst hätten wir den letzten Bus zurück zur Ski-Station verpasst.
In den nächsten Tagen verbrachten wir mehr Zeit in Granada als in der immer noch schneefreien Sierra. In der Stadt konnten wir es uns leisten, im Restaurant zu essen. Bei „Leon“ lernte ich Saure Nieren mit Madeira-Sauce kennen, was für ein Genuss! Im Geschichtsmuseum erfuhr ich, dass die Mauren doch nicht so tolerant gegenüber Juden und Christen waren, wie ich es im Schulunterricht gelernt hatte. Wahrscheinlich steckt in jeder Religion der Keim der Intoleranz, weil der Anders- oder Nichtgläubige wegen seines vermeintlichen Erkenntnisdefizits als minderwertig eingestuft wird.
Nach dem Sieg der spanischen Könige über die Mauren wurden dann Moslems und Juden verfolgt. Denn mit den Königen kam die katholische Inquisition, die mit einer Dauer von 500 Jahren in Spanien so lange anhielt, wie in keinem anderen europäischen Land. Um den Häschern der Inquisition zu zeigen, dass hier gläubige Katholiken wohnten, hängten die Einwohner große Schweineschinken außen an die Haustüren. Seitdem spielt Schinken eine wichtige Rolle in der spanischen Esskultur, erfuhr ich.
Nur ein kleiner Teil der Juden blieb von Diskriminierungen verschont. Sie arbeiteten als Steuereintreiber für den König, weil sie sich im Rechnen versierter als andere zeigten. Diese Tätigkeit machte sie bei der Bevölkerung sehr unbeliebt. Der Hass richtete sich nicht gegen den Auftraggeber, sondern gegen seine Büttel.