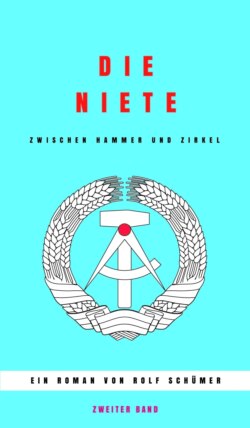Читать книгу Die Niete - Rolf Schümer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Im Schatten Makarenkos
Auf einer Stadtdelegiertenkonferenz der FDJW wurde ich erneut ins Sekretariat gewählt und zum Vorsitzenden der Pionierorganisation ernannt. Ich kam in den Genuss eines neuen Privilegs: Ein Dauerpassierschein für alle Grenzübergänge der DDR. Er war ein Jahr gültig. Um nach Ablauf dieser Zeit einen neuen zu bekommen, musste eine einfache Prozedur absolviert werden: Bei der ersten Einreise im neuen Jahr am Grenzübergang den Zauberspruch aufsagen. Und das galt auch für den erstmaligen Empfang dieses Dokuments. Ich stand vor der Glasscheibe des Sonderschalters für Dienstreisende am Bahnhof Friedrichstraße.
„Ich bin anvisiert“, sagte ich zum Grenzer. Dieser bückte sich und richtete eine Pistole auf mich. Instinktiv ließ ich meine Aktentasche fallen und hob die Hände. Der Soldat schnauzte mich an: „Das ist Anvisieren. Lernt ihr nichts in der Schule im Westen?“
Er legte die Waffe beiseite und sagte etwas freundlicher: „Gehe ich recht in der Annahme, dass du ,avisieren' sagen wolltest?“
Ich nickte und nahm die Hände herunter. „Mit DDR-Bildungsniveau prahlen, aber heiteres Beruferaten im Westfernsehen glotzen“, dachte ich.
„Ich bin avisiert,“ wiederholte ich den Zauberspruch folgsam und korrekt.
„Na, also, warum nicht gleich so“, brummte er und gab mir den Dauerpassierschein, nachdem er meinen Personalausweis kontrolliert hatte.
Als Pioniervorsitzender hatte ich regelmäßig die Pioniersekretäre der Stadtbezirke zu versammeln und anzuleiten, den monatlichen Schulungstag für Pionierleiter vorzubereiten, die Herausgabe der Pionierzeitschrift „Robi“ zu gewährleisten, die Ferienreisen für Westberliner Kinder in die DDR zu organisieren und die Kontakte zu anderen Westberliner Kinderorganisationen zu vertiefen. Außerdem sollten durch Aktionen für die Rechte der Kinder die Pioniergruppen öffentlichkeitswirksamer arbeiten, über Kinderfeste neue Mitglieder gewonnen und Beiträge zur internationalen Solidarität geleistet werden. Dies war mit konkret abrechenbaren Zielen in einem Jahresplan dem Sekretariat vorzulegen. Ich dachte an mein Studium und Gabis Tränen auf der Sekretariatssitzung. In Anbetracht der zu erfüllenden Aufgaben pflegte ich zu sagen: „Kinder sind in der Pionierorganisation das Unwichtigste.“
Doch das war gelogen. Den meisten Spaß hatte ich im Zusammensein mit ihnen. Bei Kinderfesten tanzten wir den Hucki-Pucki und andere Ringelspiele mit Anfassen, die bei uns „Massenfez“ hießen. Ich erfand das Drachensteige-Fest im Herbst, das heute noch in Berlin stattfindet. Mit einigen Pionieren absolvierte ich einen Rock'n'Roll-Tanzkurs, mit anderen ein Detektiv-Spiel mitten in der Stadt. Zum „Tag der Pionierorganisation“ machten wir ein Geländespiel mit Schatzsuche im Schulzendorfer Forst. Jedes Kind sollte eine Wasserpistole mitbringen, die sich in der Ankündigung der Parteizeitung „Wahrheit“ durch einen Druckfehler in eine „Wanderpistole“ verwandelte.
Meine Aufgabe bestand auch darin, die Pionierleiter in den verschiedenen Bezirken mit Spiel- und Bastelmaterialien für ihre Gruppen zu versorgen. Spielaktionen und Kinderfeste wurden veranstaltet und dafür brauchten die Gruppen Preise, die die Kinder an Attraktionen wie „Büchsen werfen“ oder „Nagel einschlagen“ gewinnen konnten. Das waren Stofftiere und Spielzeug für die Besten, als Trostpreise dienten Bonbons und Luftballons. „Die Stadt ist auch zum Spielen da” hieß eine unserer Kampagnen. Um die Einrichtung von mehr öffentlichen Kinderspielplätzen zu fordern, sollten in kurzer Zeit auf Straßen und Plätzen, in Parks und Wohnsiedlungen Spielfeste stattfinden. Dafür benötigten wir eine entsprechend große Menge an Preisen. Sie in Westberlin zu kaufen, war zu teuer.
Darum leistete die DDR solidarische Hilfe. Ost-West-Schienenverbindungen gab es und diese konnte der Westen nicht kontrollieren, weil das gesamte Schienennetz Westberlins dem DDR-Betrieb „Deutsche Reichsbahn“ unterstand. Im S-Bahn-Ausbesserungswerk Grunewald entluden wir ganze S-Bahn-Züge, in denen Berge von Stofftieren und Spielzeug die Grenze überquert hatten. Um die Transportkapazität zu erhöhen, waren alle Sitzbänke vorher ausgebaut worden.
Eine andere Aktion lief nur nachts. Die BILD-Zeitung verbreitete Auto-Aufkleber mit dem Motto „Ein Herz für Kinder”. Ich kaufte Letraset-Buchstaben der gleichen Schriftart und ließ Aufkleber mit dem Text „NATO-Raketen stoppen” drucken. Diese passten genau unter den BILD-Aufkleber, als ob sie dazugehörten. Mit diesen Ergänzungsaufklebern zogen wir dann los und klebten sie unter jedes „Herz für Kinder”, das an einem Auto prangte.
Obwohl die Pioniere Westberlins und die Pioniere der DDR zwei getrennte Organisationen waren, hatten wir dasselbe Datum als Gründungstag, den 13. Dezember 1948. Das konnte man aus der Geschichte erklären oder ein neues Datum für den Westberliner Pioniergeburtstag finden. Wir entschieden uns im Sekretariat für letzteres. Ich sollte herausfinden, wann es in der Geschichte unserer Pionierorganisation eine erste Veranstaltung in den Westsektoren gegeben hatte, die nachträglich als Gründungstag deklariert werden konnte. Da es in Westberlin keine Zeitzeugen oder entsprechende Dokumente gab, bat ich die DDR-FDJ um Hilfe. Ein Treffen mit Friedel Lewin, der ehemaligen Vorsitzenden der Kindervereinigung der FDJ, danach erste Vorsitzende der DDR-Pioniere, wurde organisiert. Es sollte bei ihr zu Hause, in der Ostberliner Baumschulenstraße stattfinden.
Ich fuhr also am Ende der Neuköllner Sonnenallee über die Grenze. Unterwegs kaufte ich noch einen Strauß roter Nelken. Ihre Wohnung lag in einer Wohnsiedlung, die Anfang der dreißiger Jahre im Bezirk Treptow, Stadtteil Baumschulenweg gebaut worden war. Es ist der einzige Ort Berlins, wo die gesamte Gegend „Weg“ heißt, aber in seinem Innern „Straßen“ verlaufen. Oder die Stadtteilbezeichnung geht auf eine ehemalige, dort ansässige Protestbewegung gegen die Aufzucht berindeter Schattenspender zurück. Eine ältere Frau, die mich sofort an Kleine Oma erinnerte, öffnete die Tür.
„Guten Tag, ich bin Rolf Kuhl von der Westberliner Pionierorganisation.“
„Keene langen Reden, dit konnte ick früha ooch nich leiden. Komm rin in die jute Stube.“
Ich trat ein und gab ihr die Blumen.
„Na, dit wär ja nich nötig jewesen“, berlinerte sie weiter und sah sich nach einer Vase im Wohnzimmer um. Die Auswahl war groß. Sie standen auf gehäkelten Deckchen auf einer Kommode, auf Regalen und anderen Möbeln. Dazwischen alle möglichen Staubfänger, Souvenirs und eingerahmte Familienfotos. Ohne lange zu zögern, griff sie sich eine Vase und ging damit in die Küche. Von dort rief sie: „Willste wat übern Knorpel ackern?“
„Nein, danke! Ich bin mit dem Auto da und muss nachher noch fahren.“
„Alkohol hättste von mir wieso nich jekricht“, schallte es aus der Küche. Sie kam mit den Nelken in der Vase zurück und stellte sie auf die Kommode.
„Setz dich endlich hin oder willste Wurzeln schlagen?“
Wir setzten uns an den Tisch und ich erläuterte mein Anliegen. Friedels Augen leuchteten, sie fing an wie ein Wasserfall zu reden:
„Es begann mit dem Jugendwerkhof-Treffen im September 1946, der ersten Konferenz der Kindervereinigung der FDJ. Du kannst dir nicht vorstellen, was bis zur Gründung der DDR für eine Aufbruchstimmung herrschte. Ich war vor dem Krieg Mitglied der SPD, dann im Exil in England. Alle waren wir uns einig. Ob Christen, Liberale, Sozialdemokraten, Kommunisten oder Parteilose: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Und für die Jugend: Nie wieder Zwang und Drill, sondern Selbstbestimmung. Wir wollten ein neues und besseres Deutschland. Beim Fackelzug der FDJ zur Gründung der DDR liefen auch Mitglieder der Falken mit ihren Fahnen mit. In der Kindervereinigung der FDJ, die seit 1948 Pionierorganisation hieß, wollten wir den Kindern antifaschistische und demokratische Werte vermitteln. Es herrschte ein kameradschaftliches Verhältnis, die Pionierleiter waren junge Arbeiter, vor allem Arbeiterinnen, die ehrenamtlich die Kinder betreuten, Pioniere und Erwachsene duzten sich.“
Friedel stöhnte kurz, dann sprach sie weiter:
„Und was ist daraus geworden? Heute ist der Klassenlehrer automatisch Pionierleiter, er muss gesiezt werden, Fahnenappelle, vormilitärische Übungen. So haben wir das nicht gewollt. Farkakt, Jingele!“
Die beiden letzten Worte sagte Friedel auf Jiddisch. „Scheiße, Söhnchen!“ Dann erzählte sie, was ihr 1953 nach dem 17. Juni geschehen war. Als SED-Funktionärin hatte sie vorher den Genossen Herrnstadt unterstützt, der im Politbüro eine Mehrheit für den Sturz Walter Ulbrichts heimlich organisierte. Er hatte dafür bereits die Unterstützung aus Moskau, in Person der künftigen Nr.1 der sowjetischen Nomenklatura, Berija.
Dieser gehörte vorher zu Stalins engstem Zirkel. Als Stalin eine angebliche „zionistische Ärzteverschwörung“ aufgedeckt hatte und viele Mediziner verhaften ließ, befürchtete Berija, selbst Opfer dieser neuen „Säuberungswelle“ zu werden. Anfang März 1953 lag Stalin im Sterben, sein Leibarzt im Gefängnis und Berija verbot zunächst jede medizinische Versorgung des Diktators. Nach Stalins Tod verfügte Berija die Freilassung der eingesperrten Mediziner. Das sollte ein Zeichen der Entstalinisierung sein, er wollte so zum neuen Parteichef aufsteigen. Übertragen auf die DDR hieße das, Honecker durch Mielke zu ersetzen. Doch Berija hatte seine Rechnung ohne den listigeren Chruschtschow gemacht. Dieser ließ ihn zunächst verhaften (Ende Dezember erschießen) und unterstützte seine Gegner, in der DDR Walter Ulbricht. Alle, die eine Ablösung Ulbrichts vorbereitet hatten, wurden von ihren Posten entbunden. Friedel Lewin landete zur Bewährung in der Produktion. Bis in die 60er Jahre arbeitete sie in einem Ostberliner Textilbetrieb.
Ich war von ihren Erzählungen und der Art und Weise, wie sie es vortrug, fasziniert. Die Partei hatte ihr übel mitgespielt, sie sah viele Entwicklungen in der DDR sehr kritisch, blieb aber ihrer Überzeugung treu und das mit einer gehörigen Prise Humor.
„Ich würde dich gern zu Kaffee und Kuchen einladen, ich bin an einem Café am S-Bahnhof Baumschulenweg vorbeigekommen.“
Da sprang sie auf, die Adern an ihren Schläfen schwollen an und ihre Augen funkelten böse:
„Schämst du dich nicht? Mich in dieses Schandhaus abschleppen zu wollen? Und das in meinem Alter!“
„Entschuldige“, stotterte ich, „ich war dort noch nie.“
Die Zornesröte wich langsam aus Friedels Gesicht und sie setzte sich wieder:
„Ich vergaß, dass du aus dem Westen bist.“
Sie beugte sich zu mir und flüsterte nun verschmitzt:
„In Ostberlin kennt jeder den Satz: Willste wat fürn Pulla, jeh ins Café Ulla.“
Wir lachten und Friedel erzählte den Rest ihrer Lebensgeschichte. Nach Ulbrichts Tod arbeitete sie bis zur Rente für die staatliche Plankommission. Sie kannte viele Anekdoten, darunter eine über die gescheiterte Planung einer Stinkbomben-Produktion.
Zurück in Westberlin fragte mich Volker nach dem geeigneten Datum für den Pioniergeburtstag. Daran hatte ich nicht mehr gedacht und kramte in meinen Erinnerungen. Mein Blick fiel auf eine orangefarbene Zigarettenschachtel:
„Es war 1946 im September“, am zweiunddreißigsten.“
Volker zog die Augenbrauen in die Höhe.
„Quatsch“, korrigierte ich mich, „Zahlendreher. Es war der dreiundzwanzigste.“
Volker drehte die Zigarettenschachtel der Marke „Ernte 23“ in der Hand.
„Was für ein merkwürdiger Zufall. Und die Jahreszahl geht auch nicht, der Jugendverband wurde erst anderthalb Jahre später von den Alliierten in Berlin zugelassen.“
„Aus Kindern wurden eben Jugendliche.“
„Keine Geschichtsklitterung“, zwinkerte Volker, „wir nehmen September 1948 und als Tag den 27., das liegt genau zwischen Zigarettenmarke und Zahlendreher.“
Dabei blieb es und meine Pionierorganisation war nun knapp zwei Monate älter als die DDR-Pioniere, von denen wir abstammten. Aber an meine Begegnung mit Friedel Lewin dachte ich noch des Öfteren. Zumindest jedes Mal, wenn ich einen Abend im „Café Ulla“ verbrachte.
Endspurt zum Examen
An der PH wurde eine neue Prüfungsordnung beschlossen, die zahlreiche Verschärfungen beinhaltete. Sämtliche „Scheine“, die Belege über die Seminarteilnahme, mussten nun eingereicht werden. Im Rahmen von Protestaktionen gegen die Verschulung des Studiums hatte ich, wie viele andere Studenten, jedoch meine Scheine auf dem Campus verbrannt. Nach der neuen Prüfungsordnung hätte ich vieles noch einmal machen müssen. Aber es gab eine Frist, innerhalb der man sich nach der alten Prüfungsordnung anmelden konnte, die nur die wichtigsten Belege verlangte. Ich suchte meine vorhandenen Scheine zusammen. Einige Lücken konnte ich schließen, weil der eine oder andere Dozent so nett war, mir einen Schein auszustellen, obwohl ich nicht regelmäßig am Seminar teilgenommen hatte. Als ich glaubte, alle Prüfungsunterlagen zusammenzuhaben, traf mich der Schlag: Mir fehlte der Schein vom Grundschuldidaktikum im 4. Semester! Diesen Schein bekam man nur nach Abgabe einer Didaktischen Akte, die alle Stundenentwürfe, Hospitationsberichte usw. enthielt. Während meines Grundschuldidaktikums hatte ich mir viele Notizen gemacht und wollte später anhand dieser die Akte anfertigen. Das verschob ich immer wieder und nun reichte die Zeit nicht mehr aus, selbst wenn ich meine Notizen noch wiedergefunden hätte. Meine Prüfungsanmeldung grinste mich schadenfroh an, flog in die Küche, kam mit einem Eierstecher zurück, stellte ihn auf den Tisch und nahm die Form eines Luftballons an. Sie stieg zur Zimmerdecke auf und raste dann auf den bleckenden Stachel des Stechers zu. Nach dem Knall verwandelten sich die Ballonfetzen in grell blinkende Leuchtbuchstaben, die den Schriftzug „Willkommen, Erstsemester" bildeten. Bei dieser Vorstellung perlte mir der Angstschweiß von der Stirn. Ich wählte die Nummer der Professorin für Grundschuldidaktik.
„Guten Abend, Frau Doktor Leisner. Mein Name ist Kuhl, Rolf Kuhl. Mit der Lizenz zum Lügen."
Die letzten fünf Worte ließ ich weg.
„Sie erinnern sich hoffentlich, ich habe im vierten Semester das Grundschuldidaktikum in der Grundschule an der Cauerstraße in Charlottenburg absolviert."
„Ja, ja" log nun die Professorin, „ich erinnere mich gut an Sie. Was kann ich für Sie tun?"
„Nun, ich stelle gerade meine Unterlagen zur Prüfungsmeldung zusammen und was sehe ich? Sie haben mir versehentlich keinen Schein für meine Didaktische Akte ausgestellt."
„Ach, herrje, das ist mir aber peinlich“, log Frau Doktor weiter, „geben Sie mir ihre aktuelle Anschrift und ich schicke ihn morgen mit der Post."
Zwei Tage später hatte ich den Schein und meldete mich zur Prüfung.
Eine gewaltige Aufholjagd lag vor mir. Ich ließ mich mehrfach vormittags im Lesesaal der Neuköllner Volksbücherei einschließen (er war nur nachmittags für Besucher geöffnet), um mir anhand von Nachschlagewerken die Grundbegriffe der Erziehungswissenschaften und der Psychologie anzueignen. Ich suchte mir zu den Prüfungsthemen die nötigen Informationen aus den Lexika heraus. Wenn ich zu jedem Prüfungsthema zwei eng beschriebene Seiten mit Stichpunkten zusammenhatte, hörte ich auf.
„Mehr Zeit zu reden hast du in der Prüfung sowieso nicht“, dachte ich und sollte recht behalten.
Nach bestandener Prüfung bewarb ich mich um eine Stelle als Lehramtsanwärter im Schulamt Neukölln. Am Tag des Vorstellungsgespräches zog ich mir meinen Anzug an und steckte eine SEW-Nadel ans Revers. Ich saß im Rathausflur, als ein alter Bekannter an mir vorbeieilte.
„Guten Tag, Herr Stadtrat Böhm, lange nicht gesehen und jetzt werden wir Kollegen.”
Der Angesprochene drehte sich um und sah leicht verstört auf mein Parteiabzeichen. Er erkannte mich nicht wieder.
„Wieso Kollegen? Sie sind doch von der SEW!”
„Ich werde Lehrer bei Ihnen im Bezirk, habe einen Termin bei Schulrätin Laue.“
„Na, das wird sich noch herausstellen“, sagte Böhm und ging sofort zur Schulrätin. Dann bat mich diese in ihr Zimmer.
„Da sie so offen ihre Anstecknadel tragen, möchte ich Sie gleich fragen, ob sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen.”
„Die in der Berliner Verfassung formulierten Grundrechte erübrigen diese Frage.“
„Sie brauchen einen Schulrat nicht über die Verfassung zu belehren!“
„Ich hatte aber den Eindruck.”
Bewerbung abgelehnt und des Raumes verwiesen. Mir war es egal, ich sollte ab Monatsersten hauptamtlich für die FDJW arbeiten. Nur konnte man mich jetzt auch als Berufsverbotsopfer darstellen, das machte sich gut beim Anprangern des Unrechts im Kapitalismus.
Als Wahlkandidat in Britz
Bei der Vorbereitung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 1979 hatte die SEW im Landeswahlausschuss gegen die Zulassung der „Alternativen Liste“ gestimmt. Parteivorsitzender Danelius bezeichnete die AL als „trojanisches Pferd“ der Bourgeoisie. Einige in der Partei und alle meine Freunde außerhalb des Jugendverbandes empörten sich über das ihrer Meinung nach undemokratische Verhalten der SEW. Auch ich war nicht einverstanden. Ich hätte nicht nur gegen die Wahlteilnahme der AL, sondern konsequenterweise auch gegen die aller anderen Parteien gestimmt.
Da ich inzwischen das passive Wahlalter erreicht hatte, kandidierte ich zum ersten Mal für die SEW. Mein Wahlkreis war der Stadtteil Britz, die FDJW-Schulgruppe der Karsen-Schule und eine SEW-Wohngruppe sollten meine Wahlhelfer sein. Neben der Wahlwerbung, die von der SEW in der ganzen Stadt angebracht wurde, ließ ich eigene Plakate für Britz herstellen. Auf dem einen saß ich mit Anzug und Krawatte vor einer Berliner Flagge als „Bürgermeister für Britz“, auf dem anderen stand ich als Clown auf einer Bühne mit der Losung „Für Stimmung im Parlament!“
Bei einer nächtlichen Aktion bemalten wir im Grünen Weg einen langen Bretterzaun mit „Wählt SEW, Liste 5“. Neu dabei war die Methode: Ein Genosse stand Schmiere, von den vierzehn weiteren pinselte jeder einen Buchstaben. Mit roter Farbe malten wir die Ziffer 5 auf viele Bürgersteige. Die Zahl sollte sich so für die Stimmabgabe am Wahltag einprägen. Das gaben wir wieder auf, als sich die Anwohner lediglich über die „Schmierereien“ beschwerten. Beim Wochenmarkt in Britz-Süd hatte ich regelmäßig einen Infotisch, ging aber auch für Gespräche mit den Bürgern von Marktstand zu Marktstand und in die umliegenden Geschäfte. Bei dieser Gelegenheit wollte ich auch den Wirt, der Friedrich und mich aus seiner Kneipe geworfen hatte, über die Verwechselung aufklären. Doch die Gaststätte war geschlossen, vielleicht hatte er zu viele Gäste ausgezahlt.
Obwohl ich bei meinen Gesprächen den Eindruck hatte, dass besonders zur Frage Frieden und Abrüstung viele Bürger unseren Positionen nahestanden, fiel das Wahlergebnis von 1,1 Prozent niederschmetternd aus. Auch in Britz lagen wir nur leicht über dem Durchschnitt. Stadtweit hatten sich die Stimmen für die SEW im Vergleich zu 1975 halbiert, von 26.000 auf 13.000. Die „Alternative Liste“ erzielte 3,7 Prozent, mit uns zusammen hätte es für den Sprung ins Parlament fast gereicht.
Wie immer lag die Schuld beim Antikommunismus, erklärte der Parteivorstand, aber ich bezweifelte es. Sogar bei den Wahlen 1963, anderthalb Jahre nach dem Mauerbau, als die antikommunistische Stimmung viel größer war, hatten wir 1,3 % gehabt. Mit Hinweis auf die inzwischen existierenden Verträge BRD-DDR, des Vierseitigen Abkommen über Berlin (West), weiteren Ergebnissen der Entspannungspolitik hieß es auf allen Parteikonferenzen und -versammlungen seit Jahren: Der Antikommunismus konnte zurückgedrängt werden, das sind auch unsere Erfolge. Verhielt sich der Antikommunismus wie eine Sprungfeder, die, nachdem sie vier Jahre lang mehr und mehr zusammengepresst wurde, exakt zum Wahltag emporschnellte, weil sie dem Druck nicht mehr standhielt? Verhinderten die Newtonschen Gesetze jeden Wahlerfolg? Wir bezeichneten unsere Weltanschauung als wissenschaftlich, da wird es schwer, sich gegen die Naturwissenschaften zu stellen. Vielleicht aber auch nicht. Einmal hielt ich eine SED-Propagandabroschüre in den Händen, deren Titel lautete: „Sowjetmenschen bezwingen die Naturkräfte“.
Ein anderes Argument des Parteivorstandes: Die Bourgeoisie nutzt die undemokratische 5 %-Sperrklausel für die Argumentation der „verlorenen Stimme“ und viele Wähler fallen darauf herein. Die 5 %-Hürde bestand bei allen vorangegangenen Wahlen, also konnte sie allein keine Erklärung für die starken Stimmenverluste sein. Für mich gab es nur eine logische Erklärung: Wir hatten viele ehemalige Wähler an die Alternative Liste verloren. Carola und viele meiner Freunde hatten sie gewählt. Für sie war die AL eine linke, undogmatische Opposition. Die SEW dagegen unglaubwürdig, da sie das Establishment im Westen attackierte, aber das im Osten verteidigte. Mit meinen Wahlplakaten; war ich nicht selbst Ausdruck dieser Janusköpfigkeit?
Nur zeitweilig konnten wir in bürgerlichen Bezirken Zugewinne verbuchen, in den Arbeiterbezirken, wo unsere Stammwähler lebten, ging es kontinuierlich bergab. Bei „Stamm“ musste ich an Bäume denken und das hatten diese Wähler mit dem Wald gemeinsam: Sie starben.
In den Betrieben interessierte sich die Mehrheit der Arbeiter nicht für Politik. Das merkte ich beim Verteilen der SEW-Betriebszeitungen. Versuche, die Wähler in den Wohngebieten mit konkreter Kommunalpolitik anzusprechen, das gab es eher in den bürgerlichen Bezirken, in denen viele jüngere Genossen wirkten. In den Arbeiterbezirken waren unsere Wohngruppen, die eigentlich Wohngebietsgruppen hießen, schließlich wohnte man nicht zusammen, hoffnungslos überaltert. Vielleicht hätten wir auf Betriebsgruppen in Altersheimen orientieren sollen. Auch wenn die Senioren-Genossen noch körperlich in der Lage waren, am Infostand nicht vom Winde verweht zu werden (zumindest bis zu Windstärke 6), lebten sie geistig in einer anderen Welt. Sie schwelgten in KPD-Erinnerungen der Weimarer Zeit, die Sozialdemokraten bezeichneten sie immer noch als Sozialfaschisten. Wie sie den realen Sozialismus propagierten, verstimmte sogar Linientreue: Die offensichtlichsten Missstände, einschließlich derer, die sogar von den regierenden Kommunisten als noch zu überwindende genannt wurden, bestritten sie mit Blick durch ihre rosarote Brille. Wir machten Witze über die Genossen Gruftis, weil sie neues Vokabular, also das nach 1945 entstandene, falsch aussprachen, indem sie gegen die Natronbombe protestierten und Geld für Fiehtnam beim Optiker spenden wollten.
Da sie zahlenmäßig die Mehrheit der SEW-Mitglieder stellten, dachte ich über unsere Parteitheorie nach. Offiziell hieß es: Der Einzelne kann irren, aber die Gesamtpartei macht keine Fehler. Wenn aber die Irrenden in der Mehrheit sind, wie kommen trotzdem die richtigen Beschlüsse zustande? Bei Abstimmungen in Wohngruppen hoben immer alle den Arm, wenn der Vorsitzende es vormachte. Einstimmigkeit als Beweis proletarischer Disziplin.
Sind nach freier Diskussion die Beschlüsse mehrheitlich gefasst, dann ordnet sich die Minderheit unter, um ein einheitliches und geschlossenes Handeln zu gewährleisten, so lautete einer unserer Grundsätze. Doch bei den Parteitagen oder Delegiertenkonferenzen gab es keine freie Diskussion, die Redebeiträge wurden schriftlich vorbereitet und mussten einem jeweils höheren Funktionär vorgelegt werden. „Absprechen“, nannte sich das auf Parteichinesisch. Die Wahlergebnisse standen vorher fest, weil die Delegierten über eine von Funktionären vorbereitete Kandidaten-Gesamtliste abstimmten. Als Neue kamen nur diejenigen in Betracht, die das Vertrauen der Alten besaßen. Im eigentlichen Wahlgang durften nur noch Streichungen vorgenommen oder Namen hinzugefügt werden. Keine Chance für einen spontanen Kandidaten. Sich gegen den Willen der Nomenklatura bei Wahlen durchzusetzen, hätte monatelange konspirative Arbeit erfordert, da Fraktionsbildungen mit Parteiausschluss geahndet wurden. Sicherheitshalber fanden am Vorabend von Beschlussfassung und Wahlgang unter der Leitung eines Funktionärs Delegiertenbesprechungen nach Stadtbezirken statt, um das gewünschte Stimmverhalten zu kontrollieren. Das entsprach unserem Organisationsaufbau, dem „demokratischen Zentralismus“, der von deutschen Sozialdemokraten im 19. Jahrhundert entwickelt worden war, auch um unbequeme Genossen, wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, innerhalb der Partei kaltzustellen.
Die Partei „Die Linke“ scheint mit dieser unrühmlichen Tradition nicht gebrochen zu haben. Bei einem ihrer Bundesparteitage fiel mir auf, dass in der Diskussion zum Entwurf des Leitantrages nur kritische Redner das Wort ergriffen, bei der der Abstimmung darüber am nächsten Tag aber eine große Mehrheit dafür stimmte.
Atomkraft, Tampons und Bananen
Carola und ich organisierten bei uns in der Wohnung eine große Party. Es kamen über hundert Leute, die meisten waren ehemalige Karsen-Schüler. Fast alle hatten den Aufkleber „Atomkraft - nein, danke!“ irgendwo an den Sachen. Auch Carola hatte mehrfach an Anti-AKW-Aktionen teilgenommen. Einmal war sie mit Freunden zur Demo nach Brokdorf gefahren. Hunderte Demonstranten wurden durch einen sehr brutalen Polizeieinsatz verletzt. Carola und die Freunde blieben verschont, aber nach diesem Erlebnis nannten sie die Polizisten wie ich Bullenschweine. Carola entwickelte sich zur Klassenkämpferin, hoffte ich.
Selbst auf Feten war die Atomkraft das Thema Nr.1, allerdings waren alle meine Karsen-Kumpel auch gegen die Atomkraftwerke in der DDR. Als die FDJW „Atomprofitnein, danke!“-Aufkleber nach dem Fast-GAU im nordamerikanischen Harrisburg druckte, wollte sie keiner haben.
„Nur im Sozialismus sind AKW sicher“, argumentierte ich, „dort arbeiten klassenbewusste Experten, die würden zur Not mit den Zähnen die Brennstäbe in die Kühlflüssigkeit ziehen.“ Ich erntete nur Kopfschütteln oder Gelächter. Ich änderte meine Meinung erst nach der Katastrophe von Tschernobyl.
Als Pioniervorsitzender nahm ich an internationalen Konferenzen und Seminaren teil, die von CIMEA, dem Dachverband der Pionierorganisationen einberufen wurden. Für die kommunistischen Jugendorganisationen gab es auch einen Dachverband, den Weltbund der Demokratischen Jugend (WBDJ). Beide hatten ihren Sitz in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Die Konferenzen empfand ich oft als langweilig, dehnte die Pausen aus, um mich an Getränkeständen mit flüssiger Abwechslung zu versorgen. Sie bezahlte man nicht mit Geld, sondern mit Talons, die jeder Teilnehmer bei der Anreise erhielt. Meine „Tampons”, so nannte ich diese Wertgutscheine, waren schnell verbraucht, also ich ging schnorren.
„Haste mal einen Tampon für mich?”, fragte ich eine blonde Frau, die zufällig in der Nähe stand. Sofort öffnete sie ihre Handtasche und begann mit der Suche. Einen echten Tampon in der Hand haltend, stutzte sie: „Für dich? Als Mann?”
Ich erklärte das Missverständnis und bekam das eigentlich Gewünschte geschenkt. So verlief meine erste Begegnung mit Helga Labs, neue Vorsitzende der DDR-Pioniere. In der Folgezeit sah ich sie oft, wir verstanden uns gut. Helga entsprach nicht dem Bild einer typischen Funktionärin. Sie beeindruckte mich durch ihre offene und herzliche Art. Intrigen und Machtpoker, das war nicht ihre Welt. Wahrscheinlich hielt man sie daher für naiv. Einmal betrat sie mit dem Aufnäher der christlichen Friedensbewegung in der DDR „Schwerter zu Pflugscharen” an der FDJ-Bluse das Gebäude des Zentralrats der FDJ. Sie hatte sich nichts Schlimmes dabei gedacht. Entsprach nicht „Schwerter zu Pflugscharen“ der Friedenspolitik der DDR? Stand nicht im sowjetischen Kiew die gleichnamige Skulptur? Der Aufnäher musste runter.
Mit Helga erkundete ich das Nachtleben. Budapest galt als das Paris des Ostens und in einem Nachtklub entblößte sich der Grund: Die anfangs leicht bekleideten Revue-Tänzerinnen zogen sich während ihrer Show immer mehr an. Zum Schlussapplaus standen sie in dicken Pelzmänteln auf der Bühne. Eine andere Begegnung mit Helga bleibt in besonderer Erinnerung: Am 22. Mai 1983 fuhr ich zu ihrer Wohnung in der Leipziger Straße in Ost-Berlin, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren.
„Das ist ja eine gelungene Überraschung“, freute sie sich und führte mich ins Wohnzimmer, „die anderen Gäste kommen erst in einer halben Stunde. Wir können aber schon mal einen Kaffee trinken.“
Während sie in der Küche hantierte, sah ich mich um. Auf einer Eckcouch hockte ein Steifftier-Känguru, das ich sofort erkannte. Ich hatte es ihr Jahre zuvor zum Pioniergeburtstag geschenkt. Das Känguru, aus dessen Beutel ein Känguru-Baby blinzelte, sollte das Verhältnis unserer beiden Pionierorganisationen darstellen. Das Kleine im Beutel waren wir Westberliner. Helga brachte Kaffee und Kuchen an den Tisch und wir sprachen über die Friedensbewegung und die aktuelle Gefahr eines Atomkrieges. Helgas Stimme bebte:
„Ich darf das eigentlich nicht erzählen, aber als Mitglied des Ausschusses für Nationale Verteidigung musste ich vor kurzem eine Liste mit den Namen von Kindern aus der ganzen DDR bearbeiten, für die es einen Platz in einem atomsicheren Bunker geben soll.“
Sie stockte und Tränen stiegen ihr in die Augen.
„Kannst du dir das vorstellen? Ich sitze da und soll mit einem Federstrich über Tod oder Überleben entscheiden? Stundenlang habe ich geweint.“
Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich fühlte mich wie gelähmt. Offensichtlich war die Lage viel ernster als ich bisher glaubte. Natürlich warnten wir auch in Westberlin vor der Kriegsgefahr durch die Politik der Reagan-Administration, aber hieß nicht einer unserer Leitsätze in der Agitation „Übertreibung macht anschaulich“? Schweigend nahm ich Helga in die Arme. Nur einen Moment verharrten wir so, dann wand sie sich abrupt aus der Umarmung. „Mein Mann kommt gleich mit den anderen Geburtstagsgästen. Was sollen sie von uns denken?“
Tatsächlich, als hätte sie die Schritte im Treppenhaus gehört, öffnete sich die Tür, die Geburtstagsschar trat herein und befreite mich aus meiner noch immer sprachlosen Beklemmung.
Ein anderes Mal in Budapest: Der ungarische CIMEA-Vertreter lud mich zu einem netten Abend ein. Neben ihm im Auto saß eine Frau.
„Wir fahren mit meiner Freundin zur Datscha, zu mir nach Hause können wir nicht, da ist meine Gattin.”
Am Ziel angekommen baute er eine Leinwand auf und spielte Porno-Schmalfilme ab. Dabei griff er der Frau in den Ausschnitt, holte ihre Brüste hervor und begann sie zu begrabschen.
„Mach mit, sie hat schließlich zwei!”, forderte er mich auf. Doch ich ließ ihm das beidhändige Vergnügen.
Auf den CIMEA-Konferenzen lernte ich auch den Vorsitzenden der westdeutschen Pioniere, Achim, kennen, der sich nicht weniger langweilte. Zur gemeinsamen Ablenkung und zur Erheiterung der Teilnehmenden heckten wir kleine Streiche aus. Den Fahrstuhl des Konferenzgebäudes bis zur Decke mit Stühlen und Sesseln aus dem Foyer zu füllen oder mit einer Schnur die Blumentopf-Dekoration des Konferenztisches mit dem Jackett des Sitznachbarn zu verbinden. Welch eine polternde Überraschung, wenn dieser aufstand, um zum Rednerpult zu gehen!
Die SEW veranstaltete seit Ende der 70er Jahre große Feste. Das größte war alle zwei Jahre das Pressefest der „Wahrheit” in der Neuköllner Hasenheide. Zehntausende Besucher drängelten sich in den Sälen der „Neuen Welt” und auf dem Parkplatz, wo Buden, Stände und Bühnen einluden. Hinter der „Neuen Welt” organisierte die Pionierorganisation ein großes Kinderfest mit selbst gebauten Attraktionen, aber wir mieteten auch einige Fahrgeschäfte von Schaustellern. Damit viele Kinder aus allen Stadtteilen zum Fest kommen, hatte ich folgende Idee: Alle Pioniergruppen führen in den Wohngebieten „Erbsen-Weitspuck-Wettbewerbe“ durch. Das große Finale mit Siegerehrung würde beim Kinderfest an der Hasenheide stattfinden. Ich schrieb eine Kurzgeschichte, die als Comic gezeichnet und gedruckt zu zehntausenden Exemplaren in der Stadt verteilt werden sollte. Doch mir fehlte ein Zeichner.
Die Westabteilung der FDJ bot ihre Hilfe an. Sie beauftragten einen Genossen damit, der regelmäßig für DDR-Kinderzeitschriften zeichnete. Als ich den fertigen Comic-Entwurf in den Händen hielt, fiel mir ein gravierender Fehler auf. Laut meiner Story hatte ein Kind die Erbsen gegessen, anstatt sie zu spucken. So viele, dass ein Krankenwagen kommen musste. Auf dem Bild sah ich einen flitzenden Rettungswagen mit wehender Rotkreuzfahne. Das kannte ich von meinem ersten Asthma-Anfall im Kaulsdorfer Kinderheim. Aber im Westen fuhren die Krankenwagen ohne Fahne, jedenfalls vor der Mittagspause der Besatzung. Jeder hätte bemerkt, dass die DDR ihre Finger im Spiel hatte. Doch der Zeichner bestand auf seiner künstlerischen Freiheit und lehnte eine Korrektur oder Neuzeichnung ab. Der ZAG-Genosse appellierte an seine Parteidisziplin. Wer „künstlerisch“ und „künstlich“ verwechsele, könne schnell in Teufels Küche kommen. Davon unbeeindruckt zeigte sich der Künstler erst recht dickköpfig und verlangte die Rückgabe sämtlicher Zeichnungen.
Nun brauchte ich einen neuen Zeichner für das ganze Heft. Glücklicherweise übernahm es der Karikaturist der Parteizeitung, aber viel Zeit ging verloren. Nach der Auslieferung der gedruckten Comics blieben viele in unseren Kreisbüros liegen, weil der Pressefesttermin bereits nahte. Außerdem riefen Pioner-Eltern in den bürgerlichen Bezirken zum Boykott des Weitspuckens auf, weil Kinder an versehentlich eingeatmeten Erbsen ersticken könnten. Das Kinderfest wurde dennoch ein Erfolg.
„Der Affe ist los!”, gellte es plötzlich über den Platz. Das Tier eines Leierkastenmannes turnte wild auf einem Baum.
„Rolf, du musst den Affen einfangen, die können beißen, das kann gefährlich werden, vielleicht hat er sogar Tollwut“, sagte mir ein SEW-Funktionär.
Ich fand das zwar übertrieben, ging dennoch zum Leierkastenmann und fragte:
„Haben Sie was zum Runterholen?”
Er hielt mir wortlos seine rechte Hand vor das Gesicht.
„Toller Witz!“, meinte ich und sah mich um.
„Kann ich den Affen mit Obst herunterlocken?”, betonte ich besonders präzise das letzte Wort und zeigte auf den Futternapf unter dem Kasten, in dem Bananen lagen.
„Probieren Sie es, er stammt aus Ost-Afrika.“
„Und Sie haben einen West-Clown gefrühstückt!“
Er zuckte nur mit den Schultern. Ich begann, den Baum hinaufzuklettern. Der Affe beobachtete mich, blieb aber auf seinem Ast sitzen. Ich kletterte höher und streckte ihm eine Banane entgegen. Er schien interessiert. Plötzlich schoss der Affe auf mich zu und biss in meinen rechten Unterarm. Vor Schreck verlor ich nicht nur die Banane, sondern auch fast das Gleichgewicht. Der Affe, und das hatte sich das Miststück vorher überlegt, griff blitzschnell das gelbe Objekt seiner Begierde und schwang sich nach unten, um auf dem Leierkasten schmatzend Platz zu nehmen. Der Leierkastenmann band ihn dort wieder fest. Ich stieg mit blutender Bisswunde ab.
„Du musst sofort ins Krankenhaus!”, hüpfte der besorgte SEW-Genosse vor mir auf und ab. „Soll ich einen Krankenwagen rufen?”
„Quatsch, ich fahre selbst zum Arzt.“
Vom Thema Krankenwagen hatte ich genug. Wenig später saß ich in der Unfallstelle des Urban-Krankenhauses.
„Na, was haben wir gemacht?” fragte die Schwester.
„Ich bin vom Affen gebissen worden.”
„Dann ..hi, ha, hole ich den Arzt“, prustete sie los.
Kichernd verschwand sie hinter einer Tür. Ich saß eine Stunde im Wartezimmer. Endlich ging die Tür wieder auf.
„Kommen Sie bitte mit“, forderte mich die Schwester auf. Ich folgte ihr in ein Behandlungszimmer, in dem ein Arzt am Schreibtisch saß.
„Sie sind also von einem Affen gebissen worden“, stellte er sachlich fest.
Die Schwester gab glucksende Laute von sich und ich warf ihr einen wütenden Blick zu.
„Ich werde Ihnen eine Tetanus-Spritze geben. Haben Sie irgendwelche Allergien? Oder Unverträglichkeiten? Sind Sie schon früher einmal von einem Tier gebissen worden?”
Ich bejahte und schwieg, weil es mir peinlich war.
„Also was? Allergie, Unverträglichkeit oder Biss?” „Biss.“
„Los, erzählen Sie, oder muss ich Ihnen jedes Wort aus der Nase ziehen?”
„Ich lief eine Straße entlang, als ich bemerkte, dass ein böse knurrender Schäferhund mir folgte. Ich lief schneller, der Hund auch. Ich rannte, der Hund auch. Plötzlich hörte ich den Ruf ‚Rolf, bleib stehen!‘ Ich blieb stehen, weil ich so heiße. Der Hund hörte auch auf den Namen Rolf, aber nicht auf den Ruf seines Herrchens und biss mich.”
Die Krankenschwester ließ ein Tablett mit medizinischen Bestecken fallen und wieherte wie ein Pferd.
„So blöd kann nur ein Mann sein!”, triumphierte sie. Der Arzt gab mir die Spritze.
„Das war’s, Sie können wieder gehen.”
„Das konnte ich vorher auch.”
Da war es mit seiner Freundlichkeit vorbei.
„Hören Sie, junger Mann, ich mache hier am Wochenende Dienst und dann muss ich mir dumm kommen lassen? Und ausgerechnet von jemandem, der vorgibt, etwas für die arbeitenden Menschen zu tun!”
Dabei tippte er auf mein „Wahrheit”-T-Shirt. Ich entschuldigte mich und trottete nach draußen. Nur der Krankenschwester, die weiter im Flur „So blöd kann doch kein Mann sein” trällerte, hätte ich am liebsten den Hals umgedreht.
Auf Jubeltour
Jeden Sommer fuhren Hunderte Westberliner Kinder in die DDR-Pionierferienlager. Viele waren keine Mitglieder der Pionierorganisation. Ihre Eltern schickten sie mit, weil diese Fahrten sehr preiswert waren und sie sich keinen gemeinsamen Urlaub mit ihren Kindern leisten konnten oder wollten. Am Abreisetag herrschte gewöhnlich dichtes Gedränge am Treffpunkt S-Bahnhof Friedrichstraße. Unsere Pionierleiter, die die Kinder ins Lager begleiteten und dort betreuten, kümmerten sich um die Eintreffenden und nachdem sich die Kinder von ihren Eltern verabschiedet hatten, ging es gruppenweise nach Ostberlin, wo die Busse warteten. Es kam vor, dass einzelne Kinder sich verspäteten, ihre Gruppe nicht fanden oder noch nicht auf der Fahrtenliste standen, weil die Eltern sich kurzfristig zur Teilnahme entschlossen hatten. Das waren die „Sonderfälle”, für deren Klärung drei Menschen benötigt wurden. Der eine war ich, die beiden anderen Jochen und Georg von der Stasi. Jochen sah aus wie ein Agent aus James-Bond-Filmen, er entsprach allen gängigen Klischees: Ein Meter achtzig groß, breite Schultern, Sonnenbrille, grauer Anzug. Ganz anders Georg, genannt Orje. Er war nicht groß, ging auf die 60 zu und hatte Maschinenschlosser gelernt. Das merkte ich, als er mir das erste Mal die Hand drückte. Es würde wahrscheinlich Wochen dauern, bis ich wieder in der Lage wäre, mit dem gefühlten Tortenblech, das er aus meiner Hand geformt hatte, einen Pionierknoten zu binden.Wenn ein Kind so spät zum Bahnhof kam, dass es drohte den Bus zu verpassen, führte uns Orje über den Ho-Chi-Minh-Pfad in den Osten. Ein Labyrinth von Gängen, das sonst nur Stasi-Leute benutzen durften. Eine Tür auf, einen Gang entlang, vorbei an einem Uniformierten, wieder eine Tür, ein Gang, noch eine Tür und du warst im Osten, ein weiterer Gang, Tür, Uniformierter, Gang, Tür und du warst wieder im Westen ohne die Laufrichtung gewechselt zu haben. Ein solcher Irrgarten wäre der Knüller auf unseren Kinderfesten gewesen! Nach der Wende habe ich nach Spuren dieses Pfades gesucht, aber nichts gefunden.
Ich mochte Orje, weil er sich ehrlich freute, wenn mehr Kinder kamen als auf den Teilnehmerlisten standen und mich streng rügte, wenn es weniger waren. Eine Woche nach der Abreise der Kinder begann meine Besuchstour der Ferienlager, die mich im Lauf der Jahre kreuz und quer durch die ganze DDR führte. Es gab 47 zentrale Pionierlager und jeden Sommer fuhren unsere Kinder in ein anderes. Mal waren sie an der Ostsee im Pionierlager „Kim Il Sun”, mal ging es in den Süden bis nach Seifhennersdorf ins Pionierlager „Rosa Luxemburg“. Außerdem nahm eine Delegation am Internationalen Pionierlager in der Pionierrepublik „Wilhelm Pieck” am Werbellinsee teil und andere Westberliner Kinder verbrachten ihre Ferien in einem Betriebsferienlager in Plau am See, wenn ihre Eltern für die Reichsbahn in Westberlin arbeiteten.
Für meine Besuchstour suchte ich mir einen unserer Genossen als Fahrer aus, da ich nicht das Risiko eingehen wollte, mit Restalkohol am Steuer zu sitzen. Einmal übernahm das mein alter Kumpel Wolle und wir gerieten in eine Polizeikontrolle. Der Volkspolizist verlangte 15 Mark für eine Geschwindigkeitsübertretung. Wolle mimte eine Tunte: „Hach, ich glaube, wir haben wir gar kein Geld dabei, mein Liebster.”
Dann beugte er sich zu mir und sagte: „Oder hast du noch was, Schatzilein?”
Um nicht lachen zu müssen, kniff ich die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. Wolle drehte sich wieder zum Volkspolizisten, versuchte ihn möglichst lüstern anzublicken und meinte: „Hach, ist das kompliziert! Haben Sie keine andere Art der Bestrafung in der DDR?“
„Das wollen Sie lieber nicht wissen,“ reagierte der Uniformierte schroff. Doch Wolle machte weiter: „Aber was haben wir denn da, mein Süßer?”
Er wies auf den am Polizeigürtel baumelnden schwarz-weißen Signalstab, zog sich am Lenkrad hoch und wackelte mit dem Gesäß: „Gib es mir doch mit deinem Stäbchen!“
Der Volkspolizist errötete, dann verlangte er 15 Mark extra wegen Respektlosigkeit. Wir zahlten die 30 Mark und durften weiterfahren.Wir hätten wahrscheinlich auch mehr bezahlt, das war der Spaß uns wert und Ostgeld besaßen wir reichlich.
In jedem Pionierlager wurde ich als Ehrengast begrüßt und durch das Lager geführt, um ein „Bad in der Menge” zu nehmen. Abends saßen wir mit unseren und den DDR-Pionierleitern zusammen. Bei solchen Treffen klappte es oft, eine Frau für die Nacht (am nächsten Morgen ging es weiter) zu bekommen. Die DDR-Frauen himmelten uns Kommunisten aus dem Westen förmlich an. Und in der DDR war es sowieso leichter als im Westen, eine Frau kennenzulernen.
„Sie sind zutraulicher als die Frauen bei uns“, pflegte mein Vater zu sagen. Deswegen hatten einige SEW- und FDJW-Funktionäre auch Ehefrauen, die aus der DDR stammten. Wenn das Eheversprechen geleistet war, kümmerte sich die Westabteilung um die Ausreise. Um den Kontakt zu Eltern und Verwandten nicht abbrechen zu lassen, erhielt die Braut einen Dauerpassierschein als Aussteuer.
Diese Nacht verbrachte ich mit einer Pionierleiterin aus der DDR, die meine Manneskraft forderte, wie ich es noch nie erlebt hatte. Wir trieben es in der leeren Krankenstation, weil ich kein Einzelzimmer hatte. Dort sah es anschließend entsprechend aus. Bei der Abfahrt bemerkte ich beim Blick in den Rückspiegel, dass die Krankenschwester wild gestikulierend auf den DDR-Lagerleiter einredete. Später erfuhr ich, dass es eine Untersuchung gegeben habe und meine Nachtgefährtin nach Hause geschickt worden sei. Ohne Eheversprechen wurden Westkontakte nicht geduldet.
Nächstes Pionierlager, neue Liebesnacht, aber diesmal im Freien. Diese Pionierleiterin lebte in Ostberlin, wo sie als Grafikerin arbeitete. Da wir in Westberlin für das kommende Internationale Jahr des Kindes die Aktion „Die Stadt ist auch für Kinder da“ vorbereiteten, fragte ich sie, ob sie dafür ein Plakat entwerfen könne. Ich hatte auch schon eine Idee: Ein großer Luftballon mit dem Namen der Aktion schwebt über Westberlin. Sie willigte ein, aber sie wisse nicht, wie sie die Silhouette des westlichen Berlins zeichnen solle. Auf Berlin-Stadtplänen der DDR sei Westberlin immer nur als weiße Fläche gedruckt und Fotos von prägnanten Westberliner Gebäuden gebe es auch nicht. Ich versprach ihr, Westberliner Postkarten nach Ostberlin zu bringen. Dann solle ich aber nicht direkt vor ihrer Haustür parken, schärfte sie mir ein, weil sie in diesem Fall mit Konsequenzen zu rechnen habe.
Manchmal donnerte ich sogar mit Eskorte die DDR-Autobahn entlang, wenn ich zu einer offiziellen Veranstaltung als Pioniervorsitzender gebracht wurde. Dann saß ich hinten in einer schwarzen Tatra-Limousine. Vor und hinter dieser fuhren ebenfalls schwarze Autos mit Stasi-Leuten besetzt. Da fühlte ich mich großartig und wichtig, dachte nicht mehr an unsere niedrigen Mitgliederzahlen. In einer einzigen Schule in der DDR gab es mehr Pioniere, als wir in ganz Westberlin hatten. Ich wäre über einen Freundschaftspionierleiter nicht hinausgekommen und hätte die Autobahnstrecke wohl per Anhalter zurückgelegt.
Das Haus in Caputh
Ein FDJ-Gästehaus in der DDR spielte für uns eine besondere Rolle. Hier feierte die Leitung des Jugendverbandes mit einigen Genossen der ZAG regelmäßig den Jahreswechsel. Da bei diesen Aufenthalten zum Jahresende auch gearbeitet wurde, hatte ich eine Schreibmaschine, Papier und weitere Büroartikel im Kofferraum. An der Grenze geriet ich an einen Zöllner aus dem tiefsten Sachsen: „Firn sie pirotäschnische Erzeuschnisse mit?“
Ich bejahte und öffnete den Kofferraum. Verblüfft konstatierte er:
„Oba dis sind ja keene Rakähtn. Dis is ja Pirotäschnik.“
„Und die wollten sie doch sehen“,
Jetzt wurde er wütend.
„Se denken wohl, isch wär een Knallkopp!“
Dass er sich mit dieser Antwort selbst zur „Pirotäschnik“ zuordnete, sagte ich lieber nicht.
Zu Silvester spielten wir auf dem Grundstück des Gästehauses Szenen aus bewaffneten Revolutionen nach, indem wir uns in Mannschaften aufteilten und gegenseitig mit Böllern bewarfen. Darauf folgte ein ausgelassener Umtrunk, nach dem so mancher Schwierigkeiten hatte, sein Bett zu finden. Das geschah auch mir. Ich hatte meine Stube direkt unter dem Dach, gegenüber dem Zimmer einer jungen Hausangestellten. Nur betrunken, aber nicht müde, wollte ich ihr einen Besuch abstatten. Doch ihre Zimmertür war verschlossen. Da bemerkte ich eine hölzerne Wandklappe im Flur und öffnete sie. Ich zwängte mich in das Loch. Nur auf allen vieren ging es im Dunkeln voran. Hatte ich einen neuen Ho-Chi-Minh-Pfad entdeckt? Ich tastete mich weiter um zwei Ecken, wischte mir ständig Spinnweben aus dem Gesicht und stieß mit dem Kopf gegen Dachbalken und dann gegen eine weitere Klappe. Die Hausangestellte schrie gellend um Hilfe, als ich in ihr Zimmer kroch. Ich stand auf, immer noch Spinnweben abstreifend: „Entschuldigung, ich habe mich im Mauerwerk verlaufen.“ Sie schrie trotzdem weiter, also schloss ich ihre Tür von innen auf und ging in mein Zimmer.
Am nächsten Morgen hielt mir Manne eine Standpauke, denn die Angestellte hatte sich beim Heimleiter beschwert. Doch am Ende seiner Moralpredigt sagte er augenzwinkernd: „Wenn du wieder durch den Schornstein, oder wo auch immer du hergekommen bist, zu einem Mädel steigst, dann sei so nett zu ihm, dass es keinen Grund hat, sich zu beklagen.“
Während der Aufenthalte in Caputh, egal ob zum Jahreswechsel oder zwischendurch, ging es locker zu. Wir spielten Karten oder russisches Lochbillard. Solange wir dabei unter uns blieben, konnten wir auch mal über die Stränge schlagen. Doch einmal brachte die Tochter des Heimleiters zur Silvesterfeier eine 18-jährige Freundin mit. Es war ausgerechnet ein Elke-Typ und ich verknallte mich sofort. Bei ihr funkte es genauso, wir trafen uns gleich am nächsten Tag und knutschten die ganze Zeit im Dorf herum. Auch zum Petting fanden wir Zeit und Raum. Zurück im Gästehaus verhängte Volker für mich eine unbefristete Ausgangssperre und schloss mich in meinem Zimmer ein. Sollte ich aus dem Fenster klettern?
„Wage nicht, irgendwie abzuhauen!“, rief er von außen. Nur widerwillig beugte ich mich der Parteidisziplin und habe das Mädchen nie wiedergesehen. Auf Volker war ich stinksauer. Ausgerechnet er verbot mir den Kontakt, obwohl er selbst seine Frau aus der DDR geholt hatte. Nur Manne zeigte Verständnis. Er heiratete später die Tochter des Heimleiters.
Einsatz als Weihnachtsmann
Bei Daimler in Marienfelde hatte die Personalabteilung eine betriebliche Weihnachtsfeier für alle Auszubildenden vorbereitet. Ein Genosse, der dort lernte, unterbreitete eine Idee ganz nach meinem Geschmack: Ich sollte als falscher Weihnachtsmann einige Missstände im Betrieb offen anprangern. Es sei auch leicht, auf das Werksgelände zu gelangen, da vom Unternehmen ein Weihnachtsmann über eine Agentur engagiert worden war. Dessen Rolle müsse ich nur übernehmen. Gesagt, getan. Als Weihnachtsmann verkleidet meldete ich mich am Werkseingang beim Pförtner.
„Sie sind ja früh dran.“
„Ich komme lieber zu früh als zu spät.“
„Na, ob das die Frauen mögen? Aber der Weihnachtsmann hat ja keine! Weißt du, wo es lang geht oder soll der Werkschutz dich hinbringen?”
„Nein, ich kenne den Weg.“
Mein Informant hatte mir alles genau beschrieben. In einer Toilette schloss ich mich in der Kabine ein. Der Azubi-Genosse kam etwas später auch zur Toilette und pfiff beim Pinkeln „Avanti popolo“, mein Einsatz-Signal. Ich wartete bis er verschwunden war, denn niemand durfte uns zusammen sehen. Das hätte ihn seinen Ausbildungsplatz kosten können. Ich ging in den großen Saal. Auf der Bühne stand der Ausbildungsleiter und sprach zu den versammelten Lehrlingen. Als er mich sah, unterbrach er seine Rede und winkte mich zu sich.
„Und wir freuen uns, dass der Weihnachtsmann gekommen ist.”
Mit diesen Worten wollte er die Bühne verlassen.
„Ho, ho, ho, bleib schön hier, der Weihnachtsmann hat dir etwas mitgebracht.”
Die Lehrlinge begannen sich zu amüsieren, weil sie den Chef nicht duzen durften. Der Ausbildungsleiter gehorchte. Er dachte, das gehöre zum Spiel. Die Absprachen mit der Agentur hatte seine Sekretärin gemacht.
„Ich habe gehört, dass nicht alle Auszubildenden einen Spind haben. Und die einen haben, ärgern sich, dass noch nicht einmal ein Motorradhelm hineinpasst”, begann ich. Beifall der Lehrlinge.
„Und es fehlen Umkleideräume für die Mädchen!”, setzte ich fort. Wieder Beifall. Es ging so schnell, dass der Chef gar nicht reagieren konnte.
„Und für diese und andere Missstände gibt es vom Knecht Ruprecht was auf den Hintern!”
Ich nahm meine Rute und schlug dem Ausbildungsleiter mehrere Male auf das Gesäß. Der Saal johlte. Es war Zeit zu verschwinden. Ich flitzte von der Bühne und verließ durch einen Notausgang das Werk. Zur selben Zeit wurde am Haupteingang der Agentur-Weihnachtsmann vom Werkschutz festgenommen.
Als Streikbrecher
Der Betrieb der Westberliner S-Bahn verursachte ihrem Eigentümer, der DDR-Reichsbahn, hohe Kosten. Devisen waren knapp, doch alle Gehälter der S-Bahn-Beschäftigen mussten monatlich in harter Währung ausgezahlt werden. Streckenstilllegungen und Entlassungslisten wurden vorbereitet. Die S-Bahnen sollten nur noch bis 21 Uhr fahren, der Wegfall von Nachtzulagen die Lohnkosten senken.
Plötzlich klingelten nachts bei SEW-Mitgliedern die Telefone. Wer früher bei der S-Bahn als Triebwagenführer gearbeitet hatte, sollte sich zur Verfügung halten, denn die Westberliner Reichsbahner streikten. In der Allerstraße bildeten wir eine schnelle Einsatzgruppe. Der Auftrag lautete: Betriebsbesetzungen verhindern, sozialistisches Volkseigentum schützen. Ausgerechnet an meinem 26. Geburtstag wurde ich mit sechs weiteren Genossen zum Bahnhof Zoo geschickt. Dort erhielten wir Uniformen und Gummiknüppel der Bahnpolizei. Diese Uniform zu tragen, hätte mich sonst stolz gemacht. Während der Studentenunruhen schützten Bahnpolizisten Demonstranten, indem sie die Westberliner Polizisten daran hinderten, Bahngelände zu betreten, auf das sich die Studenten geflüchtet hatten. Aber ein Einsatz gegen streikende Arbeiter?
Die Aktionen der Solidarnosc in Polen als konterrevolutionär zu verurteilen, das ging leicht über die Lippen. Aber selbst Streikbrecher zu sein? Was war daran konterrevolutionär, für den Erhalt des Arbeitsplatzes und gegen schlechtere Arbeitsbedingungen zu kämpfen?
Für solche Gedanken blieb keine Zeit. Uniformen anziehen und Kette bilden, ein Stellwerk sollte gestürmt werden. Als wir anrückten und die Streikenden uns sahen, lachten sie und verhöhnten uns. Wir trugen zwar Uniformen der Bahnpolizei, aber unsere Füße steckten in Turnschuhen oder Latschen, weil man vergessen hatte, uns mit Bahnpolizeischuhen auszustatten. Als falsche und damit keinerlei Respekt einflößende Polizisten boten uns die Streikenden Prügel an:
„Wir haun euch schneller aus den Klamotten raus, als ihr reingekommen seid!”
Wir traten den Rückzug an, ich war erleichtert. Die DDR-Reichsbahndirektion blieb hart, der Streik endete, viele S-Bahner kündigten selbst. Ein großer Teil fand neue Arbeitsplätze bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). 1984 übernahm der Westberliner Senat die S-Bahn.