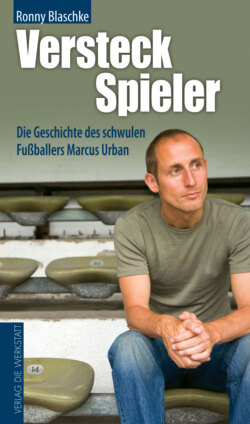Читать книгу Versteckspieler - Ronny Blaschke - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEXKURS:
Im Spiel der Aussätzigen
Der offene Rassismus wurde aus den Profiligen verdrängt. Fans flüchten sich in weniger tabuisierte Diskriminierungen – vor allem in Homophobie
Schicksalsspieler: Justin Fashanu im Trikot vom Norwich City. Er erhängte sich 1998.
Zwei Polizisten mussten Justin Soni Fashanu abführen. Er hatte sich geweigert, den Trainingsplatz zu verlassen. Brian Clough, der strenge Trainer von Nottingham Forrest, hatte den Stürmer 1982 rausgeschmissen. Er hatte erfahren, dass sich Fashanu in der Schwulenszene bewegte, obwohl er vorgegeben hatte, eine heterosexuelle Beziehung zu führen. Clough wollte die „verdammte Schwuchtel“, wie er es formulierte, nicht mehr in seiner Mannschaft haben. Das große Talent Fashanu, das bei Norwich City Ende der siebziger Jahre groß aufgespielt hatte, wurde zum Spottpreis weitergereicht. Er flüchtete in die USA, später nach Kanada, litt zudem unter einer Knieverletzung – doch von dieser Entlassung sollte sich der Sohn eines nigerianischen Anwalts nicht mehr erholen.
Justin Fashanu kehrte zurück nach England und wagte 1990 ein öffentliches Coming-out. Das Boulevardblatt The Sun bezahlte ihm dafür 80.000 Pfund, sein Bruder hatte ihm die gleiche Summe geboten, wenn er sich nicht bekennen würde. Fashanu verknüpfte sein Outing mit dem Schicksal eines schwulen Freundes, der sich umbrachte, weil dessen Eltern ihn verstoßen hatten. Nun wollte er ein Zeichen setzen, aber es ging weiter abwärts. Er tingelte durch Talkshows, trat einer Sekte bei und behauptete, dass auch Politiker aus dem Parlament zu seinen Liebhabern gezählt haben sollen. Im März 1998 beschuldigte ihn ein 17-jähriger Junge aus Maryland, USA, dass er ihn vergewaltigt habe. Beweise gab es nicht, doch die britische Presse fällte trotzdem ein vernichtendes Urteil.
Justin Fashanu hörte das Gerücht, dass er von der Polizei gesucht würde. Er zerbrach am öffentlichen Druck: am 2. Mai 1998 erhängte er sich in einer Garage in London, er wurde 37 Jahre alt. In einem Abschiedsbrief, den die BBC Monate später veröffentlichte, bekräftigte er noch einmal, dass der Junge bereitwillig Sex mit ihm gehabt haben soll: „Schwul und eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, ist hart“, schrieb er. „Ich fühlte, dass ich wegen meiner Homosexualität kein faires Verfahren bekommen würde.“ Das Verfahren wegen Vergewaltigung wurde eingestellt.
In der Geschichte des europäischen Spitzenfußballs ist Justin Fashanu bislang der einzige Profi gewesen, der sich zu seiner Homosexualität bekannte. Sein Beispiel hat vermutlich viele Spieler davon abgehalten, an die Öffentlichkeit zu gehen. Selbst Spieler, deren Laufbahn seit langem zu Ende ist, haben sich bislang nicht zu Wort gemeldet. Ist die Lage in anderen Sportarten ähnlich trostlos?
Jahrhundertsportlerin: Martina Navrátilová bei ihrem Wimbledon-Sieg 1984.
Martina Navrátilová, eine der besten Tennisspielerinnen der Geschichte, offenbarte sich als lesbisch. Ebenso wie ihre französische Kollegin Amélie Mauresmo, die deutsche Radfahrerin Judith Arndt oder die deutsche Fechterin Imke Duplitzer – alle drei sind noch aktiv. Bei den Männern outete sich der Kanadier Mark Tewksbury, ein ehemaliger Schwimmer, der seine größten Erfolge Ende der achtziger bis Anfang der neunziger Jahre feierte. Greg Louganis, mehrfacher Olympiasieger im Wasserspringen aus den USA, gestand 1994 sogar, dass er sich mit dem HI-Virus infiziert habe. Der prominenteste Teamsportler war wohl der amerikanische Basketballer John Amaechi. Vier Jahre nach seinem Karriereende in der nordamerikanischen Profiliga NBA brach er 2007 sein Schweigen.
Diese Beispiele deuten nicht automatisch darauf hin, dass in den genannten Sportarten ein toleranteres Klima herrscht als im Fußball. Es ist kaum möglich, Tennis, Radfahren oder Fechten mit Fußball zu vergleichen. Die Zuschauerzahlen sind geringer, die Publikumsstrukturen unterscheiden sich in Bildung, Zugehörigkeit und Leidensfähigkeit. Martina Navráti-lová, die allen Anfeindungen zum Trotz stets souverän blieb, war eine der Besten in ihrem Sport, einer Einzelsportart. Sie war allein für ihre Leistungen verantwortlich und konnte nicht über Sieg und Niederlage eines Teams entscheiden. Der Druck, der auf ihr lastete, war groß, aber er kam nicht von allen Seiten. Navrátilová wurde bewundert für ihr Auftreten, repräsentativ ist sie als Jahrhundertsportlerin jedoch nicht.
Es muss nicht verwundern, dass in den Randsportarten wenige Sportlerinnen und Sportler als homosexuell bekannt sind, die Medien interessieren sich kaum für sie. Und diejenigen, die kein Geheimnis aus ihrer Sexualität machen, wie die Fechterin Duplitzer, beklagen Nachteile in der Sponsorensuche. Der Spitzensport kann allgemein als konservatives Feld der Gesellschaft beschrieben werden, in dem neben gepflegten Traditionen kaum alternative Lebensformen geduldet werden. Im Fußball, dem einzigen „wahren“ Volkssport, zeigt sich diese Resistenz besonders deutlich. Von wegen Spiegelbild der Gesellschaft. In den deutschen Stadien sind noch immer relativ wenig Frauen, Immigranten und Homosexuelle zu Gast. So gleicht der Fußball eher einem Brennglas, in dem gesellschaftspolitische Probleme verschärft wahrgenommen werden. Das gilt auch für Homophobie.
Der Fußball gehört zu den letzten Spielwiesen für Männlichkeitsrituale, er ist getränkt mit Symbolen, die Klischees als maskulin einstufen: schöne Frauen, teurer Schmuck, große Autos. Er wird von Spielern und Journalisten als Kampfsport stilisiert, in dem Homosexuelle, denen oft feminine Eigenschaften zugeschrieben werden, keinen Platz haben. Schwulen wird unterstellt, zu weich zu sein, deshalb könnten sie nicht spielen.
„Der wichtigste Schiedsrichter auf der Welt“: John Blankenstein.
Darüber hinaus besitzt der Fußball – anders als die Einzelsportarten, anders als Politik, Kultur, Wirtschaft – eine hohe Körperlichkeit. „Es gibt wohl kaum eine gesellschaftliche Sphäre, in der so viel Körperlichkeit zwischen Männern erlaubt und erwünscht ist, ohne dass diese als Homosexualität interpretiert wird“, schreibt die Ethnologin Victoria Schwenzer in „Gender Kicks. Texte zu Fußball und Geschlecht“. Spieler reißen sich nach erzielten Toren die Trikots vom Leib, stürzen sich aufeinander, umarmen sich. Die Kulturwissenschaftlerin Tatjana Eggeling bezeichnete dieses Verhalten als eine mit „Ruppigkeit gepaarte Zärtlichkeit. Wenn sich die Spieler übereinander werfen, dann sieht das mehr aus wie eine Rauferei“. Ständig werden Kameradschaft, Zusammenhalt und Teamgeist gepredigt. An Sexualität denkt in diesen Momenten niemand, da Freude, Begehren und Lust an den anderen Körpern nicht gezeigt werden. Körpereinsatz und Körperdarstellung sind wichtige Elemente des Fußballs, doch sie werden von einer kumpelhaften, asexuellen Haltung geprägt.
Stadien und Spielfelder sind nicht schwulen- und lesbenfeindlicher als andere Bereiche der Gesellschaft. Regelmäßig lässt der Bielefelder Gewaltforscher Wilhelm Heitmeyer in einer repräsentativen Umfrage 3.000 Personen telefonisch befragen. Ihre Einstellungsmuster gegenüber Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie oder eben Homophobie werden in der Studie „Deutsche Zustände“ jährlich veröffentlicht. Laut dieser Studie hielten 21,8 Prozent der Befragten Homosexualität im Jahr 2006 für unmoralisch. Dieser Trend dringt auf den Tribünen durch Schmähgesänge deutlicher an die Oberfläche als im Arbeitsalltag oder daheim am Kaffeetisch, schließlich spielen Anonymität und Massen eine wichtige Rolle, wenn es um den Ausdruck von Frustrationen und Ressentiments geht. So war es auch in den achtziger und frühen neunziger Jahren gewesen, als Bundesligastadien als Bühnen für offenen Rassismus und Antisemitismus missbraucht wurden.
Rassistisch motivierte Gesänge sind in den vergangenen Jahren wirksam bekämpft worden. Sie sind aber nicht verschwunden, sondern nur verdrängt worden. Vereine müssen mit hohen Strafen rechnen, sobald ihre Fans beispielsweise gegen Farbige oder gegen Juden hetzen. Durch diese zunehmende Tabuisierung flüchten sich manche Anhänger in andere Diskriminierungsformen, die nicht so konsequent bestraft werden, vor allem in Homophobie. Bereits in Nachwuchsmannschaften gelten Begriffe wie „Schwuchtel“ oder „Warm-duscher“ als gewöhnliche Schimpfworte, die meist ohne Hintergedanken zur Abwertung des Gegners genutzt werden. In den Profiligen findet vermutlich kein Spiel ohne Homophobie statt, sei es als Einschüchterungsversuch der Spieler oder als Beleidigung der Fans.
Für schwule Spieler muss diese „Normalität“ unerträglich sein. Experten wie Tatjana Eggeling sagen, dass einige italienische Profis Models vorübergehend als Scheinehefrauen anheuern. Heinz Bonn, ehemaliger Spieler des Hamburger SV, hielt in den siebziger Jahren seine Homosexualität geheim, er wurde Alkoholiker und 1991 von einem Prostituierten ermordet.
Als erster Profischiedsrichter offenbarte sich John Blankenstein in den Achtzigern als schwul. Der Niederländer erhielt Morddrohungen und wurde von Kollegen ausgegrenzt. Der Weltverband FIFA verweigerte ihm eine Teilnahme an der WM 1990 in Italien. Die Begründung: Ein Funktionär hatte ihn in einem FIFA-Anzug in einer kanadischen Schwulenbar gesehen. Vor seinem Einsatz 1992 im Länderspiel Englands gegen Dänemark titelte die englische Boulevardzeitung Daily Mirror: „Der heutige Schiri ist schwul!“ Daneben standen „Verhaltenstipps für Spieler auf dem Rasen“.
John Blankenstein pfiff geduldig weiter und engagierte sich für die Gleichberechtigung von Homosexuellen. Er lachte, wenn ihm Funktionäre eine Prostituierte auf das Hotelzimmer schickten, um ihn „umzudrehen“. Am 25. August 2006 starb er an einem Nierenleiden. Das österreichische Fußballmagazin Ballesterer bezeichnete John Blankenstein als den wichtigsten Schiedsrichter der Welt.