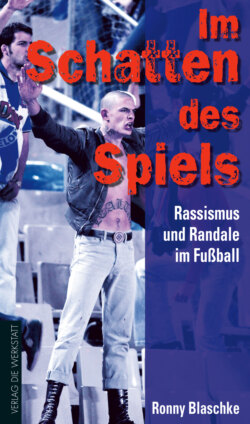Читать книгу Im Schatten des Spiels - Ronny Blaschke - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2Im Osten nichts Neues
In den Stadien der neuen Bundesländer haben sich dunkle Abenteuerspielplätze gebildet, doch die Gewalt ist kein reines Erbe der DDR
Rechts hinter seinem Schreibtisch liegen die Fotos immer griffbereit. Groß sind sie, wie Plakate, und gestochen scharf. Volkmar Köster lässt sich nicht lange bitten, er führt seinen rechten Zeigefinger diagonal über das Motiv. Eine voll besetzte Tribüne, vermummte Gestalten, grell flackernde Leuchtraketen. Köster, der 1999 den Posten des Geschäftsführers bei Dynamo Dresden übernahm, atmet tief durch. Die Geschichte, die er erzählen will, hat ihm schwer zu schaffen gemacht: Am 18. Februar 2005 spielt Dynamo im Karlsruher Wildparkstadion, in der 2. Liga. Die 67. Spielminute ist angebrochen, da klingelte hunderte Kilometer weiter, in einem Sportlerheim in der Oberlausitz, das Telefon. „Macht die Kiste an, jetzt knallt’s“, verkündete eine Stimme am anderen Ende. Sekunden später knallte es tatsächlich. Raketen flogen aus dem Dynamo-Fanblock in die Kurve der Karlsruher und auf den Rasen. Ein Spiel wurde lebensgefährlich. Anschließend wollten Dresdner Randalierer den gegnerischen Block stürmen. Mit Mühe brachte die Polizei die Situation unter Kontrolle. Schiedsrichter Fleischer musste die Begegnung für zehn Minuten unterbrechen. Die Spieler kamen mit einem Schock davon.
Volkmar Köster redet sich in Rage, wenn er an diesen schwarzen Freitag zurückdenkt. „Das war geplant, man konnte die Uhr danach stellen. Diese Geistesgestörten müsste man in den Steinbruch schicken.“ Köster hat aus dem einstigen Chaosklub Dynamo wieder ein seriöses Unternehmen gemacht, das hat ihn viel Kraft gekostet. Er musste Schulden senken, den Gerichtsvollzieher zufriedenstellen und Strukturen schaffen. Damit hatte er sich arrangiert, irgendwie. Aber mit der Gewalt konnte er nicht rechnen. Die Vorfälle in Karlsruhe reihten sich ein in eine lange Liste. Dynamo, der achtmalige DDR-Meister, dekoriert mit 98 Europapokalspielen, lenkt die Aufmerksamkeit immer wieder auf den Osten der Republik. „In Dresden hat der Ausnahmezustand Tradition“, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung. 150 bis 200 Gewalt suchende Fans, von der Polizei wegen ihrer Radikalität als „Kategorie C“ geführt, soll es im Umfeld von Dynamo geben. Hinzu kommen hunderte Mitläufer. Bundesweit lösen ihre Auswärtsreisen die höchste Sicherheitsstufe aus.
So auch am 27. Oktober 2006. Während des Regionalligaspiels gegen die Amateure von Hertha BSC kam es im Berliner Jahn-Sportpark zu schweren Ausschreitungen. Dresdner schmissen Gaskartuschen, zerlegten Bierstände und schwangen die erbeuteten Stangen und Rohre gegen Polizisten. Diese wiederum setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein. 23 Beamte wurden verletzt. Wieder schaute die Öffentlichkeit auf Dresden. Die Telefone in der Geschäftsstelle standen nicht mehr still. Kamerateams reisten nach Sachsen. Auf der Suche nach hässlichen Bildern. Theo Zwanziger, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), drohte mit Punktabzügen und Zwangsabstieg. Der Druck auf die Klubführung wuchs. Erst recht, nachdem der Vorwurf laut wurde, dass Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer, Olaf Schäfer, selbst als Hooligan aktiv gewesen sein soll. Der DFB aber drückte ein Auge zu und verhängte wegen der Randale nur eine Strafe von 15.000 Euro.
Doch nicht nur Dresdner Fans kultivieren den tot geglaubten Hooliganismus. Auch im Schatten anderer Traditionsklubs der ehemaligen DDR-Oberliga haben sich Enklaven gebildet, in denen Minderheiten durch Gewalt und Rassismus die friedliche Mehrheit in Misskredit bringen. In Deutschland stammen laut Polizei mehr als die Hälfe aller Gewalt suchenden und gewaltbereiten Fußballfans, also zwischen 5.000 und 6.000, aus den neuen Ländern. Natürlich werden auch im Westen, Norden und Süden Krawalle gemeldet – aber nicht in diesem Maße. „Das macht uns sehr nachdenklich“, sagt Hans-Georg Moldenhauer aus Magdeburg. Er ist Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) und Vizepräsident des DFB: „Dieses Phänomen ist historisch gewachsen.“
Ein Blick in die Vereinschronik von Dynamo Dresden gibt Aufschluss. Als Sportvereinigung der Volkspolizei wurde der Klub 1948 gegründet. Beim Gewinn der Meisterschaft 1953 war aus VP Dresden bereits die SG Dynamo geworden. Diese wurde Hals über Kopf nach Ost-Berlin verpflanzt. Der BFC Dynamo war geboren, und Dresden hatte über Nacht keine Erstligamannschaft mehr. 1962 hatte sich Dynamo berappelt, der Wiederaufstieg in die erste Klasse glückte. Das Team etablierte sich als stärkster Gegner seines einstigen Ablegers BFC Dynamo.
Erich Mielke, Chef des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), betrachtete den BFC als sein persönliches Spielzeug. Er duldete keine aufmüpfige Konkurrenz, ließ Dresdner Spieler wegen angeblicher Fluchtpläne verhaften und lebenslang sperren. Dynamo war geschwächt. Doch damit nicht genug. Hanns Leske dokumentiert in seinem Buch „Erich Mielke, die Stasi und das runde Leder“, dass viele Talente zum BFC delegiert wurden und dass einige der zehn in Serie gewonnenen Meisterschaften von 1979 bis 1988 durch den Einfluss von korrupten Schiedsrichtern zustande kamen. Der BFC Dynamo illustrierte den Zentralismus und die sportliche Planwirtschaft am besten. Er wurde zu einem Symbol für die schlechten Seiten der DDR.
Sorgen der Staatsmacht: Stasi-Chef Mielke dokumentiert seine Furcht vor ungezügelten Fanmassen.
Die gegnerischen Fans wollten sich das nicht gefallen lassen. Schon in den 1970er und 1980er Jahren wurde der Fußball im Osten als Plattform für Gewalt genutzt. Penibel hatte das MfS darüber Buch geführt. Jeder Fanklub wurde gelistet, jeder Faustschlag, jede abfällige Geste. Im Stasi-Sprachgebrauch war von „Rowdytum“ die Rede, von „öffentlicher Herabwürdigung“ oder dem „Widerstand gegen staatliche Maßnahmen“. Stasi-Chef Mielke fasste seine Sorge in einem Brief an Manfred Ewald, den Präsidenten des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB), einmal so zusammen: „Die Handlungen sportfeindlicher und krimineller Elemente stören nicht nur die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sie schaden in erheblichem Maße der politischen Entwicklung und dem Ansehen der sozialistischen Sportbewegung in der Deutschen Demokratischen Republik.“
Mielke hatte aufrührerische Massen gefürchtet, die das Stadion als Bühne für politische Proteste hätten nutzen können. In den Stadien hatte er weniger Macht als anderswo. Die Polizei ging deshalb hart und kompromisslos gegen Gewalttäter vor. In dem Buch „Schwarzer Hals, gelbe Zähne“ von Veit Pätzug schildert ein Dynamo-Fan einen unfreiwilligen Besuch in einem Berliner Gefängnis aus dem Jahr 1984: „Dann ging es zu Einzelverhören, alles ausziehen, da wurde denen in jede Ritze geguckt. Dort ist dann ein Mädel durchgedreht und hat rumgeschrien, die Bullen haben die vor Ort zusammengetreten.“ Zu Auswärtsspielen im Europapokal waren ganze Waggons für Stasi-Mitarbeiter reserviert. In der Saison 1984/85 sicherten rund 5.500 Sicherheitskräfte pro Spieltag die Stadien der DDR. An die Öffentlichkeit gelangte wenig, der Staat hatte die Medien im Griff. Sie fälschten die Zahl der Festnahmen und verharmlosten die Randale. Die Feindbilder Polizei und Politik wuchsen.
Ebenso wie die Rivalitäten zwischen den Klubs: Die besten Spieler wurden wie Schachfiguren verschoben. In Leipzig landeten sie bei Lokomotive, der Stadtrivale BSG Chemie, heute FC Sachsen, ging leer aus. In Thüringen freute sich Carl Zeiss Jena, der Zorn beim Konkurrenten Rot-Weiß Erfurt schwoll an. Mit der sportlichen Dominanz des BFC Dynamo schwand indes das Interesse in Ost-Berlin, die Zuschauerzahlen sanken. Es brach eine Zeit an, in der sich die wenigen hart gesottenen BFC-Fans solidarisierten – und radikalisierten. Viele sonnten sich in der Nische der Ungewollten. Als ihre Feinde bezeichneten sie die Wendehälse. Sie sprachen von Spießern, die zum Parteitag die DDR-Flagge schwenkten, aber im Stadion der Staatsmacht den Finger zeigten. Beim BFC wusste jeder wegen der Nähe zur Stasi, dass es sich um keine Widerstandskämpfer handeln konnte. Noch heute prangt das Leitmotiv bei den Spielen auf einem großen Plakat: „Euer Hass macht uns stark.“
Am 12. Mai 1984 griffen BFC-Fans in einem Zug „26 kubanische Werktätige an“, wie es das MfS vermerkte. Sie riefen „Kanaken raus!“ und „Juden raus“. Im November 1989 überfielen Berliner in Jena eine Tankstelle, sie plünderten und lieferten sich Kämpfe mit der Polizei. Später griffen jugendliche BFC-Fans ein Asylbewerberheim in Greifswald an. Auch am 3. November 1990, beim Spiel gegen Sachsen Leipzig, kam es zu schweren Krawallen. Die Polizisten waren überfordert, zogen ihre Waffen – und erschossen den 18 Jahre alten BFC-Fan Mike Polley. Es war der schockierende Prolog einer traurigen Zeit. Das geplante Vereinungsländerspiel zwischen BRD und DDR wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. „Kampfansage im Osten“, titelte der Stern damals.
Anfang der 1990er Jahre war die Polizei überfordert, sie schwebte in aufgelösten Strukturen und kannte ihre Grenzen nicht. Auch Hooligans aus dem Westen tauchten nun in den rechtsfreien Raum ein und nutzten die ostdeutschen Stadien als Spielwiese. Am 20. März 1991 fand die Gewaltarie eine Fortsetzung: Beim Viertelfinal-Rückspiel im Europapokal der Landesmeister zwischen Dynamo Dresden und Roter Stern Belgrad randalierten hunderte Dresdner Fans. Sie wollten sich für das rabiate Vorgehen der Belgrader Polizei während des Hinspiels rächen. Dynamos letztes Europacupspiel endete im Fiasko. Vor laufenden Fernsehkameras fuhren Wasserwerfer ins Rudolf-Harbig-Stadion ein – die Partie musste abgebrochen werden. Der Vorfall löste eine ungekannte Sicherheitsdebatte aus.
Prolog einer traurigen Zeit: Der Tod des Berliner Fans Mike Polley am 3. November 1990 brennt sich tief ein in die Geschichte des deutschen Fußballs.
Doch die Gewalt im ostdeutschen Fußball ist kein reines Erbe der DDR. Die Vereine waren dem neuen Deutschland nicht gewachsen. Die Verantwortlichen stürzten sich Hals über Kopf in den Kapitalismus, gewaltbereite Fans waren ihnen egal. Sie hofften auf das schnelle Geld – und sie bekamen es. Die besten Spieler wurden verscherbelt, die Einnahmen landeten auf dubiosen Konten. Funktionäre gaben sich die Klinke in die Hand, Spieler drohten mit Streik, Gehälter wurden verspätet oder gar nicht gezahlt. Das Chaos entwickelte sich zur Tradition.
Wie Zirkusartisten auf dem Hochseil balancierten die Vereinsmanager am Abgrund entlang. Sportlich stürzte der BFC Dynamo bis in die fünftklassige Verbandsliga. Dynamo Dresden landete zeitweilig in der Oberliga, und Lokomotive Leipzig gründete sich in der 11. Liga neu. Der 1. FC Magdeburg, Europapokalsieger der Pokalsieger 1974, ist sportlich nie abgestiegen. Trotzdem fand er sich 2002 in der 4. Liga wieder. Er war Opfer von Reformen, Zwangsabstieg und Zusammenlegungen von Spielklassen geworden. Viele Fans haben das nicht verkraftet. Sie wurden vom Gefühl der ewigen Benachteilung geplagt. So bildeten sich im Schatten des Niedergangs düstere Abenteuerspielplätze.
Am schlimmsten traf es den BFC Dynamo. Er wird mittlerweile als klaffende Wunde des deutschen Fußballs beschrieben. Für viele Ostdeutsche ist der BFC ein Relikt vergangener Zeiten, mit dessen Hilfe sich der Frust über das alte System konservieren lässt. Hier kann jeder seine persönliche Rache an der Geschichte nehmen. „Die Last der Vergangenheit tragen wir noch immer“, sagt Mario Weinkauf, der 2004 zum Präsidenten des BFC gewählt wurde. Weinkauf sitzt auf einer grauen Couch in der brüchigen Geschäftsstelle in Hohenschönhausen, im Osten von Berlin gelegen. Er streicht sich über seine Krawatte und blickt gedankenverloren zu Boden. Als Boss des DDR-Rekordmeisters muss er viel zurückschauen, um ein bisschen nach vorn blicken zu dürfen.
Weinkauf badet die Fehler seiner Vorgänger aus. Das Image des verhassten Störenfrieds wurde von vielen Anhängern kultiviert. Die meisten bekannten sich zur rechtsradikalen Szene. Verlierer der Wiedervereinigung, vor allem Jugendliche, die ihre Perspektive verloren hatten, suchten sich ein Ventil für ihren Frust. Sie schwammen in der Masse und verloren sich im Wandel der Zeit. Gegen Stadionverbote und Verhaftungen waren sie immun. Manche behaupteten, im Gefängnis würde es ihnen besser ergehen. In einer Studie des Fanforschers Gunter A. Pilz von der Universität Hannover 2006 bejahten 28 Prozent der ostdeutschen Fans die Frage, ob sie manchmal „Bock auf Zoff“ hätten, im Westen waren es 10,8 (s. S. 92). Figuren mit zweifelhafter Vergangenheit übernahmen beim BFC wichtige Positionen. Der Fanbeauftragte Rainer Lüdtke ist ein ehemaliger Hooligan, und auch Peter Meyer, Sponsor und Vorstandsmitglied, wurde 2004 wegen eines Platzsturms in Babelsberg angeklagt. Andere Mitglieder unterstützten den Klub finanziell, wo das Geld genau herkam, war den meisten in der Chefetage egal.
Es folgten Ausschreitungen und rassistische Äußerungen, Flaggen mit Hakenkreuzen und Reichskriegssymbolen. Einmal sprengte die Polizei eine Party, es wurde der „Tag der Germanen“ gefeiert. Die Vermarktungsrechte des Vereinswappens sicherten sich Mitglieder der „Hell’s Angels“. Die Rockerbande ist in Berlin zwar nicht verboten, wird aber von der Polizei mit Straftaten wie Zuhälterei, Drogenhandel und Anstiftung zum Mord in Verbindung gebracht.
Mario Weinkauf, hauptberuflich als Regionalleiter eines Telekommunikations-Unternehmens tätig, wird oft als Chef der Nazi-Kolonne beschimpft, seinen Kindern geht es nicht anders. In seiner Firma gerät er in Erklärungsnot, die Kollegen fragen: Warum tust du dir das an? Einmal kam ein Fremder auf ihn zu und bot ihm 50.000 Euro an. Seine Bedingung: Mario Weinkauf müsse den BFC sterben lassen. „Ich habe oft an Rücktritt gedacht. Auf die Dauer ist das nicht durchzustehen.“ Er wollte den BFC wieder gesellschaftsfähig machen und ihn von seinen finsteren Gönnern befreien. Gleichzeitig schloss er mehrfach die Augen und nahm das „Spendengeld“ an. Blieb ihm etwas anderes übrig? Kein anderer Verein hat mit diesem Paradoxon zu kämpfen: Jene Anhänger, die dem BFC mit ihrer politischen Gesinnung und ihrer Vorliebe für Gewalt am meisten schaden, haben ihn mit Spenden am Leben erhalten.
Düstere Ostalgie: Das Berliner Derby zwischen dem BFC und dem 1. FC Union muss im Mai 2006 nach einem Platzsturm abgebrochen werden.
So war es auch im Mai 2006. Im Heimspiel gegen den verhassten Stadtrivalen 1. FC Union stürmten Anhänger des BFC das Spielfeld des Sportforums in Hohenschönhausen. Die Partie musste abgebrochen werden. Wieder einmal hatten sich Krawalltouristen aus dem ganzen Land bei einem der brisanten Ostderbys versammelt. Selbst die szenekundigsten Fanbetreuer und Polizisten sind in Momenten wie diesen hilflos. Schon vor dem Hinspiel 2005 war der BFC in die Schlagzeilen geraten. Die Polizei hatte bei einer Razzia in der Diskothek Jeton, im Berliner Friedrichshain, Dutzende BFC-Fans festgenommen. Zu Unrecht, wie viele später behaupteten. Nach den Vorfällen zogen sich wichtige Sponsoren zurück. Der BFC stand wieder einmal am Rande des Ruins.
Ob es einen Ausweg aus diesem Dilemma gibt? „Wenn der BFC sich noch deutlicher von den Problemfans abwenden würde, kämen zwei Drittel weniger Zuschauer“, vermutet Ralf Busch, der Leiter des Berliner Fanprojekts. Er und seine Kollegen haben kaum eine Chance, sozialpräventiv auf die Problemfans einzuwirken. Der Altersdurchschnitt ist mit ca. 30 Jahren ungewöhnlich hoch, schon bei der ersten Kontaktaufnahme würden die meisten abblocken. Erschwerend kommt hinzu, dass das 1992 verabschiedete „Nationale Konzept Sport und Sicherheit“ (NKSS, s. S. 56), in dem die Richtlinien für sozialpädagogische Fanprojekte festgeschrieben worden sind, nur in den oberen Ligen greift. Viele ostdeutsche Traditionsklubs wie der BFC sind längst in der Bedeutungslosigkeit verschwunden.
In ihren veralteten Stadien, in denen nicht jeder Winkel von modernen Kameras ausgeleuchtet werden kann, ist die Kontrolle begrenzt möglich. Manche Randalierer wünschen sich sogar, dass ihre Teams möglichst lange am Bodensatz des deutschen Fußballs verharren. Dort können sie weitgehend unbemerkt ihre Wut ausleben. Oft sind es dieselben Fans, die bei Auswärtsspielen der deutschen Nationalmannschaft in Osteuropa für Krawall sorgen, in Zabrze, Celje oder Bratislava. Sie lassen sich von der polnischen „Ekstraklasa“ inspirieren. Gewaltexzesse finden dort regelmäßig statt. Die Fans von Dynamo Dresden pflegen ihre Freundschaft zu Anhängern von GKS Kattowitz. Auch auf blutigen Exkursionen. Im November 2005 schlugen sich 100 Hooligans aus Polen und Deutschland, vornehmlich aus dem Osten, in einem Waldstück bei Frankfurt/Oder.
„Es wird Jahrzehnte dauern, bis dieser Kreislauf durchbrochen sein wird“, glaubt Torsten Rudolph. Der Leiter des Fanprojekts von Dynamo Dresden bittet zum Rundgang durch die Räumlichkeiten in der Löbtauer Straße. Auf 200 Quadratmetern dürfen sich die Fans ausbreiten, sie haben das Haus nach ihren Vorstellungen eingerichtet. An den Wänden prangen schrille Graffitis und eine große Zeichnung des Rudolf-Harbig-Stadions. In der oberen Etage gehen drei Sozialarbeiter ihren Aufgaben nach. Torsten Rudolph weiß, dass er einem vergleichsweise gut ausgestatteten Projekt vorsteht.
Bevor er 2002 den Posten übernahm, beschränkte sich die Projektarbeit auf Service-Elemente, auf die Organisation der Auswärtsfahrten oder den Verkauf von Fanartikeln. Dynamos überarbeitete Vereinschefs hatten an allen Seiten Löcher zu stopfen, für pädagogische Betreuung von Jugendlichen fehlte Geld und Interesse. Sie standen sich selbst im Weg. Permanent forderten sie ein strengeres Durchgreifen der Polizei, an Prävention dachten sie nicht. „Wer Wind sät, muss Sturm ernten“, hatte auch Dieter Krein gefordert, bis Mai 2005 war er Präsident von Energie Cottbus. Seine schnelle Inhaftierungen aus. Dieser kurzsichtige Kurs sollte sich am 1. September 2002 durch die heftigsten Krawalle seit Jahren ändern.
Fanarbeiter mit Erfahrung:Torsten Rudolph aus Dresen
Im Rudolf-Harbig-Stadion traf Dynamo im Stadtderby auf den Dresdner SC. Bereits vor der Partie wollten 150 Hooligans aus dem Dynamo-Umfeld den Haupteingang stürmen. Die Polizei war überfordert. Die meisten Hundertschaften der sächsischen Bereitschaftspolizei waren an diesem Tag in Leipzig, um eine politische Veranstaltung zu sichern. Die Wasserwerfer befanden sich in Pirna, um die Spuren des Jahrhunderthochwassers zu beseitigen. In der Halbzeitpause griffen 60 Hooligans Sicherheitsordner an, auch Frauen. Nach dem Spiel eskalierte die Lage endgültig. Ein aufgebrachter Mob, mehr als 1.500 Dynamo-Fans, stürzten sich mit hasserfüllten Blicken auf etwa 120 Polizisten.
Viele hielten Knüppel in ihren Händen oder warfen mit Steinen. Die wenigen Fans des DSC hatten längst das Weite gesucht. Ein Bombardement von Eisenstangen, Flaschen, Steinen und Verkehrsschildern ging auf die Polizisten nieder. „Wir haben um unser Leben gekämpft“, schildert der szenekundige Beamte Stefan Krahl. 43 Polizisten wurden verletzt, drei schwer. Dass keiner von ihnen seine Waffe zog, wurde als Wunder bezeichnet. Die Lokalzeitungen druckten darauf Fotos der Schläger ab. Tage später richtete die Polizeidirektion Dresden die „Sonderkommission Randale“ ein, und auch der Druck auf Dynamo wuchs. Der Verein hatte seine Fanarbeit lange genug vernachlässigt.
Allmählich wuchs das Bewusstsein für Prävention, das in Dortmund, Bochum oder Hamburg bereits mehr als ein Jahrzehnt zuvor stark ausgeprägt war. Die Politik sah das anders. Das Innenministerium Sachsen verweigerte bis 2005 die Unterstützung an der etablierten „Drittelfinanzierung“. Demnach würde der DFB für Fanprojekte in den ersten drei Ligen einen fünfstelligen Betrag zahlen, wenn die Kommune und das Land jeweils den gleichen Beitrag leisten. Sachsen hielt sich als eines der wenigen Bundesländer nicht daran. „Gegen Versäumnisse wie jahrelange unprofessionelle Fan-Betreuung ist der Staat machtlos“, kommentierte Thomas de Maizière, Sachsens Innenminister bis 2005, lapidar.
Unter dieser Ignoranz und Sorglosigkeit hatte nicht nur Dynamo zu leiden, sondern auch der FC Erzgebirge Aue, der Chemnitzer FC oder der FSV Zwickau. Die Fanprojekte wurden künstlich am Leben gehalten, sie wurden geduldet, nicht gefördert. In Leipzig muss sich heute ein Sozialarbeiter um die rivalisierenden Fangruppen des FC Sachsen und des 1. FC Lokomotive kümmern – eine nahezu unmögliche Mission. Sogar DFB-Präsident Zwanziger warb im Dresdner Parlament für mehr Verständnis. Das Innenministerium lenkte im Februar 2007 endlich ein, nicht aus Sorge, sondern weil der öffentliche Druck zu groß geworden war. Auslöser war das Landespokalspiel zwischen dem Bezirksligisten Lok Leipzig und der zweiten Mannschaft des FC Erzgebirge Aue gewesen.
800 Gewaltbereite hatten sich nach der Partie in der Nähe des baufälligen Bruno-Plache-Stadions auf 300 Polizisten gestürzt. 39 Beamte wurden verletzt. Ein Beobachter der Szene berichtet von Alt-Hooligans, die seit Jahren nicht mehr bei Lok gesichtet worden waren. Schon während des Spiels sollen diese nach jugendlichen Gleichgesinnten gesucht haben. Zudem wurden sie von den Leuchtraketen der normalerweise friedlichen Fans aus Aue überrascht. Gewöhnlich treffen die Leipziger Fanscharen auf Dorfvereine, deren Gefolgschaften kaum Gegenwehr leisten. Als dann das Spiel nach strittigen Schiedsrichterentscheidungen 0:3 verloren wurde und das Stadtderby gegen den FC Sachsen in der nächsten Pokalrunde platzte, entstanden Eigendynamik und Solidarisierungseffekte, die es in Deutschland selten gegeben hat – aber geben kann.
Offensive der Medien: Dresdner Zeitungen veröffentlichen Fahndungsfotos der Schläger.
Der Sächsische Fußball-Verband sagte für das folgende Wochenende mehr als 60 Amateurspiele ab. Ein Zeichen gegen die Gewalt. Nicht mehr und nicht weniger. Der Traditionsklub Lokomotive aber stürzte in eine Existenz bedrohende Krise. „Was können wir schon gegen die Schläger machen?“, fragt Frank Müller, der ehrenamtlich tätige Aufsichtsratschef von Lokomotive Leipzig. „Wir sind doch keine Pädagogen, keine Psychologen, wir sind ganz normale Menschen.“ Doch Lok hatte sich selbst einiges zu Schulden kommen lassen. Lange hatte Klubchef Steffen Kubald, ein ehemaliger Hooligan, sich von den Schlägern nicht energisch genug distanziert. Auch die Sicherheitsordner erweckten wenig Vertrauen. Von einem Fanprojekt ganz zu schweigen. „Das aber ist Vergangenheit“, sagt Steffen Kubald. Kühner Traum oder Realität?
Dynamo bildet inzwischen eine positive Ausnahme in Sachen Fanarbeit, ein sechsstelliger Etat steht dem Projekt selbst in der Regionalliga zur Verfügung. Torsten Rudolph und seine Kollegen richten sich vor allem an die 12- bis 16-Jährigen. Viele Fans kommen aus den Dresdner Plattenbauvierteln oder aus dem Umland, wo Neonazis gern ihre Demonstrationen veranstalten. Fast zwei Drittel der Zuschauer kommen nicht aus Dresden. Die Sozialarbeiter gehen in die Schulen und bieten ein Anti-Aggressions-Training an.
Ältere Fans sind kaum noch zu erreichen, ihre Distanz zu Sozialarbeitern ist meist größer als bei den Anhängern in den alten Bundesländern. „Viele wollen sich nichts sagen lassen. Sie glauben, dass der Fußball für uns nur ein Job ist“, erläutert Projektleiter Torsten Rudolph. „Aber das ist falsch, wir wollen auf keinen Fall wie Oberlehrer wirken. Wir müssen so früh wie möglich mit der Aufklärung beginnen.“ Doch es geht auch auf die harte Tour: 274 Stadionverbote hatte der Verein bis zum 1. November 2006 ausgesprochen, das ist bundesweit Rekord. Die Hardliner pflegen den Mythos der gefährlichsten Fangruppe. Ähnlich ist es beim BFC Dynamo. Sie lieben es, gehasst zu werden.
Und ein großer Teil der Medien nimmt das dankbar auf. Ein Berliner Boulevardjournalist soll einmal gesagt haben, er würde dem BFC nur Platz in seiner Zeitung einräumen, wenn die Schlagworte Hooligans und Stasi im Artikel vorkämen. Ein anderer soll erwähnt haben, er dürfe nur über den BFC schreiben, wenn sich sein Ressortleiter im Urlaub befinde. Von der guten Nachwuchsarbeit und dem Engagement Weinkaufs schreibt niemand. Obwohl auch die meisten Spiele der Dresdner heutzutage ohne gewaltsame Vorfälle über die Bühne gehen, wird jede Partie als brisant eingestuft und mit martialischem Vokabular vor- und nachbereitet. Ein Radiosender aus Sachsen-Anhalt forderte seine Hörer einmal auf: „Bitte stellen Sie ihre Mülltonnen in die Häuser, laufen Sie nicht mit Fanschal in die Innenstadt. Die Anhänger von Dynamo Dresden kommen.“ Nach dem Spiel Dynamos bei 1860 München im September 2005 wurde von schlimmen Ausschreitungen an einer Autobahnraststätte berichtet. Tatsächlich war die Situation vergleichsweise harmlos.
Ähnlich verhielt es sich ein halbes Jahr später. Im Anschluss an das Zweitliga-Spiel in Braunschweig verfasste eine Agentur spät am Abend eine Meldung, dass 1.500 Dynamo-Fans in Braunschweig randalieren würden. In Wahrheit war nichts passiert, die Agentur entschuldigte sich kurz darauf. „Wir werden im Westen als Menschen fressende Bande bezeichnet, die wütet wie die Vandalen“, wundert sich ein Dynamo-Ultra. Das stärkt die Abneigung gegenüber den Klubs aus den alten Bundesländern. Im September 2006 im Pokalspiel gegen Hannover 96 entrollten Dynamo-Fans im Rudolf-Harbig-Stadion ein meterlanges Banner: „Wessischweine brauchen heutzutage schnelle Beine.“
Im Internetforum von Dynamo formulierte ein Teilnehmer mit dem Namen „Pilotendidi“ seine allgemeine Abneigung gegen die Kritiker so: „Warum haun wir denen nicht mal ordentlich eins auf die Fresse? Wir sind doch in der Mehrzahl, verdammt noch mal!! Nur das kann und muss die Lösung sein. Hier wird gelabert, gelabert, gelabert, zum Ergebnis kommt keiner. In diesem speziellen Fall, bin ich für Gewalt, tut mir leid.“ Es wird heftig und kontrovers diskutiert unter den Fans. Die meisten fühlen sich seit Jahren vorverurteilt. Von der Polizei, von Vereinen und von den Medien. Hans-Georg Moldenhauer, Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes, hat dafür kaum Verständnis: „Ich dachte, das wächst sich irgendwann aus. Aber diese Aversionen werden über Generationen vererbt.“
Meistens werden die Schlagzeilen über Gewalttaten im ostdeutschen Fußball geschrieben. Es war ein dumpfes Geräusch, das die Branche in Aufruhr versetzte. Am 1. April 2005 flog ein Feuerwerkskörper, Fabrikat „Horror-Knall“, aus einem nahe gelegenen Waldgebiet in den Innenraum des Auer Erzgebirgsstadions. Petrik Sander, der Trainer des FC Energie Cottbus, zu jenem Zeitpunkt in der 2. Liga beheimatet, stürzte an der Seitenlinie des Spielfeldes zu Boden. Wenige Meter neben ihm war der Böller explodiert. Sander hielt sich die Hände vor das schmerzverzerrte Gesicht. Er rollte sich hin und her – wie ein Spieler, der gerade durch eine brutale Grätsche gestoppt wurde.
In anderer Form artikulierte sich Gewalt im Februar 2006 auf dem Bahnhof in Stendal. Fans des FC Hansa Rostock, die sich auf dem Weg nach Braunschweig befanden, hörten von der kurzfristigen Absage der Begegnung, bewarfen Polizisten anschließend mit Steinen und zündeten deren Autos an. Sieben Monate später zwangen randalierende Fans des FSV Zwickau ihren Präsidenten zum Rücktritt. Knallkörper und Leuchtraketen landeten auf dem Spielfeld und auf den Tribünen. Unter Tränen verabschiedete sich Klubchef Volker Seifert: „Ich kann es nicht fassen, dass man von den eigenen Fans abgeschossen wird. So etwas kann ich nicht mittragen.“
Auch die Fremdenfeindlichkeit wird in Ostdeutschland offener ausgelebt. Das belegen nicht nur die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen 2004 und Mecklenburg-Vorpommern 2006, wo die rechtsextreme NPD jeweils ins Parlament eingezogen ist, auch die Stadien dienen in diesem Fall als Seismograf für Rassismus: Gerald Asamoah, Spieler des FC Schalke 04 und Stürmer der deutschen Nationalmannschaft, wurde des Öfteren im Osten beschimpft, zum letzten Mal beim Pokalspiel im Rostocker Ostseestadion im September 2006. Dem Nigerianer Adebowale Ogungbure erging es schlimmer. Im Trikot des Oberligisten FC Sachsen Leipzig wurde er von Fans des Halleschen FC erst beleidigt und dann am Rande des Spielfeldes tätlich angegriffen. „Diese Leute haben ihren Frust an mir ausgelassen“, sagt Ogungbure. Dunkles Deutschland.
Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Gewalt im ostdeutschen Fußball bald verflüchtigen wird. Die wachsenden Probleme in der Gesellschaft und die ungenügende Betreuung der Fans geben Grund zur Sorge, dass sich die Probleme nicht nur in Dresden und Berlin manifestieren werden. Der DFB, die Vereine und die Innenministerien haben die undankbare Aufgabe, einen Ausweg zu finden. Sie haben nicht die Macht, aus soziokulturellen Problemzonen blühende Landschaften zu machen – und damit den Frust der Nach-Wende-Verlierer zu bändigen. Die Lösung liegt vielmehr zwischen weitsichtiger Prävention und überlegter Repression. Diese Entwicklung geht allmählich voran. „Auch die Polizei hat einen Lernprozess durchgemacht“, gibt Berndt Fleischer von der Polizei Cottbus zu. Das Verantwortungsbewusstsein ist gewachsen – es hat lange gedauert.
Das gibt auch Volkmar Köster in Dresden zu. Dynamos langjähriger Geschäftsführer sagt, dass er sich für die Probleme der Fans interessiere. Er versucht Türen zu öffnen: „Die Kommunikation ist besser geworden. Wir müssen zusammenarbeiten, ohne dass wir gleich heiraten.“ Er sei sich nicht sicher, ob das der richtige Weg sei. Doch die Fans sind der eigentliche Hauptsponsor des Klubs. Sie haben ihn mit Spenden am Leben erhalten, selbst in der 3. Liga kommen im Schnitt 15.000. Das Zusammenspiel funktionierte eine Zeitlang, doch immer wieder gibt es beängstigende Unterbrechungen. Am 25. Februar 2007, einen Tag nach dem 0:1 Dresdens gegen den VfL Osnabrück, bedrohten rund 50 vermummte Fans ihre eigenen Spieler. Sie warfen Knallkörper und forderten bessere Leistungen. Dynamos Stürmer Marco Vorbeck reagierte geschockt: „Das habe ich noch nie erlebt. Man überlegt schon, ob man nicht besser aufhören sollte, hier zu spielen, weil es ja nicht Sinn der Sache ist, Angst um sein Leben zu haben.“ Der Vorfall illustrierte abermals die Macht der Fans in Dresden. Auch Köster geriet in Bedrängnis, da er die Anhänger mit Äußerungen angeblich dazu animiert haben sollte. Prompt forderten Landespolitiker seinen Rücktritt.
Kämpfer gegen Chaos: Dynamo-Geschäftsführer Volkmar Köster
Volkmar Köster kennt sich aus mit chaotischen Zuständen. Jahrelang hat er für den Bau eines neuen Stadions gekämpft. Das alte Harbig-Stadion ist eine Ruine. Die Tartanbahn wird bei Regen zu einer Schlammgrube. Regelmäßig verwandelt es sich in einen Sicherheitstrakt. Fast 2.000 Polizisten sicherten im November 2006 das Heimspiel gegen Union Berlin. Von den Kosten hätte das Fanprojekt zehn Jahre überleben können. „Diesen Aufwand können wir uns in der 3. Liga nicht immer leisten“, sagt Uwe Göbel, damals Einsatzleiter der Dresdner Polizei. Mit einem neuen Stadion würde vieles sicherer werden.
Noch einmal führt Volkmar Köster seinen rechten Zeigefinger über die großen Fotos mit den vermummten Gestalten und den flackernden Leuchtraketen im Karlsruher Wildparkstadion. Er kennt sich aus mit Jugendarbeit, er war früher Lehrer. „So lange sie den Bogen nicht wieder überspannen, hat der Verein keinerlei Probleme.“ Falls doch, wird es Geisterspiele und Punktabzüge für Dynamo geben. Der Klub will sich die Strafgelder künftig per Zivilklage von den Randalierern zurückholen. Die Fans von Dynamo Dresden haben viele Krisen erlebt. Sportliche und finanzielle. Es wäre die Ironie des Schicksals, wenn ausgerechnet sie den Verein um seine Existenz bringen würden.