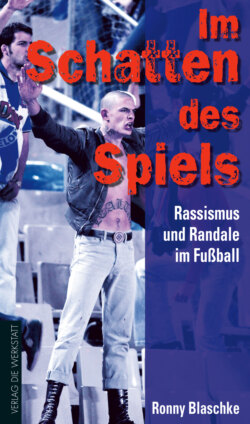Читать книгу Im Schatten des Spiels - Ronny Blaschke - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3Erholung mit Begleitschutz
Heinrich Schneider ist Schiedsrichter in der Kreisliga A. Manchmal ist er froh, wenn er unversehrt das Spielfeld verlässt – doch aufgeben will er nicht
Heinrich Schneider hätte seine Geschichte schon früher erzählt, es hat ihn bloß niemand danach gefragt. Der große Fußball ist für ihn außer Reichweite. Manchmal geht er ins Olympiastadion, Hertha gucken, ansonsten bleibt ihm nur das Fernsehen. Jedes Spiel schaut er sich an, sofern es ihm seine Zeit erlaubt. Bundesliga, U-20-Länderspiele, Champions League sowieso. Heinrich Schneider hat selbst lange Fußball gespielt, in seinem Heimatort Pirmasens, in den 1960er Jahren. Seit 1994 ist er in Berlin als Schiedsrichter aktiv. Mit 42 hat er angefangen. Das ist spät, aber nicht zu spät.
Schnell ist er aufgestiegen, bis in die Landesliga, trotz seines Alters. Inzwischen pfeift er in der Kreisliga A, in der Frauen-Verbandsliga und in den Jugendklassen. Heinrich Schneider kennt sich aus in der Tiefebene des Fußballs. Es gibt keine Kameras, keine Reporter und keine VIP-Tribünen mit Ehrengästen. „Die vermisse ich auch nicht“, sagt Heinrich Schneider. Er vermisst die Polizei und die Sicherheitskräfte. Denn manchmal hat er sie bitter nötig.
Fußball soll Spaß bringen, vor allem an der Basis, das sagen sich in Deutschland mehr als 75.000 Schiedsrichter, 1.400 allein in Berlin. „Für mich ist jedes Spiel Erholung.“ Heinrich Schneider grinst, als hätte er gerade im Lotto gewonnen. Erholung? Klingt gut, doch mit jeder Erinnerung, die er zum Besten gibt, driftet diese Beschreibung weiter ins Absurde ab. Wie kann die Angst um die eigene Gesundheit erholsam sein? „Es ist einfach so.“ Und dann beginnt er zu erzählen.
Sommer 1997. Heinrich Schneider hatte sich etabliert in der Berliner Schiedsrichterszene. Ein Spiel in der Kreisliga führte ihn nach Britz, tief im Südosten der Hauptstadt gelegen. Es war eine heißblütige Partie, kurz vor dem Ende kam es zu einer strittigen Situation. Ein türkischer Spieler des Gastgebers stürmte auf Schneider zu, beide Nasen berührten sich. Der Spieler schrie, gestikulierte und ballte seine rechte Hand zu einer Faust: „Ich mach’ dich kaputt.“ Dann bückte er sich, griff unter seinen Schienbeinschoner und zückte ein Messer. Die Spieler der Gastmannschaft eilten herbei. Sie bildeten eine lebende Mauer und schützten den Schiedsrichter.
Assistenten an den Seitenlinien gab es nicht in der Kreisliga. Heinrich Schneider, ein schmächtiger Mann mit Brille, zitterte. Sein Blick wanderte durch die spärlichen Zuschauerreihen. Er war weit weg von zu Hause, er kannte niemanden. Was wäre passiert, wenn er das Spiel abgebrochen hätte, wie es das Regelwerk in diesen Fällen verlangte? Er kann auf die Antwort verzichten, die Zuschauer drohten und pöbelten. Er zeigt dem Spieler die Rote Karte, fünf Minuten später war die Begegnung zu Ende. Wieder drängt sich die Frage auf: Warum ist der Fußball für ihn Erholung?
Ein Jahr ist vergangen seit dem Vorfall in Britz. Heinrich Schneider hat nichts Gravierendes erlebt. Es gab wilde Gesten, Mittelfinger, Spuckattacken, Drohungen und rassistische Schmähungen gegenüber farbigen Spielern. Aber das ist nichts Neues. Ein Landesligaspiel der A-Junioren steht in Karlshorst bevor, eigentlich kein Grund zur Sorge. Wieder kommt es zu Tumulten, wieder soll der Schiedsrichter schuld sein. „Treten Sie bitte zurück“, sagt Schneider in Richtung eines aufgebrachten Spielers. Der scheint die Sprache nicht zu verstehen. Er fackelt nicht lange und streckt den Referee mit der Faust nieder. Heinrich Schneider rappelt sich auf. Zeigt die Rote Karte. Die Partie wird unerträglich. Zwei weitere Platzverweise folgen. Nach dem Abpfiff sucht er sich einen Begleitschutz, zwei Spieler springen ein. „Erst als ich in der Bahn saß, habe ich mich wieder sicher gefühlt.“
Rund 80.000 Spiele werden an einem Wochenende in Deutschland angepfiffen, die überwiegende Mehrheit endet friedlich – doch bei weitem nicht alle. Es gibt keine statistischen Erhebungen, aber glaubt man Schiedsrichtern und Funktionären, so scheint die Gewalt unter Amateurspielern stark gestiegen zu sein. Keine Woche vergeht ohne Spielabbrüche. Jürgen Böcking, Vorsitzender des Fußballkreises Siegen-Wittgenstein, sagte im Oktober 2006 einen ganzen Spieltag ab. „Ich bin seit mehr als 20 Jahren Spielleiter“, erzählt er. „Aber so schlimm war es noch nie.“ Einige Schiedsrichter wollten aus Angst nicht mehr pfeifen. Sie waren krankenhausreif geschlagen und mit Messern bedroht worden: Einem Kollegen wurde eine Linienrichterfahne in den Unterleib gestoßen.
Schiedsrichter, kein Sozialarbeiter: Heinrich Schneider aus Berlin.
In Siegen-Wittgenstein gingen die Probleme häufig von ethnischen Vereinen aus. „Das sind für mich Beispiele einer gescheiterten Integration“, meint Jürgen Böcking. Vor einigen Jahren hatte es einen albanischen Klub in seinem Kreis gegeben, der häufig für Probleme sorgte. Viele Mannschaften weigerten sich, gegen ihn anzutreten, sie verschenkten die Punkte. So ist der Verein in die Bezirksliga aufgestiegen. Am Bodensee wollte ein Funktionär aus Albanien seine Mannschaft auflösen, weil die Spieler eine Massenschlägerei provoziert hatten. Doch nicht nur die ethnischen Klubs bereiten Jürgen Böcking Sorgen. Gewaltbereitschaft lässt sich nicht an der Herkunft festmachen. Sie ist nicht nur auf dem Rasen zu beobachten, auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Die Zahl der Gewaltvorfälle an Schulen ist ebenfalls gestiegen. 1.573 Delikte von Beleidigung, Mobbing bis zu sexuellen Übergriffen und gefährlicher Körperverletzung sind im Schuljahr 2005/06 beispielsweise an Berliner Schulen gemeldet worden. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von 76 Prozent.
Heinrich Schneider hat in Berlin oft ans Aufhören gedacht, durchringen konnte er sich nicht. Er brauchte den Fußball als Ausgleich. Zwölf Stunden arbeitete er täglich als Fahrer eines Versandhandels. Acht Kinder hatte er mit seiner Frau großgezogen. Einmal stand er kurz vor der Aufgabe, nicht, weil er unbedingt wollte, sondern weil er musste. Heinrich Schneider hatte seit Wochen Schmerzen in der Brust, er litt unter Atemnot. Im Oktober 2000, im Alter von 48 Jahren, wurde ihm eine künstliche Herzklappe eingesetzt. Der Arzt verbot ihm die Strapazen eines Schiedsrichters, sonst würde er sein Leben aufs Spiel setzen. Er verlor seinen Job als Fahrer, doch den Fußball wollte er nicht verlieren.
Im Krankenhaus traf Heinrich Schneider einen jungen Handballtrainer, er half ihm bei der Rehabilitation. Schnell erholte er sich, ein halbes Jahr nach der Operation stand er wieder auf dem Spielfeld. Die Eltern der Nachwuchskicker, die so oft wutschnaubend auf den Rasen stürmten, die Beschimpfungen der Spieler, die Schlägereien auf dem Rasen, das alles war für ihn zweitrangig geworden, denn er hatte sie wieder – seine Erholung. „Diese Geschichten schreibt der Fußball auch“, sagt er. Es sind Geschichten, von denen es tausende gibt. Sie bleiben im Verborgenen, aber sie sagen mehr aus als die ewig gleichen Bilder der rosaroten Bundesliga.
Heinrich Schneider genießt die Spiele intensiver als früher, er darf inzwischen auch zu internationalen Turnieren reisen. Nach Italien, Spanien oder Kroatien. In der Nähe von Barcelona pfiff er 2005 ein Halbfinale zwischen einem deutschen und einem russischen Team. Als unmittelbar vor dem Abpfiff der Ausgleich für die Deutschen fiel, stürzten sich drei russische Spieler auf ihn. Mit Mühe konnte eine Schlägerei verhindert werden. „Dich kriegen wir noch“, brüllten die Krawallmacher mit hasserfüllten Blicken. Wieder wurde Heinrich Schneider von jener Machtlosigkeit übermannt. Zwei Tage versteckte er sich im Hotelzimmer, allein traute er sich nicht auf die Straße. Abends ging er nur in der Gruppe aus, die Spieler hätten ihm schließlich auflauern und ihre Drohungen wahr machen können. Heinrich Schneider ist nicht prominent, er hat keine Millionen auf dem Konto. Er arbeitet seit Jahren als Gebäudereiniger in der Nähe des Alexanderplatzes. Nacht für Nacht. Zehn Stunden und länger. Als Schiedsrichter erhält er im Schnitt 15 Euro pro Spiel. Bratwurst, Kaffee und stilles Wasser gehen aufs Haus – und manchmal braucht er eben einen Bodyguard.
Alltag im Amateurfußball: Gewalt ist nicht nur auf den Rängen zu beobachten, sondern auch auf dem Rasen.
Bernd Schultz kennt diese Geschichten, er hat sie nicht selbst erlebt, aber zumindest davon gehört. Seit 2004 ist er Präsident des Berliner Fußball-Verbandes. Er möchte die Lage nicht verharmlosen, sagt er, und dann verharmlost er sie doch: „Die Spielabbrüche an einem Wochenende liegen im Promillebereich. Drei von 1.500 gehen nicht gut aus – höchstens.“ Außerdem hätten Verbände in anderen Bundesländern viel größere Probleme. Die gesellschaftlichen Probleme, die sich in Fangewalt entladen, spielen auch fernab des großen Fußballs eine wichtige Rolle. Die Amateurspieler suchen sich ein Ventil für ihren Frust, der sich unter der Woche angestaut hat. In Metropolen wie Berlin kommt eine politische Komponente hinzu. Der Ost-West-Konflikt der einst geteilten Stadt wird oft zwischen zwei Toren ausgetragen, auch die hohe Anzahl ethnischer Vereine birgt Konfliktpotenzial. Zudem verfügen die klammen Klubs über keine gefestigten Strukturen. Es fehlen die Kontrollen.
Bernd Schultz hat einen begrenzten Einfluss in der Bekämpfung der Jagdszenen. Er ist als Verwaltungsbeamter der Polizei beschäftigt, auch seine Verbandskollegen haben zeitintensive Jobs. Alle Probleme in den insgesamt 300 Berliner Vereinen können sie gar nicht kennen. Fragwürdig ist außerdem die Rechtsprechung des Sportgerichts – nicht nur in Berlin. Beim obersten Kontrollausschuss des DFB in Frankfurt sind Profis am Werk, langjährige Richter und Staatsanwälte, in den unteren Klassen hingegen entscheiden vielfach Funktionäre, die keine juristische Ausbildung haben. Die Folge ist fehlende Verhältnismäßigkeit in manchen Urteilen. Dem will er auf allen Ebenen entgegenwirken. Er hat Fortbildungen für Funktionäre und Schiedsrichter angeordnet, in seinem Vorstand soll das türkische Mitglied Mehmet Matur die Sprachbarrieren zu ethnischen Klubs abbauen. Dennoch gibt sich Schultz keinen Illusionen hin: „Wir können nicht alle Brände löschen.“ Er fordert eine klare Linie. Von allen Beteiligten. Vor allem von den Schiedsrichtern.
Wenn das so einfach wäre. Heinrich Schneider hat in Berlin mehr als 1.000 Spiele gepfiffen, manchmal vier an einem Wochenende. Er ist Schiedsrichter, kein Sozialarbeiter. Er überlegt sich dreimal, ob er in die Tasche greift. „Eine Rote Karte kann fatale Folgen haben“, sagt er. „Das Risiko geht niemand gern ein. Wir haben schließlich Beruf und Familie.“ Ein bisschen klingt es so, als wäre er jedes Mal überglücklich, wenn er das Spielfeld gesund verlässt. In seinem Berliner Verein, der VSG Weberwiese, hatte er fünf Patenschaften für junge Schiedsrichter übernommen. Er wollte sie nach seinen Vorstellungen ausbilden und ihnen seine Begeisterung mit auf den Weg geben. Durchgehalten haben nur zwei, die anderen suchten den Spaß vergeblich. Heinrich Schneider war enttäuscht. Trotzdem konnte er ihre Entscheidungen verstehen. Er hätte sie ja um ein Haar selbst getroffen.
Ratschläge für Referees: Der Berliner Fußball-Verband betreibt Aufklärung.
Im April 2006 passiert es wieder, dieses Mal im Bezirk Friedrichshain. Drei Spieler der Gästemannschaft aus Mahlsdorf mussten vorzeitig vom Platz. Aggressionen, Drohungen, Beleidigungen schlossen sich an. Ein Zuschauer ging zu weit, es kam zu einem Wortgefecht zwischen ihm und Heinrich Schneider. Der Schiedsrichter rief die Polizei und erstattete Anzeige. Einem Spieler passte das gar nicht. Er war groß gewachsen, hatte breite Schultern und einen rasierten Schädel. Er verfolgte Heinrich Schneider bis zur U-Bahn. Der Waggon war überfüllt. Sie saßen sich gegenüber und der Spieler sagte: „Das hättest du nicht gedacht, oder?“ Schneider wusste nicht, wie er reagieren sollte. Sein Körper zitterte. Er blieb eine Weile sitzen, dann stieg er um und fuhr in die andere Richtung. Dieses Verwirrspiel ging über eine Stunde. Endlich gab der Spieler auf. Er verließ die Bahn und schickte Schneider einen letzten Gruß: „Dich krieg’ ich noch!“
Ist das tatsächlich die Erholung, die sich Heinrich Schneider von seinem Alltag wünscht? „Sie können es auch Abenteuer nennen“, sagt er und schaut auf seine Uhr. Es ist nach 21 Uhr, Heinrich Schneider kommt zu spät zur Arbeit. Er muss drei Etagen eines Bürohauses reinigen. Seine Frau und er haben sich vor einer Weile getrennt. Er fühlt sich oft einsam in seiner Wohnung in Lichtenberg, im Osten von Berlin. Meistens schaut er dann auf seine Auszeichnungen als Schiedsrichter. Er zählt die Tage bis zum Wochenende und freut sich auf das nächste Spiel. Auf seine Erholung.