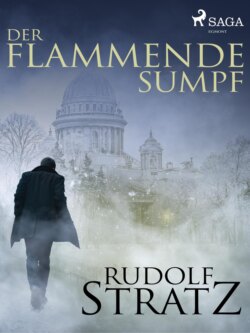Читать книгу Der flammende Sumpf - Rudolf Stratz - Страница 6
III
ОглавлениеIch sitze fiebrig in meinem Abteil. Ich trommle verstört mit den Fingeren auf den Knien. Ich qualme eine Papyros nach der anderen und werfe sie in meiner Aufregung halbgeraucht durch das Fenster. Es sind nur zweiundvierzig Werst von Gatschine nach Petersburg. Doch was kann während dieser Stunde alles geschehen? Unter mir rattern eintönig die Räder: Dein Pass . . . dein Pass . . . Verschaffe dir einen neuen, gültigen Pass, ehe man einen Hochverräter mit deinem alten Pass erwischt!
Mein Gott — wo bleibt denn Petersburg? Ich atme auf: Da flimmert endlich fern aus Seedunst, Fabrikrauch und Herbstnebel die gekrönte galeere als Wetterfahne auf der goldenen Turmspitze der Hauptadmiralität. Das Wahrzeichen meiner Vaterstadt Petersburg. Ich fahre vom Warschauer Bahnhof den schnurgeraden Ismailowski-Prospekt hinunter. Rechts und links begrüssen mich die bunten und doch nüchterne Häuser, die vielen Kuppeln und Kirchen — von Kindheit an vertraut das alles, und doch mit seinen russischen Strassennamen und Ladeninschriften ein wenig fremd, wenn man so lange im Ausland war.
Der Pass . . . der Pass . . . Ich beuge mich in dem Wägelchen vor, als könnte ich dadurch den Hufschlag des Gauls auf den Katzenköpfen des Granitpflasters beschleunigen. Gottlob: da hallen dumpf die Bohlen der Blauen Brücke. Da ragt duster in der grossen Seestrasse das Palais des Grossfürsten Oleg Igorowitsch. Zwischen den beiden wachehaltenden finnischen Gardeschützen verbeugt sich auf der Paradetreppa des Ehrenhofs ein blossköpfiger Lakai: Fräulein Magna Casparson wird erst um zwei Uhr mit den grossfürstlichen Kindern von einer Ausfahrt nach den Inseln zurück sein . . .
Der Pass . . . der Pass . . . Jetzt ist es Mittag. Ich fahre in unsere Wohnung in der Michailowskaja. Ich stürze die Treppen hinauf und in Mamas Arme. Ich sitze neben ihr auf dem Sofa. Ich halte ihre Hand in meiner. Mama ist noch rundlicher und behaglicher geworden in diesen zwei Jahren. Ihr pastörlicher, baltischer Blondscheitel schimmert schon stark ins Graue. Dicke Freudentränen laufen über ihr rotbäckiges, gutes Gesicht. Ach — es ist doch schön, wieder bei Muttern zu sein . . .
Aber er Pass . . . der Pass . . . Ich soll Mama Rede und Antwort stehen und tue es nur geistesabwesend. Ich soll effen und bringe kaum einen Bissen hinunter, und Mama nötigt liebevoll:
„Du ist Jungwild. Da sind eingemachte Mossbeeren. Nimm von diesen geräucherten Killo-Strömlingen! Mein Bruder schickte sie aus Estland. Er denkt noch jetzt an uns der Gute, mitten in seinem Kampf gegen den Dschingis-Khan!“
„Dschingis-Khan?“ frage ich mechanisch, und Mama kollert auf:
„So nenne ich den Zaren, seit er uns Balten unterdrückt! Hängen sollte man diesen Pobjedonoszjew mit seinem ganzen heiligen Synod! Ich kann mir nicht denken, dass Iwan der Schreckliche schlimmer gehaust hat als diese orthodoxen Kreaturen!“
Der Pass . . . der Pass . . . Ich bemühe mich, mir den Pastor Casparson in den estnischen Wäldern vor Augen zu rufen: Ich frage: „Was hat Onkel Martin denn getan?“
„Seine Pflicht als Seelsorger!“ ruft Mama empört. „Er hat einen lutherischen Kirchspielangehörigen mit einer russischen Orthodoxen auf deren Wunsch lutherisch getraut! Darauf steht nach dem Ukas des Tamerlan in Gatschina Sibirien! Die Untersuchung ist eingeleitet. Gott weiss, was wird . . .“
Armer Onkel Martin . . . Aber ich bin selbst in Nöten . . . Ich sehe auf die Uhr. Ich stehe hastig auf. Mama erschrickt.
„Wohin, Axel?“
„Zu Magna Casparson! Nein — nein — Mama! Ich muss. Papa schickt ihr durch mich ein eiliges Rezept für die Kinder des Grossfürsten.“
Der Grossfürst — da ist sofort das russische Verstummen. Der russische Gehorsam. Mama lässt mich zärtlich ziehen, und ich fahre wieder atemlos in die Bolschaja Morskaja. Ein Diener führt mich in einen kahlen, dumpfigen Empfsngsraum. Ich gehe da rastlos auf und ab. Ich fange in meiner Nervosität mit Händeklappen die Motten, die aus den verstaubten Mahagonimöbeln flattern. Dann öffnet sich die Tür, und Magna Casparson tritt ein. Sie ist mittelgross und schlank. Sie trägt ein einfaches, weisses Kleid. Sie drückt mir die Hand und sagt in ihrem Baltisch-Deutsch:
„Willkommen, Vetter! Bitte — nimm Platz!“
Ich setze mich und sehe meine blonde Base an und beginner unwillkürlich:
„Wie hübsch du geworden bist!“
Magna schaut mir seelenruhig aus ihren blauen Augen ins Gesicht. Das Schönste an ihr sind der reine, rotweisse Teint — die schwedische Abstammung der Casparson — und die blendend weissen Zähne.
„Als du vor zwei Jahren weggingst, war ich ja noch ein Kalb! Kaum achtzehn!“ spricht sie gelassen. „Nun bist du also wieder in Petersburg, du Ärmster!“
„Ärmster? Wie das?“
„Wie kann es ein Mensch in Petersburg aushalten?“
„Eine Million Menschen bringen das Kunststück fertig!“
„Ich nicht! Sowie die Grossfürstin aus Deutschland zurück ist — nächste Woche —, bitte ich um meinen Pass!“
Bei dem Wort „Pass“ von Magne Casparsons roten Lippen fahre ich wider Willen zusammen . . . Sie zuckt die Achseln.
„Man wird mich höchst ungnädig davonjagen! Einerlei!“
„Warum willst du von hier fort? Ist der Grossfürst zu dir zuringlich?“
„Ich bin für ihn Luft! Gelobt sei Gott!“ sagt Magna kühl.
„Schikaniert dich die Grossfürstin?“
„Mein Gott: die arme, kleine, deutsche Prinzessin ist froh, dass sie das Leben hat!“
„Ärgern ich die Kinder? Das Hoffräulein? Der Intendanturchef? Der Adjutant? Der Haushofmeister? Nein? Alle nicht? Also warum denn?“
„Weil man meinen Vater nach Sibiren schicken will!“ sagt Magne Casparson hart. „Und dabei soll ich mit diesen Leuten hier schöntun und unterwürfig gegen sie sein? Danke! Ich will heim!“
„Freilich: Da braucht man dich jetzt!“
„Daheim sind noch Geschwister und Verwandte genug! Aber Papa kann doch nicht allein nach Sibirien. Er braucht Pflege. Ich geh’ mit!“
„Wird man denn das erlauben?“
„Wenn es mit Sibiren Ernst wird — das ist dann meine letzte Bitte an die Grossfürstin! Wie die Russen sind — gerade so etwas schlagen sie einem nicht ab!“
„Fürchtest du dich denn nicht vor Sibirien?“
„Nein!“ sagt die blonde Magna in ihrem kühlen Baltisch. „Aber nun genug von mir! Heute morgen erst wurdest du aus dem Ausland von deinen Eltern erwartet. Warum kamst du dann gleich hierher, wenn du nicht irgend etwas brauchst?“
„Einen Pass brauche ich!“ versetze ich leise und verzweifelt und erzähle die ganze Geschichte. Als ich geendet, faltet Magna die Hände über em blonden Haarknoten im Nacken zusammen und schaut sinnend mit zurückgelegtem Haupt zur Decke. Ich warte eine Weile. Dann versetze ich kleinlaut:
„Papa meint, du wüsstest, wie man den Grossfürsten dazu kriegt, dass mir heute noch auf seinen Befehl ein neuer Pass . . .“
„Natürlich weiss ich es! Du must umgehend zur Krasnopolska!“ sagt Magna so geschäftsmässig, als handle es sich um ein Billett zum Zirkus Ciniselli. „Du wirst doch wissen, wer die Krasnopolska ist! Die Kinder hier nebenan im Kronsfindelhaus wissen es! Ach so — du kommst aus dem Ausland! Also Jesse Krasnopolska oder, wie sie sich jetzt nennt, Hesia Krasnopolska, stammt aus dem Kaiserlichen Ballett, aber seit Jahr und Tag tanzt sie nicht mehr, sondern ist die Mätresse des Grossfürsten Oleg. Deswegen ist die Grossfürstin ja ewig in Deutschland bei ihren Eltern. Sie langweilt ihn. Die Krasnopolska ist entschieden amüsanter!“
Meine Base behandelt diese russische Angelegenheit so rein sachlich wie Papa einen Fall von Influenza. Nur ihre Lippen sind dabei verächtlich gekräuselt. Ich forsche ängstlich:
„ . . . und diese Krasnopolska besitzt Einfluss auf den Grossfürsten?“
„Der Grossfürst kommandiert — ich weiss nicht wie viele Regimenter!“ sagt Magne. „Aber wenn die Krasnopolska ihm ihre Sofakissen an den Kopf wirft, so flieht er!“
„ . . .und du glaubst, sie würde etwas für mich tun?“
„ . . . wo dein Vater doch so einflussreich in Petersburg ist!“ Meine Cousine lächelt so nachsichtig, als sei ich ein kleines Kind. „Dein Vater erweist doch der Krasnopolska dann auch schon mal wieder einen Gefallen! Die beiden verstehen sich schon!“
Ja . . . Papa kennt die Welt . . .
„Die Krasnopolska ist ja so durchtrieben! Die weiss sicher Rat!“ beginnt meine blonde Base wieder, immer mit der gleichen objektiven Ruhe. „Sie wohnt nicht weit von hier in der Millionaja! Jeder Fuhrmann kennt das kleine Palais. Du wirst ihr dort bei ihrer Empfangsstunde hübsch die Hand küssen!“
„Hält sie einen Salon?“
„Es ist kein Salon. Es ist eine Menagerie! Du triffst dort die unmöglichsten Menschen! Fahre nur um fünf Uhr dorthin!“
„Mit einem Brief von dir?“
„Wie alt bist du eigentlich? Derlei schriftlich? Bis du hinkommst, ist die Krasnopolska völlig über die Affäre orientiert!“
„Durch wen?“
„Durch mich!“ sagt Magne Casparson gottergeben und steht auf. „Ich habe schon ein paarmal mit ihr über derlei Dinge vertraulich reden müssen! Man kann sehr leicht mit ihr verhandeln! Geh nun, Vetter! Danke mir nicht! Ich muss mich fertigmachen!“
Ich setze mich draussen in meine Droschke. Am Strassenportal des Vorhofs brüllt der Schweizer den Iswoschtschik an:
„Weiche aus, du Dorfteufel!“
Ein Zweigespann schiesst in rasendem Trab die Morskaja entlang. Der Federbusch eines Leibjägers flatter auf dem Bock. Im offenen Innern sitzen zwei Offiziere. Ich erkenne in dem finsteren, bärtigen General zur Rechten den Grossfürsten Oleg Igorowitsch selbst. Er kommt aus Gatschina zurück. Er weiss, warum er vom Bahnhof her wie ein Rasender durch die Strassen von Petersbrug jagt. So rasch handhabt kein Attentäter die Waffe . . .
Ein Attentäter mit meinem Pass . . . Der Pass . . . der Pass . . . Lakaientross wimmelt um den Grossfürsten Oleg. Er steigt hastig mit seinem Adjutanten aus und tritt eiligen Schritts in sein Palais. Ob seine Freundin mir helfen wird? Aber noch ist es zu früh. Ich befehle dem Iswoschtschik, mich in Petersburg herumzufahren, Wir durchqueren die Inseln bis zu den schon halb verlassenen Sommerdatschen hinaus. Wir zuckeln nach der Wiborger Seite, wohin sonst nie ein Mensch kommt. Wir kehren in die Petersbrudskaja zurück. Ich sehe Petersburg wie ein Fremder — die breite Newa — die unzähligen Paläste — die unermesslichen Plätze. Reisenhaft ist das alles, im Vergleich mit dem europäischen Westen . . . Endlich ist es fünf, und ich halte vor dem Krasnopolskaschen Palais in der Millionaja.
Das Palais duckt sich, klein und bescheiden, schräg gegenüber der Kaserne der Preobraschenzen, zwischen den majestätischen Prunkbauten, die eine Stunde weit die Newa säumen. Ich trete ein, hämmernden Herzens be idem Gedanken, nun gleich der schönen Frau gegenüberzustehen, die heute mein Schicksal ist . . .
Ein Schwarm dienstbarer Tataren empfängt mich, lautlos über die Afghanenteppiche des Vorsalls huschend. Es ist ganzes Familien-Artel: Greise, Männer, Knaben, alle in Weissseidenen Kaftanen mit purpurner Gürtelschnur. Tataren? Ich begreife: bei deisen schlitzäugigen Moslemin ist man vor Attentaten sicher! Der Grossfürst geht doch hier Tag und nacht, unbewacht, unbemerkt, ein und aus . . .
Das zweite Merkwürdige: ein hebräischer kammerdiener in unauffälliger, schwarzer, wie in einem Londoner Herrenklub abgelegter Kleidung. Er schlägt die Portiere zu den Salons vor mir zurück. Er ist jung noch und bleich. Er lächelt mich rätselhaft, still tröstend, an, als wisse er schon Bescheid.
Im ersten Raum liegt ein dicker Herr rücklings lang auf dem Teppich und runzelt, in angestrengtem Nachdenken, die Stirn bis in die Glatze. Ich steige über ihn weg, an einem Perser in schwarzem Schossrock vorbei, auf den ein paar Russen wild und gedämpft einreden. Am Fenster steht lässig ein junger Mann und zeigt, die Hände in den Hosentaschen, stumm den Anwesenden seine Kehrseite. Nun huscht mir etwas aus dem Nebenzimmer entgegen — kaum mittelgross, schmächtig, tief brünett — beweglich wie eine Eidechse, ein Figürchen nach der neuesten Mode, die ich jetzt eben erst in Paris sah: in einem weiten, unendlich langen, spitzengefältelten Rock, der die Füsse verbirgt und in ringsgerundeter Schleppe am Boden nachschleift. Ganz enge Ärmel. Das Schwarzhaar hoch um das magere Köpfchen gewellt. Dies weisslich gepuderte Gesicht darunter, das mich spitzbübisch wie einen alten Freund und Komplicen anlächelt, ist kaum hübsch zu nennen. Auf der Bühne, geschminkt, mag es mit dem grossen Mund und den riesigen Augen wirken. Von diesen funkelnden, schwarzen Augen kommt man nicht los. Sie faszinieren. Sie wechseln fortwährend den Ausdruck. Sie gehen einem durch und durch. Es liegt wie uraltes, tausendjähriges Wissen in ihnen . . .
Ich küsse der Krasnopolska die magere Kinderhand, die eigentlich nu rein flimmernder, fünffingeriger Diamantenladen ist. Die Geliebte des Grossfürsten schiebt vertraulich ihren dünnen Arm unter meine, schlägt, mit der Übung einer Tänzerin, mit dem rechten Fuss die Schleppe zurück und geleitet mich in den Nebenraum. „Einigt euch jetzt mit der Petroleumkonzession!“ befiehlt sie dabei auf Französisch über die Schulter dem Perser und den Russen und deutet auf den Herrn am Boden. „Baskakin hat sich das alles schon längst ausgerechnet!“
Baskakin auf der Erde grunzt nur. Der junge Mann am Fenster dreht sich um. Ich erkenne Malkiel, den ersten Tänzer des Marientheaters. Er lächelt verächtlich, wirst seine Zigarette weg und geht ohne Gruss aus dem Zimmer. Nebenan parodiert ein icker Faun mit hoher Fistelstimme eine prude Dame im Chambre séparée. „Oh — non — non — monsieus!“ Ich kenne ihn vom Sehen. Es ist Cousin, der Komiker vom französischen Kaiserlichen Michaeltheater. Er macht eine Grossfürstin auf Seitensprüngen nach. Alles biegt sich vor Lachen. Die Krasnopolska setzt mich neben einen dicken General im Schaukelstuhl und sagt mir abei leise und schnell in ihrem ausgezeichneten Deutsch: „Warten Sie, bis alle weg sind!“ und flirt, während mir ein echter kleiner Neger arabischen Kaffeesatz mit Früchten und Eiswasser serviert, wie eine Libelle in ihren Räumen von Gast zu Gast und küsst stürmisch einer eben eingetretenen grauhaarigen Dame in unauffällig kostbarer Toilette die Reismehlschicht von den groben roten Zügen. Es ist Madame Boissonade — Inhaberin des ersten Modesalons und eine Macht in Petersburg. Sie bringt den neuesten Klatsch aud den „Sphären“ der Gesellschaft. Hesia Krasnopolska hört amüsiert zu und überfliegt dabei einen eben abgegebenen Brief und kritzelt auf dem Malachit-Tischchen mit einer Goldfeder ein paar Zeilen und springt auf und sagt zu mir beiläufig im Vorbeigehen: „Machen Sie kein so unglückliches Gesicht!“ und beschäftigt sich schon wieder in einem dritten Raum mit einem käsefarbenen Armenier, der inmittet einer Gruppe von Damen und Herren einen Haufen loser Diamanten in der Hohlhand glitzern lässt.
„Was hat Ihnen Hesia ins Ohr geflüstert?“ ruft eine von zwei schönen Frauen aus Wolken von Parfüm und Papyrossenrauch zu mir herüber. Und die andere, noch griller geschminkte, lacht hell. „Sie sind ein hübscher Junge! Machen Sie hier keine Torheiten! Sonst schickt sie der Grossfürst in die Bergwerke!“
Mein Gott — der Grossfürst soll mich doch nicht verbannen, sondern davor bewahren, womöglich verbannt zu werden! Mein Pass . . . mein Pass . . . Aus einer dunklen Ecke murmelt plötzlich eine schwermütige Grabesstimme:
„Nun — da bist du ja wieder!“
„Kennen Sie Aptekmann?“ ruft die Krasnopolska. Sie flitzt aus dem Seitenkabinett, wo sie mit einem schwammigen, bartlosen Unbekannten getuschelt hat.
„Der Ewige Jude!“ sagt der General im Schaukelstuhl neben mir dumpf und versinkt wieder in Stumpfsinn.
„Aptekmann und ich haben zusammen in der Augenklinik in Odessa praktiziert!“ erwidere ich der Krasnopolska. „Wir sind Freunde! Und was sitzt du die ganze Zeit hinter der Portiere, Jascha, und schweigst?“
„Fragen Sie ihn nicht erst!“ Die Krasnopolska lackt sich mit spitzer Zunge eine flüchtig gefingerte Papyros zurecht. „Er ist verrückt!“
„Verrückt darüber, wie es in Russland zugeht! Wärst du doc him Ausland geblieben, Axel!“ Langsam, endlos erhebt sich Jakob Aptekmanns baumlange, klapperdürre Gestalt aus dem Sessel am Fenster, Sie hängt unter einer unsichtbaren Last krumm wie ein Fiedelbogen nach vorn über. Auch die Knie, bis zu denen die zu langen Arme hinabschlenkern, knicken im Stehen ein. In mächtigem Bogen schwingt sich die Nase über dem wirren, langen, fuchsroten Vollbart, der die bitter aufgeworfenen Lippen fast verdeckt. Darüber ein Paar dunkle traurige Augen. Dr. med. Jakob Aptekmann kauert sich, die endlosen Beine bis zum Bart hochziehend, auf ein niederes Taburett neben mich und drückt mir die Hand. „Gut, dass man dich noch sieht! Ich reise in den nächsten Tagen nach Tataru zu meinen Eltern!“
Dies Tataru ist sein Geburtsort, ein weltverlorenes bessarabisches Nest, ganz im Süden Russlands, nur von Hunderten von herbräischen Schneidern, Schustern, Schmieden, Fuhrleuten, und einem Wunderrabbi bevölkert. Mordche Bär Aptekmann, Jaschas Vater, flickt dort als Klempnermeister die Gutsdächer im Umkreis.
„Was machst du denn in Tataru, Jascha?“
„Es liegt Blut in der Luft!“ sagt Jakob Aptekmann ruhig mit seiner weichen, tiefen Stimme. „Es drohen Pogrome in ganz Bessarabien und im Chersonschen Gouvernement. Die rumänische Grenze ist von Tataru nur ein paar Stunden entfernt. Ich will meine Eltern nach Rumänien hinüberbringen. Ich möchte nicht, dass man mir die alten Leute totschlägt! Montag fahre ich nach Odessa und von dort weiter! Pascholl, ihr Hühnchen!“ Er klatscht, gegen die beiden hübschen Frauen gewendet, in die Hände. „Macht euch nützlich! Marsch ins Theater!“
„Wir tanzen erst im zweiten Akt!“ sagt die eine der beiden Schönen. Aber sie brechen doch auf, seidenraschelnd, von Wohlgerüchen umweht. Auch die moisten anderen Gäste sind schon gegangen. Die Räume halb leer. Neben uns schläft der dicke General mit weit offenem Mund im Schaukelstuhl.
„Das kommt davon, wenn man denkt, Samarkand ist weitm und dort unbefangen wie ein Kind stiehlt!“ sagt, mit einem Blick auf den General, der Ewige Jude. „Nun darf die Krasnopolska die Sache wieder mit dem Reichskontrolleur und seinen Gehilfen ordnen! Ach — es ist eine grosse Frau! Was macht sie für zentralasiatische Geschäfte mit dem bleichen Dickwanst da drinnen, der wie ein Skopze aussieht! Baumwoll-Lieferungen für die Krone. Da ist gar keine Baumwolle. Grimmig wird die Krone übers Ohr gehauen. Jetzt eben die Pariser Milliardenanleihen für den Bau der strategischen Bahnen in Polen. Was verdient die Frau da an der Vermittlung der Schmiergelder für die Grossfürsten! Jeder Tatar weiss es. Aber wer wagt etwas gegen Hesia Krasnopolska? Du hast bei ihr, scheint es, einen Stein im Brett. Halte sie dir warm! Sie ist ein Stern Petersburgs. Jede Stadt hat die Sterne, die sie verdient!“
Der Ahasver erhebt sich in seiner gespenstigen, gebeugten Länge und reicht mir die zarte, fast frauenhafte Rechte eines Augenarztes.
„Hast du einmal die deutsche Oper ,Die Walküre’ gesehen?“ fragt er. „Da schlagen zum Schluss überall die Flämmchen aus der Erde. Da ein Flämmchen — dort ein Flämmchen — überall Flämmchen. So schlagen auch bei uns in Russland überall die Flämmchen aus dem Boden. Die Regierung lässt die Flämmchen durch die Stiefel der Gendarmen und Kosaken austreten und denkt: Nun ist es gut! . . . Aber die Flämmchen kommen wieder, die Flämmchen werden immer wieder kommen . . . immer . . . immer.“
Er schreitet mit langen Beinen, lautlos, wirklich wie der Ewige Jude, zur Tür. Dort rafft, mit tieser Verbeugung, der bleiche, hebräische Kammerdiener die Portiere zurück. Aptekmann schüttelt ihm freundschaftlich die Hand. Ich beobachte es erstaunt.
„Dieser Kammerdiener ist doch Hesias Bruder! Dieser Vogel macht doch alles hier!“ brummt verdriesslich, aus seinem Schlummer erwacht und meinen Blick bemerkend, der dicke General aus Samarkand. Er steht mühsam auf, seufzt, bekreuzigt sich und schleicht geduckt zum Ausgang, das verkörperte böse Gewissen. Ich schaue mich in den von Zigarettenrauh bläulichen Räumen um. Ich bin allein. Hesia Krasnopolska kommt auf mich zu, ein verzuckertes Kiewer Veilchen im Mundwinkel, und setzt sich neben mich auf die Lehne eines Fauteuils. Irgendein betäubendes tibetanisches Aroma strömt aus ihrem blauschwarzen, hochgewellten Haarschopf. Perlen, Diamanten, Rubine, Smaragde glitzern überall an ihrer mageren, kleinen Gestalt. Aber ihre schwarzen Augen funkeln noch greller in dem kaum hübschen, weissgpuderten, ewig bewegten Gesicht. Ganz jung ist sie nicht mehr. Sicher schon dreissig.
„Nun — was machen Sie für Dummheiten!“ beginnt sie geschäftsmässig. „Dann findet ihr den Weg zu mir! Immer bin ich dazu da, die Dummheiten von anderen Menschen gutzumachen! Warum seid ihr denn so dumm? Antworten Sie doch!“
Ich finde auf diese Gewissensfrage keine Erwiderung.
Die Krasnopolska schaukelt mit den tänzerisch gekreuzten Füssen.
„Wie kann man sich seinen Pass stehlen lassen? Warum nicht gleich Ihren Kopf? Aber das lohnte dem Dieb nicht! Mein Gott — wie soll man da noch Russland in Ordnung halten?“
Sie seufzt, als sei sie Mitglied des Ministerkonseils, und bietet mir aus ihrem Karton mit Zuckerfrüchten an.
„Nehmen Sie ruhig! Man versucht zuweilen, mich zu vergiften. Aber man hat kein Glück. Ich esse nie Konfitüren oder Obst, das man mir zuschickt — nur, was ich durch meinen Kammerdiener irgendwo an der Polizeibrücke oder an der armenischen Kirche vom Ladentisch holen lasse . . . Sie haben keinen Appetit? . . . Das glaube ich — wenn man mit einem Fuss schon in der Stadthauotmannschaft zum Verhör steht! . . . Eine schöne Geschichte . . . Damit haben Sie ein für allemal Igre Petersburger Karriere ruiniert!“
„Dann kann ich ja also gehen!“ sage ich mühsam und will mich erheben. Sie halt mich zurück.
„Warten Sie, bis ich Sie entlasse! Man glaubt immer, ich könne zaubern!“ Die Krasnopolska sieht mich strafend an. Ihr Gesicht hat den Ausdruck einer gereizten kleinen Katze. „Wie denken Sie sich denn das eigentlich? Einen zweijährigen Auslandspass in zwei Stunden aus dem Boden stampfen — mit allen Spuren des Gebrauchs — mit verblasster Tinte — mit sämtlichen Grenzvermerken und auslänischen Polizeistempeln — Schweiz — Deutschland — Frankreich — und ganz frisch noch von gestern die Eintrittsbescheinigung in Wirballen? Kann denn das ein Sterblicher? Verfügen wir denn hier über Hexenmeister? Urteilen Sie selbst!“
Ich stehe verwirrt auf. Verstört. Ich begreife jetzt selbst Papa nicht mehr, wie er, der Weltkundige, derlei für möglich halten konnte! Ich sehe ein: da ist keine Hoffnung . . . Ich beuge mich über die Hand der Krasnopolska.
„Ich danke Ihnen, dass Sie mich empfingen!“ sage ich leise und will gehen. Sie lacht hell auf.
„Warten Sie! Ich gebe Ihnen noch ein Andenken mit!“
Die Krasnopolska kramt umständlich, absichtlich langsam, mit vor Heiterkeit zusammengebissenen Lippen und einem schlangengeschmeidigen, vor Lachen zuckendem Körper in ihrem Réticule — holt ein Spitzentaschentuch heraus, ein Puderdöschen, einen kleinen mit Gold eingelegten Revolver, ein Glücksamulett: ein Stückchen groben, gefaserten, fingerdichen Baststrick — wahrscheinlich von irgendeinem nächtlich drüben in Schlüsselburg Gehängten — und dann — ich traue meinen Augen nicht: einen Pass. Einen richtigen Pass. Einen Auslandspass auf meinen Namen.
„Da — armer Junge!“ sagt sie. „Und sei künftig vorsichtiger!“
Ich durchblättere den Pass. Alles, aber auch alles, stimmt!
Einen Augenblick habe ich die Hoffnung, es sei mein wirklicher, ursprünglicher, wieder zur Stelle gebrachter Pass. Aber auf der neunten Seite fehlt der mir wohlbekannte Daumenabdruck eines französischen Zollbeamten — auf der elften Seite der Einriss in das Papier oben. Nein. Es ist ein neuer, lächerlich ähnlicher Pass. Selbst meine vergilbte Unterschrift ist täuschend nachgemacht — offenbar auf Grund meines alten Passantrags vor zwei Jahren, der noch bei der Polozei ruht.
„Sie sehen, was wir können, wenn wir uns für unsere Freunde Mühe geben!“ versetzt Hesie Krasnopolska. „Wir verfügen über Meister in unserem Fach. Diesmal trieb ich sie an, ihr Bestes zu tun! Wegen Ihres Vaters. Grüssen Sie ihn von mir und bestellen Sie ihm, ich hätte bei Gelegenheit irgendeinen grossen Gegendienst bei ihm gut! Wie oft brauche ich Krankheitsatteste für unsere Würdenträger, die ins Ausland, in deutsche Bäder reisen wollen und keinen Urlaub dorthin bekommen!“
Jetzt schüttele ich Hesia Krasnopolska wirklich herzlich, wortlos vor Dankbarkeit, die dünnen Diamantenfinger, statt meine Lippen darauf zu pressen. Sie lacht. Sie gibt mir einen Klaps auf die Schulter.
„Sie sind noch sehr jung!“ sagt sie, eigentlich wohlgefällig. „Gott helfe Ihnen weiter. Gute Nacht!“
Ich setze den Fuss, im Begriff mich zurückzuziehen, auf die Schwelle zu dem vordersten Empfangsraum und pralle im selben Augenblick wieder erschrocken in das rückwärtige Zimmer zurück und zur Seite. Vom Eingang her kommt wuchtigen Schritts über den weichen Teppich ein breitschultriger, mittelgrosser, russischer General in Grüner Uniform mit goldenen Fangschnüren, dunklen Pluderhosen, kniehohen Stiefeln. Er ist zu jung für einen gewöhnlichen General. Erst Ende der Dreissig. Er hat kurzes, aufrechtes, dunkles Haar und buschige Brauen über den dunklen, finsteren Augen. Ein dunkler, kurzer Vollbart umrahmt das gebräunte, herrische, echt russisch geschnittene Gesicht mit den brutal aufgeworfenen Lippen. Ich erkenne mit Entsetzen: Es ist der Grossfürst Oleg selbst . . .
Hinter ihm tänzelt verstört der hebräische Kammerdiener, Hesias Bruder. Er gibt mir verzweifelte Winke, zu verschwinden — nach hinten — nach dem Offenen Seitenkabinett hinaus. Aber ich kann es nicht mehr erreichen. Ich stehe vorn, in dem Winkel hinter der Tür, und den Grossfürst tritt schon über die Schwelle. Er ist offenbar unerwartet früh zum Besuch bei der Krasnopolska gekommen. Man hielt die Räume für leer. Man hat keine Zeit mehr, mich zu entfernen . . .
Die Bewegung, mit der der Grossfürst sich ohne weiteres als Hausherr in den nächsten Sessel setzt, ist schwer und wuchtig. Seine Stimme grollt im Kellerbass eines Kirchensängers. Seine Worte rollen langsam und nachdräcklich in hartem Russisch.
„Ich möchte solch eine Bitte wie heute wegen dieses Passes von dir nicht wieder hören!“ sagt er schroff statt jeder Begrüssung zu der Krasnopolska. „Welche Umstände, weil ein leichtsinniger junger Sperling irgendwo seinen Pass hat leigen lassen! Wozu ist die Stadthauptmannschaft da? Ich befahl das Nötige nur, weil er der Sohn dieses Deutschen — diese Küster ist . . .“
„Er hat das Glück, vor Eurer Kaiserlichen Hoheit zu stehen!“ versetzt die Krasnopolska, in die Fügung des Schicksals ergeben, und weist in meine Ecke. Ich verbeuge mich tief und stumm. Der Grossfürst muster mich überrascht, mit gefurchter Stirn.
„Und was tust du hier?“
„Ich statte meinen Dank ab, wegen des Passes — meinen alleruntertänigsten Dank“, füge ich hastig hinzu.
Der Vetter des Zaren, Befehlshaber über Tausende von Gardetruppen, blickt mich immer noch düster unter seinen buschigen Augenbrauen an. Er sitzt da wie ein verkörpertes Stück Asien. Sein barscher Gesichtsausdruck wird milder. Er scheint sich wieder zu erinnern, dass ich der Sohn seines Leibarztes bin. Er nennt mich plötzlich „Sie“.
„Wie lange waren Sie im Ausland?“
„Zwei Jahre, Kaiserliche Hoheit. In fast ganz Europa.“
„Danken Sie Gott, dass Sie Europa sehen durften!“ Der Grossfürst geht plötzlich in ein leichteres, immer noch dunkel gefärbtes Französisch über. „Man ist bei uns in Russland erst Mensch, wenn man den Westen kennt!“
Bei ihm, dem treuesten Sohn der orthodoxen Kirche, der ragenden Säule der Moskauer Panslawisten, verblüfft mich dieses offenherzige Wort. Er fährt fort:
„Wir brauchen diese Bildung des Auslands. Auch ich besitze sie. Wir brauchen sie als Russen, um ihr zu widerstehen! Benutzen Sie diese Bildung, aber bringen Sie sie nicht nach Russland! Denn für Russland ist sie Gift.“
Ich stehe vor dem Grossfürsten. Neben seinem Sessel steht die Kransnopolska. Der finstere General räuspert sich.
„Ich sage Ihnen das als dem Sohn und, wie ich von Ihrem Vater höre, dem künftigen Gehilfen meines Arztes, der das Vertrauen, das sein Vater geniesst, sich erst verdienen muss!“
„Um dies Vertrauen zu rechtfertigen“, der Bass des Grossfürsten dröhnt aus tiefster Brust, „muss man echter Russe sein. Behalten Sie das Gift der Aufklärung für sich, wie ich es für mich behalte! Die russische Seele ist ein Ding für sich! Sie passt nicht zu Europa. Europa macht sie zweispältig und krank. Der wahre Feind Russlands ist jener mattherzige Teil der russischen Gesellschaft, der die Institutionen des Auslandes an Russland anlagen will. Diese Menschen ziehen die Pfeiler fort, auf denen Russland ruht. Sie züchten, ohne es zu wollen, jene Gottlosen, die vor neun Jahren meinen erhabenen Oheim ermordeten, die auch heute noch täglich die Krone und das Reich bedrohen und deren Ausrottung deswegen nicht gelungen ist, weil die verblendete russische Intelligenz ihnen den Nährboden bietet! Nie wird die Intelligenz Russland lenken können. Russland ist zu nahe der Natur. Nie werden die gemässigten Einrichtungen des Westens in Russland Bestand haben! Russland ist zu stark! Es braucht die starke Hand: Ein Gott! Ein Reich! Ein Zar! . . . Beherzigen Sie meine Worte! Schliessen Sie sich den Wohlgesinnten an, wenn Sie für Ihre Zukunft sorgen wollen!“
Der Grossfürst hat die Gnade, mir die Hand zu reichen. Ich ziehe mich mit dreimaliger, ehrerbietiger Verbeugung zurück und sehe noch, durch die sich schliessende Ausgangsportiere, wie die Krasnopolska ihn strahlend am Ohrläppchen beutelt. Und der finstere Machthaber schaut zärtlichfügsam zu ihr auf und lacht . . .