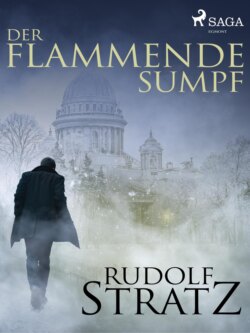Читать книгу Der flammende Sumpf - Rudolf Stratz - Страница 8
V
ОглавлениеSo fuhr ich tags darauf zur Teestunde, als ie Herbstsonne draussen in Kronstadt schon tief über Vater Johanns, des Wunderpopen, Kathedrale stand, hinaus zur Apothekerinsel, eine Werst nach der anderen, bis zu dem Botanischen Garten. Schon von weitem sah man an dessen Rand Boris Tschurins Dienstwohnung — ein grosses, niederes, weisses, ursprünglich wohl etwa für einen bescheidenen Inspektor im Etat der landwirtschaftlichen Domänen bestimmtes Gebäude. Viele Equipagen und Droschken hielten vor der Kronsvilla. Sie stand ganz frei, anscheinend jedem tückischen Anschlag ausgesetzt. Aber dann begriff man, dass diese Leere gerade ihr Schutz war. Niemand konnte unbemerkt nahen. Von nirgendsher drohte verdächtige Nachbarschaft. Die da und dort unauffällig scharwerkenden Gärtner kannten jedenfalls genau den Weg zur Fontanka drinnen in Petersburg und der Geheimpolizei im Ministerium des Innern . . .
Ich trete ein. Hier ist das echte Russland. Hier weht Bojarenluft. Die Herrin des Hauses stammt aus einem der vielen, im Moskauer Gouvernement begüterten Fürstengeschlechter. Bauernkerle von Lakaien reissen mir gewaltsam, zu dritt zugleich, Pelzmütze, Mantel und Galoschen vom Leibe — je vornehmer das haus, desto wilder die Dienstbeflissenheit — und schlagen die Flügeltüren wie Scheunentore vor mir auf. Eine Menge Räume. Ein Stimmengewirr. Eine Masse Menschen. Tschin in Uniformen und Zivil. Farbige Damenkleider. Ich kenne keine Seele. Ich mache am Eingang halt und schaue mich um . . .
. . .Wenn ich jetzt beim Niederschreiben dieser Erinnerungen meiner Jugendzeit auf meinen Lebenslauf zurückblicke, dann ist mir eines klar: die grossen Ereignisse unseres Daseins trippeln, wie der deutsche Weltweise sagt, lautlos, unbemerkt, auf Taubenfüssen in unsere Erdenbahn. Erst später, viel, viel später, erkennt man, dass es Schicksalsvögel waren, die da, glückbringend zur Rechten oder unheildrohend zur Linken, warnend oder wegweisend, vor uns aufflatterten . . .
Aber damals — an jenem Nachmittag, beim Betreten des Tschurinschen Salons, hatte ich im selben Augenblick schon das förmlich hellseherische Gefühl: Hier und heute erfüllt sich ein Stück deines Lebensschicksals . . .
Mitten in diesem Zimmer, gerade unter dem venezianischen Glasgeglitzer des Kronleuchters, stand ein junges Mädchen zu Anfang der Zwanzig, mehr als mittelhoch, viele der sie umdrängenden Herren mit ihrem wie eine glänzend braune Krone um den Kopf geschlungenen Haarkranz überragend. Sie trug ein Kostüm von goldgesticktem, grünlich schillerndem Pfaublau, mit Keulenärmeln, fusslangem Raffrock und der Wespentaille jener Tage. Aber selbst diese Einschnürung vermochte ihrem jungen, prachtvoll gewachsenen Körper seine Spannkraft nicht zu rauben. Schmalschultrig und merkwürdig hüftschlank, in ihrer spielenden Geschmeidigkeit an die Zigeunerinnen erinnernd, die im Sommer auf den Inseln singen und tanzen, bog sie sich wie eine Schlange im Kreuz nach rückwärts und kämpfte dabei hell lachend mit einem reisenhaften, russischen Windhund, der wie ein Mensch auf den Hinterbeinen vor ihr stand und seine Vorderpfoten schwer auf ihre Schultern stützte. Sie konnte die Last kaum tragen. Aber sie neckte das Ungetüm auch noch mit einem Stück fleischgefüllter Pirogge, das sie mit dem hochgereckten dünnen rechten Arm unerreichbar weit über ihm hielt. Der spitze Hechtrachen des Barsoi glühte ihr mit scharfem weissen Gebiss gerade in das schöne, kühn und lebhaft geformte Gesicht. Sie lachte halboffenen Mundes, mit ebenso weissen Zähnen dagegen. Sie tauchte spielerisch ihre glänzenden, unbestimmt braunen Augen in das gierige, grünliche Geflimmer seiner Pupillen. Die beiden rangen miteinander. Beides zwei Edelstücke der Schöpfung. Es war wie ein belebtes Gemälde aus Meisterhand, dessen Hintergrund durch den hellen Fensterrahmen den möwenüberflatterte, graue, windige Wellenschlag der Newa und der weite, graubleiche, russische Nebelhimmel bildete.
Und ich sah das an — mit einer feltsamen, verdächtigen Neugier und fühlte: Irgend etwas geschah in mir. Ich wusste noch nicht was . . .
Nun gab das schöne Menschengeschöpf dem schönen Tier den Leckerbissen preis. Die Kiefer des Barsois schnappten gierig. Er sprang leise winselnd zur Erde. Seine Herrin liess mit den weichen, lässigen Bewegungen der Vollblutrussin die Arme sinken. Sie stand, immer noch lachend, das edle Antlitz gerötet, lebhaft atmend im Kreise der jungen Männer. Auch jetzt noch ungefähr wie eine Tierbändigerin im Käfig zwischen ihrem Raubvolk. Ein ganz leiser Spott zwinkerte schläfrig in ihren Augen.
Einer der jungen Petersburger Elegants — sein Gesicht ist auffallend töricht — wirft sich mit gefalteten Händen vor ihr auf die Knie. Sie muster ihn kaltblütig und gibt ihm dann mit der Spitze des langen, schmalen Schuhs einen leichten Stoss vor die Brust. Es würde kaum genügen, ihn umzuwerfen. Aber der Anbeter fällt von selbst um. Friedlich, mit verzücktem Lächeln, immer noch die Hände über der Brust gefaltet, liegt er zu ihren Füssen und start begeistert zu ihr empor. Die anderen jungen Männer wundert das nicht. Sie sind alle zusammen verrückt . . .
„Aufstehen, Grischa!“ ruft einer. Aber der Jagdjunker, oder was er ist, auf dem Teppich rührt sich nicht. „Man muss ihn wegtragen!“ Sie packen den Verliebten an den Knien und unter den Achseln und schleppen ihn unter Halloh davon. Aus der Ecke ruft eine zigarettenrauchende kleine Blondine lachend seiner Angebeteten zu:
„Hat sich Grischa deinetwegen erschossen?“
„Er wäre der erste nicht!“ murmelt neben mir ein missgünstiger, älterer Herr zu seinem Nachbar, und der nickt bedeutsam. Die Züge des schönen Mädchens unter dem Kronleuchter umwölken sich eine Sekunde. Es ist nu rein rascher Schatten. Ihr Antlitz sieht einen Augenblick hart, beinahe grausam aus. Draussen im Vorraum dröhnt plötzlich ein dumpfer Schlag. Ein Schuss? . . . Grischa? . . . Oder ein Attentat . . .? Gerade in diesem bei Tag und Nacht todbedrohten Hause? Eine jähe, unheimliche Stille schauert durch die Räume voll Damen, Tschin, Garde, Adel, Diplomaten. Nein, Gott sei Dank! Grischa hat nur mit dem Bügel eines der draussen hängenden Offizierssäbel an den grossen kupfernen Samowar geklopft. Er steht schon, stolz auf seine Heldentat, mit neckisch zur Seite geneigtem, fadblondem Köpfchen auf der Schwelle. Das junge Mädchen muster ihn aus halbgeschlossenen Lidern und dann die anderen mit plötzlicher Langeweile und Geringschätzung.
„Das sind Bauernspässe!“ sagte sie und gleitet mit raschen, lebhaften Bewegungen auf eine Gruppe teetrinkender, alter Damen zu. Sie setzt sich mitten unter sie. Sie beginnt, liebenswürdig und bescheiden, beinah kindlich mit ihnen zu plaudern. Ich höre, wie eine der Matronen sich durch ihren Papyrossenqualm hindurch amüsiert bei ihr erkundigt: „Nun — welches Ihrer hundert Gesichter tragen Sie heute?“ Und die Barsoi-Bändigerin schüttelt ahnungslos den schönen, klassisch geformten Kopf und macht grosse, unschuldige Augen. Dann dreht sie mir, im Gespräch mit den Alten, den Rücken. Ich stehe. Ich sammle mich. Ich muss mich doch endlich der Hausfrau vorstellen. Vom Kanapee nebenan fragt eine ältere Dame mit leidender Stimme:
„Sind da drinnen die Kosaken? Oder was war das für ein Lärm?“
„Ach — sie spielte nur mit dem Windhund!“
„Sie ist selber ein Windhund!“ sagt die alte Dame matt. Drüben hebt das schöne Mädchen im Kreis der Würdenträgerinnen voll Abscheu die Schultern.
„Ich soll wieder den Chriffre tragen und Hoffräulein werden? Warum denn?“
„Damit Sie Ihre Tage ausfüllen! Sie sitzen herum . . . Niemand — verzeihen Sie, dass ich Ihnen das als mütterliche Freundin sage — wird aus Ihnen klug!“
„Nun — und was liegt an mir? Hier gibt es wichtigere Persönlichkeiten! Dort sitzt der Mönchspriester Damaskin, der flämische Geisterseher Aymerich, der berühmte Monsieur Jules Ruben aus Paris . . . Was bedeutet da eine arme Magd Gottes wie ich?“
Das junge Mädchen hat sich umgewendet, um die Sterne des Salons Tschurin zu zählen. Ihr Antlitz, das im Gegensat zu den anderen Peterburger Mondänen Puder und Schminke verschmäht, wetterleuchtet jetzt launisch und hochmütig. Ihe Auge, das über die Gäste hinstreicht, fällt auf mich. Ich bin ihr fremd. Aber in keiner Weise interessant. Sie blickt mich leer und gleichgültig an. Doch dann klatscht sie in die Hände und ruft in die Gruppe junger Petersburger Stutzer hinüber.
„Platon! Kümmere dich um deine Gäste! Was ist das hier bei uns für ein Dorfkrug? Man läuft durcheinander wie die Hühner! Hier an der Türe steht einer deiner Freunde und wartet, was Gott ihm beschert!“
Ein junger Mann eilt feurig und lebhaft, federnden Schrittes, auf mich zu. Er ist etwas grösser und älter als das Mädchen, das ihn rief, und nicht so brünett wie sie, sondern blauäugig und von dunkelblondem Haar. Er prüft mich rasch mit einem funkelnden Blick, die Hand in der Tasche, offenbar am Kolben eines revolvers, ob ich nicht ein eingedrungener Terrorist sei? Als er meinen Namen hört, verzieht sich sein wildes, schnurrbärtiges Gesicht zu einem verbindlichen Lächeln. Er macht eine knappe, fast militärische Verbeugung und reicht mir die Hand.
„Ich bin der Kollegienassessor Tschurin, der Sohn des Hausherrn! Seien Sie hier willkommen!“ sagt er. Aber ich weiss ja von Gatschina her von seinem Vater, dass Tschurin der Jüngere zu den fanatischsten Panslawisten gehört, zu der Geheimorganisation der ,Heiligen Schar’ des Zaren, die am liebsten alles in Russland, was nicht zur orthodoxen Taube betet, mit Feuer und Schwert vertilgen möchte: die Deutschen — die Polen — die Tataren — die Lutheraner — die Katholiken — die Hebräer — die Moslemin. Ich als deutscher Lutheraner muss ihm ein Dorn im Auge sein. Aber er versetzt höflich:
„Nun — Mama erwartet Sie schon hier! Sie waren jahrelang im Ausland? Was taten Sie in dem faulen Westen?“
„Ich füllte die Lücken meiner medizinischen Bildung aus, die sich in Russland nicht schliessen liessen!“ erwidere ich. Wir schauen uns einen Augenblick an. Wir fühlen: wir sind einander sehr umsympathisch: ich — der Deutschrusse — und er, der Deutschenfresser. Der Kollegienassessor Tschurin schweigt. Er hat, wenn er nicht gerade panslawistisch aufkollert, ein ziemlich unbedeutendes Gesicht. Er führt mich zu seiner Mutter. Der Hausherr, der alte Tschurin, ist natürlich nicht anwesend. Seine Hohe Exzellenz hat unter Tag mehr zu tun als Tee zu trinken.
Das geistvolle, weissgepuderte Mopsgesicht der Dame des Hauses zeigt, unter eisgrauen, gebrannten Löckchen, für jedermann ein verständnisvolles, einschmeichelndes Lächeln, als sei gerade er ihr besonderer Freund und Vertrauter. Oder ein neuer Protegé, wie ich. Sie versichert es mir gütig, während ich ihr die fette, reichberingte und durchdringend parfümierte Hand küsse. Marina Georgiewna Tschurin, die geborene Fürstin Koguschew aus Moskau, besitzt die Gabe, gleichzeittig mit drei Menschen zu reden und dabei alles um sie herum zu hören. Sie erkundigt sich so lebhaft nach meinen Studien un Zukunftsplänen, als ob sie das eine Sekunde auch nu rim entferntesten interessierte. Sie verfolgt zugleich das Gespräch der beiden Gäste neben ihr und unterbricht es entrüstet.
„Wie? Pogrome in Südrussland? Wenn es sein muss — dann wenigstens später! Nicht gerade jetzt, während der Zar nach der Krim reist! . . . Doch ein bisschen Takt, ein bisschen Geschmack . . .“
„Wie wollen Sie den Muschik hinder?“ erwidert, mit einer hohen, sanften, singenden Stimme, der Mönchpriester Damaskin. Der berühmte Damaskin. Der Klostergeistliche und Weltmann in allen Petersburger Salons, der mondane Heilige für gelangweilte hohe Damen. Er ist mit seinem langwallenden, losen Blondhaar, seinem feinen, vollbärtigen Christuskopf, in seinem langen Kirchenrock, ein auffallend schooner Mann in den Dreissigern. Neben ihm lächelt sarkastisch der spitzbärtige, pechschwarze Monsieur Jules Ruben aus Paris, der grosse französisch-russische Finanzmann. In seiner Tasche klimpern förmlich hörbar die kommenden Milliarden-Anleihen zum Bau der strategischen Bahnen in Polen.
„Und wie wollen Sie die französische Bankwelt hindern, kein Geld mehr nach Russland zu schicken?“ fragt er. Vater Damaskin schweigt milde. Es ist, als dächte er über das Problem nach, in Russland die Hebräer zu hetzen, ohne dass in Frankreich die Rothschilds etwas davon merken.
Die Dame des Hauses beachtet mich nicht mehr. Ein graubärtiger Gardegeneral erzählt ihr mit tiefer Stimme von einer Sitzung der slawischen Wohltätigkeitsgesellschaft, der mächtigen Kampforganisation des Panslawismus. Sie hört ihm nicht mehr zu. Sie beginnt nervös zu zittern.
„Aymerich spurt seine Ätherwellen!“ fluster sie atemlos.
Am Fenster sitzt mit geschlossenen Augen, in einem aufgeregten Kreis von Damen und Herren, Jan Aymerich, ein stämmiger Vlame, dessen rosiges Gambrinusgesicht fast völlig unter goldblondem Haupthaar un Vollbart verschwimmt. Er ist, scheint es, der augenblickliche Modeprophet Petersburgs. Dessen Salons wimmeln ja von jeher von heiligen Idioten, ekstatischen Nonnen, tibetanischen Zauberern, spiritistischen amerikanischen Zahnärzten. Ein verlebter, wundervoll gekleideter junger Mann wendet sich empört von dem Hellseher ab.
„Und mit diesem Humbug will man Russland retten!“ ruft er. „Es wird erst besser, wenn der Zar mich zum Minister macht!“
„Ausgesprochener Grössenwahn!“ murmelt der Gardegeneral zu einem langbärtigen, bebrillten, allrussischen Professor. „Er leidet dank seinen Ausschweifungen an Gehirnerweichung!“
„Ist dieser Woinitsch denn noch im Staatsdienst?“
„Jetzt eben als Gehilfe in das Ministerium des öffentlichen Unterrichts berufen! Ich bitte Sie: ein Mensch mit diesem Selbstbewusstsein . . . Sieh da, Erlaucht . . .“ Der General der slawischen Wohltätigkeit erhebt sich ehrfurchtsvoll: „Wir sahen uns zuletzt auf dem allrussischen Kongress in Moskau. Sie sind ein seltener Gast in Petersburg!“
Der neue Besucher ist ein Mann im besten Alter, von sehr breitschultrigem, plumpem und untersetztem Wuchs und mit der hochfahrenden Sorglosigkeit eines grossen Herrn vom Lande gekleidet. Der Ansatz eines Höckers entstellt seine Gestalt. Sein Gesicht ist gross, rund wie der Mond, bartlos, mit schwammigen, aber geistig regen Zügen. Er drückt jedem von uns im Vorbeigehen, ohne weitere Vorstellung, schweigend die Hand und begibt sich bedächtigen Schritts auf die alte Tschurin zu. Die vergisst sofort ihren Geisterseher am Fenster. Sie lüftet ihren dicken, kurzen Körper vom Kanapee und eilt erfreut dem hohen Gast entgegen. Er küsst ihr nicht die Hand. Er schüttelt ihre Rechte nur kräftig und versetzt dabei mit einer dumpfen und markigen Stimme:
„In der Tat — ich bin es, Marina Georgiewna! Zehn Jahre oder länger war ich nicht in Petersbrug! Ich verabscheue diese Beamtenstadt. Nun aber führten mich Verhandlungen mit dem Ingenieurinstitut der Verkehrswege aus Moskau auf einen Tag hierher. Man baut, ohne mich zu fragen, eine Bahnlinie, die auf mehr als hundert Werst meine Güter durchschneiden soll . . .“
„Nun — und bei dieser Gelegenheit . . .“, er nimmt breit und schwer neben der alten Tschurin Platz, „überbringe ich die Grüsse Ihrer Schwester Jelena, meiner Tante!“
„Wer ist dieser Fürst?“ frage ich. Der panslawistische Professor belächelt meine Unerfahrenheit.
„Haben Sie niemals von den berühmten Kunstschätzen in Andrjuschinow im Moskauer Kreis gehört? Doch? Nun — dort sehen Sie den Sammler un Eigentümer, Fürsten Chowansky!“
„Er ist wohl sehr reich?“
„Einer unserer grössten Grundbesitzer. Sein kleines, körperliches Gebrechen — Sie sehen es ja — hat ihn menschenscheu gemacht. Auch in Moskau trifft man ihn selten. Er lebt völlig zurückgezogen, nur mit seinen Sammlungen beschäftigt, auf seinen Gütern!“
Ich fühle, dass ich jetzt hier, im Allerheiligsten der Villa Tschurin, überflüssig bin. Ich trete wieder in den Nebenraum. Es zieht mich unwiderstehlich dort hin. Dort ist dies wunderschöne Mädchen. Gottlob — sie ist noch da. Sie sitzt in einem Schaukelstuhl und wippt träumerisch auf und nieder, eine Zigarette in der Hand. Um sie drängen sich, wie die Fliegen um den Honig, ihre Anbeter in Uniformen und modischen langen Schossröcken. Keiner gönnt dem anderen den Platz in der Nähe des leise im Auf- und Abschwung knarrenden Schaukelstuhls. Keine dieser Motten weicht aus Irinas Lichtkreis. Aber es gibt auch trübgestimmte Seelen, die still verzichtet haben und sich auf französisch empfehlen. Während sie gehen, kommen andere. Es ist ein Aus und Ein im Salon Tschurin wie in einem Taubenschlag. Auch der Sohn des Hauses drückt abschiednehmend rechts und links die Hände. Er hat in Petersburg eine wichtige Sitzung der „Heiligen Schar“. Sie wird mit ihren Leibern den Zaren auf seiner demnächstigen Reise nach der Krim decken. Platon Tschurin eilt aus dem Gemach. Seine Sprache, seine Bewegungen sind stürmisch. Draussen rast eine Troika mit dem panslawistischen Kampfhahn der fernen Isaak-Kathedrale zu.
In der kurzen Stille nach seinem Weggang tritt plötzlich ein gut aussehender junger Mann mit den melancholischen, länglichen Zügen eines Kleinrussen vor das Mädchen im Schaukelstuhl hin und versetzt ganz laut und traurig, mit stiller Verzweiflung in der Stimme:
„Warum wollen Sie mich nicht heiraten, Irina Borissowna?“
Sie antwortet nicht. Sie schaukelt weiter und sieht den Frager über den Rauch der Papyros hinweg seelenruhig an. Jetzt weiss ich, was ich die ganze Zeit schon hoffte: Dies Mädchen ist die Tochter des Hauses, Irina Tschurin, das ehemalige Hoffräulein der greisens Grossfürstin Marija Petrowna. Der alte Tschurin heisst der Vater der Lüge. Aber er hat gestern in Gatschina wahrlich nicht zuviel von der Schönheit seiner Jüngsten gesagt. Der junge Mann vor ihr stammelt zerknirscht — er weiss in seiner Verliebtheit offenbar kaum mehr, was er redet.
„Einmal müssen Sie doch heiraten!“
„Weshalb denn?“ Irina Tschurin hebt neugierig die braunen Augen und streift dei Asche ihrer Zigarette ab.
„Ich bin vielleicht der reichste Erbe Russlands“, stottert der verstörte junge Mann weiter. „Unsere Kiewer Zuckerfabriken . . . Wenn schon Ihr Herz nicht spricht — warum lassen Sie den Verstand nicht wählen? Warum werfen Sie mich zu den übrigen?“
„Du bist da in einer sehr guten und zahlreichen Gesellschaft“, sagt einer seiner Freunde, und führt den vor Liebeskummer unzurechnungsfähigen jungen Krösus aus dem Zimmer.
Ein anderer lacht: „Man wollte schon in Petersburg einen Klub der abgewiesenen Freier gründen. Aber man fand keine Räume, die gross genug waren!“
Irina Borissowna tat, als hörte sie es nicht. Der Mönchpriester Damaskin beugt sich von hinten über ihren Schaukelstuhl. Sie wendet ihren schönen Kopf über die Schulter zu ihm empor. Die beiden unterhalten sich eifrig un leise, wie alte Freunde. Dann erklärt Irina mit einem Blick in die Runde:
„Ich bereite bei Vater Kyrill meinen Eintritt in ein Nonnenkloster am Weissen Meer vor. Ich verschiebe es von Monat zu Monat. Es ist feige von mir, mich Gott zu entziehen. Aber bald bin ich entschlossen!“
Und mit hellerer Stimme — plötzlich ein paar unheimliche, düstere Querfalten auf der niederen, weissen Stirn:
„Neulich schon, als ich Jan Aymerich da drinnen in seinem Helbschlaf die Hand auf die Stirn legte, hat er mir Scgreckliches für die Zukunft prophezeit! Was — wollte er durchaus nicht sagen!“
„Wahrscheinlich war der Spitzbube betrunken“, brummt neben mir ein Infanterist, der nicht zur Garde gehört, in dies vornehme Haus? Ich erkenne meinen Vetter Sascha von Etwein vom Revaler Armeekorps, von dem ein Teil auch in Petersburg steht. Er drückt mir die Hand und erläutert.
„Ich habe Gott sei Dank Verbindungen! Ich betreibe meinen Austritt aus der Armee und meine Einstellung in das Gardekorps. Hier, in diesen Räumen, werde ich es erreichen! Wie? — Du kennst Irine Borissowna noch nicht? Was hast du im Westen für Formen gelernt? Komm — ich werde dich vorstellen!“
Mein Herz hämmert. Ich stehe vor Fräulein Tschurin. Sie reicht mir geistesabwesend ein paar Fingerspitzen. Es würgt mich in der Kehle vor Glück und Angst. Ich möchte ihr etwas sagen. Aber da raschekt schon ihre Schleppe wie eine Schlange über den Teppich. Sie stürmt auf Monsieur Jules Ruben zu, den spitzbärtigen Finanzmann mit dem roten Bändchen der Ehrenlegion auf der Rockklappe. Er soll ihr von den neuesten Pariser Wintermoden berichten! Ich bin für sie so interessant wie eine Fliege. Ich ziehe mich betrübt in einen Winkel zurück. Mein Vetter Etwein steht neben mir.
„Wer ist denn nur diese Irine Borissowna?“ frage ich erbittert, beinahe mit Tränen im Auge.
„Ein Rätsel!“
„Wie, Sascha?“
„Oder das Rätsel! Das grosse Rätsel von Petersburg. Über das zerbrechen sich ganz andere Leute als du den Kopf!“ sagt Alexander von Etwein. Er ist nu rein Linienleutnant, aber ein fixer Junge. Er hat in Petersburg die Augen offen gehalten. Er bewegt sich schom mit der Sicherheit eines Preobraschenzen oder Chevalier-Garden auf dem Parkett dieser Newa-Salons, das so glatt ist wie das Eis der Newa selber, und dem Ungewohnten so gefährlich, wie ihr braunes Moorwasser dem Durstigen.
„Sie ist zweiundzwanzig!“ sagt er halblaut zu mir, mit einem Blick auf die lachende Sphinz dort drüben. „Sie ist schön wie eine göttin. Sorgfältig im kaiserlichen Institut erzogen. Ehrenfräulein im Hause Romanow. Ihre Mutter eine Fürstin. Ihr Vater Hohe Exzellenz. Vor zwei Jahren kam er zu seiner heutigen Macht. Warum nutzt sie nicht die Zeit, wo sie auf der Höhe ist? Sie braucht nur zu wählen. Petersburg liegt zu ihren Füssen. Die Männer sind blind und toll. Du sahst den Unzurechnungsfähigen — den Erben von hundert Millionen —, den man vorhin wegbrachte. Nun — derlei erlebt sie jeden Tag. Und gähnt — oder lacht — oder wirft mit dem Pantoffel — je nach ihrer Stimmung . . .“
„Und was bedeutet das?“
„Das ist es ja: worauf wartet sie? Heute zittert Petersburg noch vor ihrem Vater. Morgen vielleicht schon ist er tot. Einmal, in kurzer Zeit, sicherlich! Dafür werden die Feinde des Staates schon sorgen! So gewiss jeder Stadthauptmann von Petersburg ermordet wird, so gewiss stirbt ein Mann in der Stellung Tschurins nicht in seinem Bett. Dann sind für die Tochter die Tage des Glanzes vorbei. Kümmert sie das? Nicht im gerungsten! Sie lacht . . . Sie macht sich über uns luftig — sie lebt gedankenlos hin wie der Sperling im Sommer . . .“
„Ist sie denn so einfältig?“
„Eine Tochter Tschurins und der alten Fürstin? Sie hat von beiden den Verstand geerbt. Sie ist wie geschaffen für das Leben in grossem Stil. Sie verschmäht es. Ihr Gerede vom Kloster ist auch nicht ernst. Da steckt etwas anderes dahinter, was niemand weiss. Da würde selbst der Scharfsinn der dritten Abteilung versagen!“
Die dritte Abteilung — Boris Tschurins furchtbares Werkzeug . . . Und doch geschehen auch da Dinge zwischen der Apraxin- und der Tschernitschew-Gasse, von denen selbst er nichts ahnt. Mein neuer Pass . . . Seine Tochter Ljuba, die Abtrünnige — die Verbrecherin — die in Peters burg herumläuft, und die Polozei sieht sie und kann sie nicht fassen . . .
Wieder steht das Bild des bleichen, schmächtigen, grünen Gymnasiasten vor mir. Ich merke jetzt erst, wie es mein Bleigewicht auf der Brust bei Tage, der Albdruck meiner Träume war. War . . . Denn jetzt geschieht etwas Merkwürdiges: die Umrisse Ljuba Tschurins werden vor meinem inneren Auge schattenhaft — sie schwinden, sie lösen sich in der strahlenden Gestalt ihrer Schwester Irina drüben auf, wie der Nebel vor der Sonna.
Dia schöne Irina steht dort zusammen mit meinem Vetter Sascha. Wie gesagt: das ist ein fixer Junge! Er kann mehr wie Brot essen! Er hat die hoffnungsvoller junger Mann in den Petersburger Sphären so nötig braucht wie das tägliche Brot. Er versteht es, sich geschmeidig an junge Frauen und alte Würdenträger heranzupirschen. Er erzählt Fräulein Tschurin etwas, das sie offenbar interessiert. Sie ist, gegen ihre Art, nicht zerstreut, sondern hört ihm gespannt zu.
Und während mein Blick ihr Bild trinkt, geht eine merkwürdige, aber mir ganz deutlich bewusste Wandlung in mir vor. Plötzlich, in einem Licht von oben, wird es mir klar: nicht ie mitternachtsstunde, in der Ljuba Tschurin mir meinen Pass, stahl, sondern diese Nachmittagsstunde, in der ich jetzt eben Irina Tschurin begegnet bin, ist der entscheidende Augenblick meines Daseins . . .
Und wie ich Irina aus meiner Ecke heraus mit den Augen des Verliebten liebkose — denn jetzt gebe ich mich gar keinem Zweifel mehr darüber hin, dass ich bis über die Ohren in sie verliebt bin — da ahne ich jetzt mehr, als dass ich es sehe, den schwachen Schatten einer Ähnlichkeit zwischen den Schwestern, obgleich Ljuba beinah unschön zu nennen ist und Irina ein strahlendes Meisterstück der Schöpfung. Sie ist einen halben Kopf grosser als die ältere, heller an Haar- und Augenfarbe, sie halt sich mit dem stolzen Anstand einer Königin, sie leuchtet in Jugend uns Lebenskraft und Lachen, ganz im Gegensatz zu dem verbissenen, fahlen, hageren Leidensgesicht der Terroristin. Wo ist da nur die Ähnlichkeit? Vielleicht, manchmal nur, in einem sonderbaren, fanatischen, tief aus dem Innern kommenden Aufflimmern in den Augen. Diesen unheimlichen Blick hat — so scheint mir — den Bruchteil einer Sekunde hindurch manchmal auch die schöne Irina. Es scheint mir wenigstens so. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein . . .
Fräulein Tschurin am anderen Ende des Zimmers drüben hat ihr Gespräch mit meinem Vetter Sascha beendet. Sie schaut durch den Raum. Sie geht zögernd ein paar Schritte. Man macht ihr Platz. Sie sucht irgend jemanden. Jedenfalls eine Dame. Denn die Männer winkt sie sich ja herbei. Die behandelt sie wie die Leibeigenen. Jetzt hat sie, was sie sucht, gefunden. Offenbar ganz in meiner Nähe. Sie kommt heran. Und nun ereignet sich das Unerwartete: sie tritt auf mich zu! Sie, die verwöhnte, hochmütige Irina Tschurin drückt mir freundlich die Hand und lächelt liebenswürdig und schaut mir freimütig ins Gesicht und versetzt:
„Seien Si emir nicht böse, Herr von Küster! Ich habe unglückseligerweise vorhin Ihren Namen nicht verstanden! Ich habe jetzt erst von dem nichtsnutzigen Sascha dort gehört, dass Sie der Sohn unserer lieben Exzellenz Küster sind, auf den Papa mit Recht so grosse Stücke halt! Seien Sie herzlich willkommen! Hoffentlich sehen wir Sie recht oft bei uns!“
„Zuviel der Gnade!“ stammle ich. Es fällt mir, weiss Gott, im Moment nichts Gescheiters ein. Ich fühle, wie alle Blicke auf mir ruhen. Mit Staunen. Mit Neid. Mit Neugier: Wer ist denn dieser Glückspilz? Ich gewinne für alle Anwesenden plötzlich an Interesse. Fräulein Tschurin mustert mich noch einmal wohlwollend, verabschiedet sich von mir mit einem freundschaftlichen Kopfnicken und tritt zu einer Gruppe ausländischer Diplomaten. Sie beginnt dort mit einem breitschulterigen, fischblütigen jungen Briten ein Gespräch in lachendem Englisch.
Und ich stehe und bin glücklich. Betäubt. Sascha Etwein, der Linienleutnant, murmelt neben mir:
„Du kannst stolz, sein, mein Vetterchen! So herablassend ist die schöne Hexe sonst nie! Du hast bei ihr einen grossen Stein im Brett!“
„Ich danke dir von Herzen, Sascha!“
„Es ist kein Grund! Ich musste doch von irgend etwas reden, als ich mich glücklich in ihre Nähe herangeschlängelt hatte, und da verfiel ich auf das erste beste dumme Zeug und sprach von dir!“
„Und das interessierte sie?“
„Offenbar. Ich begreife es ja auch nicht. Ich finde nichts Merkwürdiges an dir!“
„Wahrscheinlich war es nur eine ihrer Launen!“
„. . . oder sie will jemand anderen eifersüchtig machen!“ belehrt mich der weltkundige Vetter.
„Vielleicht diesen englischen Athleten, mit dem sie spricht!“
„Das ist ein Lord von der Britischen Botschaft — der älteste Sohn eines Herzogs. Später einmal einer der ersten Leute von England. Aber den braucht sie nicht erst zu erhitzen. Er hat längst Feuer gefangen. Jeden Augenblick legt er ihr, wenn sie will, seine Peerskrone und seine Schlösser zu Füssen!“
„Und sie will nicht?“
„Ich sage dir ja: sie ist unverbrennbar wie Asbest. Sie ist nicht von Fleisch und Blut. Und dabei doch voll von innerem Leben. Warmgewordener Marmor. Ach — Irina Tschurin ist und bleibt ein Geheimnis — für einfache Menschen wie dich und mich ist es nicht zu ergründen!“
Der Linienleutnant Alexander von Etwein seufzt und schweigt. Er ist wahrscheinlich auch in Fräulein Tschurin verliebt, wie alle Welt. Bei ihm ist der Fall natürlich ganz hoffnungslos. Und mein bisschen gesunder Menschenverstand sagt mir: Bei dir gerade so! Lasse dich nur nicht durch ein paar oberflächliche, leutselige Worte verwirren! Die waren bei der Tochter des Hauses selbstredend nur eine Nachholung eines Versäumnisses, eine nachträgliche Höflichkeit, die nicht dir, sondern deinem Vater galt . . .
„Weisst du, was komisch ist!“ versetzt mein Vetter Sascha nach einiger Zeit. „Irina Borissowna schaut nach dir herüber!“
„Zufall!“
„Da — ganz deutlich — wieder!“
„Das bildest du dir ein!“
„Hast du es denn nicht selber gemerkt?“
„Ja“, murmle ich gepresst. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Ich weiss nicht, wie mir wird . . .
„Es fällt auch anderen im Zimmer auf!“
„Was sollte sie denn an mir finden?“ sage ich verzweifelt, mit dem Mut zur Wirklichkeit.
„Frauen sind unergründlich!“
Sascha Etwein ist noch sehr jung, sehr unbedeutend, sehr dürftig an Rang und Vermögen. Aber er bildet sich schon ein, ein Weiber- und Weltkenner zu sein. Ich zwinge mich zu einem spöttischen Achselzucken.
„Wenn wir Mondscheinwandler sein wollen, werden wir es in Peterburg zu nichts bringen, Sascha!“ sage ich. „Man muss mit so törichten Gedanken nicht einmal spielen!“
„Und hat sie dich nicht eben wieder mit einam schnellen Blick gestreift?“ Mein Vetter murmelt es, selbst fast so erregt wie ich, zwischen den Zähnen. Seine Stimme zittert. Er ist ein solcher Streber . . . In diesem Augenblick geht es ihm womöglich schon durch den Kopf, das ser urch mich in Petersburg Karriere machen kann . . .
Ich möchte ihm den Unsinn verweisen. Abe rich kann nicht. Ich bin wie gelähmt. Denn er hat recht. Ich habe es auch gesehen. Fräulein Tschurin hat unruhig und unentschlossen zu mir herübergeschaut . . .
Und nun . . . ich traue meinen Augen nicht . . . aber es ist so . . . der ganze Salon ist Zeuge: Fräulein Tschurin trennt sich von dem Engländer und tritt, mitten durch die Gäste, ein zweites Mal auf mich zu und sagt lebhaft und lächelnd, und noch dazu aus Höflichkeit gegen mich, den Deutschrussen, in gutem Deutsch:
„Setzen wir uns einen Augenblick da zusammen in den Wintergarten!“
Neugierige Augen ruhen auf mir. Ich nehme neben Irina auf zwei Korbsesseln in dem offenen Erkervorsprung Platz, in dem ein paar vergilbte Zwergpalmen aus den Treibhäusern der Krone einen shcwindsüchtigen Süden vorspiegeln. Es weht kühl von dem gelben Sand des Bodens. Man sieht den Atem in der Luft und hört vor den Fenstern das Pfeifen des Herbstwinds über der Newa und die klagenden Schreie der Möwen. In dem anstossenden gesellschaftsraum hat sich das Stimmengewirr merkwürdig gedämpft. Ich ahne dort vielsagendes Schweigen, bedeutungsvolle Seitenblicke, malitiös lächelnde Lippen: Sieh da — Irina und dieser kleine Deutsche ohne Orden und Titel, der kaum zum Tschinadel zählt, nie in der Garde gedient hat, weder dem Englischen, noch dem Neuen oder dem Iachtklub angehört . . . Erbarmen Sie sich: was soll das heissen?
Wahrhaftigen Gottes — ich weiss es selber nicht. Ich kann kaum atmen vor Erregung. Ich höre in der Stille das Hämmern meines Herzens. Irina Tschurin sitzt vor mir und lächelt. Ihr schönes Antlitz ist liebenswürdig glatt und etwas leer. Sie beginnt die oberflächliche Konversation eines Weltfräuleins:
„Sie kommen eben aus dem Ausland zurück, Herr von Küster? Wie war Ihre Reise? Hatten Sie Schwierigkeiten an der Grenze?“
Ich srocke verblüfft. Soll ich es bejahen? Soll ich antworten: Allerdings! Ihre Schwester stahl mir meinen Pass! Von diesem Raub kann Fräulein Tschurin nichts wissen. Von dem weiss jai hr eigener Vater noch nichts Ich erwidere mühsam:
„Wie sollten da Schwierigkeiten sein? Wenn man seinen Pass hat . . .“
Fräulein Tschurin nickt beistimmend. Sie examiniert weiter.
„Und wo hielten Sie sich in den zwei Jahren auf, Herr von Küster?“
„In den moisten Ländern Europas!“
„Auch an Orten, wo viele von unseren Landsleuten sind?“
„Ich studierte unter anderem in Zürich . . .“
„Und haben Sie dort mit den Russen verkehrt?“
Wieder zögere ich. Ich kann doch nicht erwidern: Schöne Russen — das! Ihre Schwester Ljuba lief dort herum, mit ihren verbrecherischen Genossen! . . . Ich versetze gepresst:
„Gerade als ich mich im März vorigen Jahres in Zürich aufhielt, flogen in der Nähe der Stadt zwei unserer sogenannten Landsleute, Peter Lawrow und Isaak Dembo, bei der Herstellung einer für den Zaren bestimmten Höllenmaschine in Stücken in die Luft! Von diesem Verkehr hielt ich mich lieber fern!“
„Mit Recht!“ räumt Fräulein Tschurin bereitwillig ein. Ihr Gesicht ist blass. Es wechselt die Farbe. Ich merke, dass sie erregt ist. Aber warum? Will sie etwas von mir? Und was? Soll ich ihr berichten, dass ich ihre Schwester Ljuba vorgestern nacht noch gesehen habe? Ahnt sie denn überhaupt, dass Ljuba in Russland weilt? Es ist nicht anzunehmen! Das Eindringen einer Terroristin durch die Pass- und Gendarmerieschranke in das heilige Russland ist ein Staatsgeheimnis, dar der alte Tschurin keinem Unberufenen, auch seiner eigenen Familie nicht, preisgibt! Ich kann mir für immer meine Laufbahn in Russland verschustern, wenn ich dies Geheimnis leichtsinnig ausplaudere . . .
Wir schweigen einen Augenblick. Aus dem Nebenkabinett tönt die tiefrollende, selbstbewusste, bedächtige Stimme des Fürsten Chowansky. Der bucklige Moskauer Mäzen erzählt einem ehrfurchtsvollen Krei von Damen und Herren von seinen neuesten Kunsterwerbungen in Spanien und Italien. Irinas schmale, weisse Finger spielen unruhig mit der scharfen Spitze eines welken Palmblatts, das sie von dem nächsten Pflanzenkübel herunterergezupft hat.
„Wovon leben diese russischen Flüchtlinge in der Schweiz nur eigentlich?“ beginnt sie unvermittelt.
„Von Tee und Brot! Sie sind standing unteretnährt und daher — ich sage das als Arzt — in jener krankhaften Geistesverfassung, die sie zu ihren Verbrechen treibt!“
„Irgendwie müssen sie doch ihren Unterhalt erwerben! Aner kann denn das ein Ungebildeter — ein Mensch, der zum Beispiel nur russisch versteht, in der Fremde?“
Wem gilt diese Frage? Ich begreife das nicht. Irina, die selber doch vier Sprachen spricht, blickt mich rätselhaft an, mit einem leidenden und verstohlenen Lächeln, als sei dies ganze Gerede nur ein Vorwand für sie, mit mir allein zu sein. Mir wird es heiss um das Herz. Ich versetze verwirrt:
„Ein Mensch, der arbeiten will, findet überall in der Welt sein Brot. Zumal der Russe passt sich leicht an . . .“
Ich breche ab. Woinitsch, der gehirnerweichte, junge Petersburger Staatsrat, tritt in den Wintergarten. Er lächelt selbstgefällig. Mitten im Fluss seiner Rede stolpert seine Zunge zuweilen über ein Wort. Er winkt beschwörend ab.
„Nein! Es ist vergeblich, mich zurückzuhalten, Irina Borissowna! Wichtigste Geschäfte rufen mich nach der Stadt!“
„Nun — mit Gott!“ sagt die schöne Tschurin phlegmatisch.
„Wenn ich nicht im Ministerium nach dem Rechten sehe — ah — unsere Bismarcks!“ Ein verzücktes Kusshändchen des übernächtigen Elegants an sich selbst mit zwei Fingern in die Luft. „Wenn erst meine Zeit kommt . . .“
„Möge Eure Hohe Exzellenz sich dann gnädigst unserer entsinnen!“ Irina schnippt Herrn Woinitsch grausam blinzelnd dir scharfe Spitze eines Palmblatts in das verlebte Gesicht und wendet sich, während er, die Uhr in der Hand, wichtig, sorgenvoll, gehetzt, als sei er der Aussenminister Giers selber, davoneilt, laut auflachend zu mir.
„Welch ein Narr! Aber er ist es nicht allein! Ach — es wäre schön, einmal andere Luft zu atmen! Erzählen Sie mir vom Ausland! Berichten Sie mir doch etwas von sich!“
„Was kann Ihnen daran gelegen sein, Irina Borissowna?“ versetze ich mühsam und auf russisch. In ihrer Muttersprache darf ich, als Gast des Hauses, sie mit Vor- und Vatersnamen nennen. Auf deutsch würde es zu vertraut klingen. Mich trifft bei der Anrede „Irina Borissowna“ ein merkwürdig warmer Blick aus ihren plötzlich mädchenhaft sanften Augen.
„Ich bin froh, einmal einen Menschen zu finden, der nicht zu diesem ewigen kleinen Hofcercle Mamas gehört! Was ist das für ein Kreis!“ sagt sie leise. „Führen Sie mich doch einmal in Ihre Welt! Ich folge gern . . .“
Mein Herz steht still . . . Sollte doch? . . . Diese weiche, wie willenlose Sprache — dieses träumerische Auge, das unter dunklen Wimpern geheimnisvoll auf mir ruht . . . Was ist schliesslich auf Erden unmöglich? Mir schwindelt. Ich finde kaum die Worte. Aber ich fange an, meine Reisen, meine Studien im Ausland zu schildern. Mein Gott — was habe ich denn schliesslich erlebt? Aber Irina Tschurin hört gespannt zu. Sie sitzt, ohne sich zu rühren, die Hände im Schoss, und schaut mich unverwandt aus ihren schönen, jetzt ganz ernsten un reinen Augen an. Und ich rede. Ich bin wie berauscht. Ein unendliches, immer noch ungläubiges Glücksgefühl durchströmt mich. Ich habe auf Irina Tschurin Eindruck gemacht . . . Sie gibt sich gar keine Mühe mehr, es zu verbergen! Ich sehe es, während ich eifrig spreche, auch an den Gesichtern draussen im Salon . . .
Aus ihm heraus verdunkelt eine massige Gestalt die Glasscheibenhelle des Wintererkers. Es ist der verwachsene Knjäs Chowansky, von der Dame des Hauses gefolgt.
„Ich kenne Sie nicht, aber ich beglückwünsche Sie!“ sagt er zu mir in seinem tiefen Moskauer Russisch. „Doch leider muss ich Sie stören und mich verabschieden!“ Er wendet sich zu Irina, die ebenso wie ich aufgestanden ist. „Ich verlasse heute nacht schon Petersburg. Lebe wohl, schöne Russalka! Breche nicht zu viel Herzen!“
Der verkrüppelte Moskauer Bojar ist ein entfernter Verwandter des Hauses. Er kann es sich erlauben, Fräulein Tschurin eine Wasserhexe zu nennen. Er darf ihr auch nach russischem Brauch einen Kuss auf die Stirn drücken. Sie lässt es mit scheinbar sittsam niedergeschlagenen Augen geschehen. Dabei zuckt es schon wieder verräterisch um ihre Lippen, und ein Schleier von Leichtsinn und Lebenslust legt sich über ihre eben noch klassisch strengen Züge . . .
Der Fürst schreitet schwerfällig hinaus. Ich stehe zwischen. Mutter und Tochter Tschurin. Es ist eine gewisse Stille. Ich begreife, dass es auch für mich jetzt Zeit ist, mich zu empfehlen. Ich küsse die durchdringend parfümierte, fette, kleine Patsche Ihrer Exzellenz, dann Irinas schmale, blaugeäderte Rechte, die kühl und glatt wie aus Alabaster geformt in meiner ruht.
„Lassen Sie sich bald wieder sehen!“ sagt Irina und schnell zu mir. Ich stammle ein paar Worte. Ich ziehe mich mit einer verwirrten Verbeugung zurück.