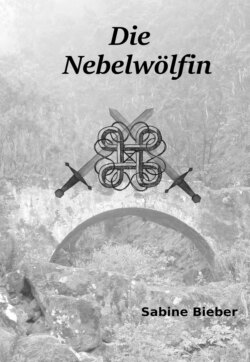Читать книгу Die Nebelwölfin - Sabine Bieber - Страница 4
Kapitel 1
ОглавлениеIrgendwo sägte jemand. Aber warum sägte jemand in meinem Schlafzimmer, in der dritten Etage eines nagelneuen Wohnhauses mitten in Hamburg? Das Geräusch verstummte kurz, nur um gleich darauf wieder in einer anderen Frequenz einzusetzen. Langsam kam ich zu mir und stellte fest, dass das vermeintliche Sägen nichts anderes war, als die Schnarchgeräusche des Mannes, der auf der anderen Seite des Bettes lag. Verschlafen rieb ich mir die Augen. Wenn bloß das Brummen in meinem Schädel aufhören würde. Ich drehte mich langsam auf den Rücken und betrachtete den Mann neben mir. Er hatte blonde Haare, seine Haut war sonnengebräunt. Sein Name wollte mir einfach nicht einfallen.
Trotz des fortwährenden Trommelwirbels in meinem Schädel richtete ich mich vorsichtig auf. „Hammerwerfen in der Gedächtnishalle“, nannte meine Freundin Mara diesen Zustand und eigentlich traf es das auf den Punkt. Ich presste die Finger gegen meine Schläfen, das Klopfen ließ etwas nach. Der Nebel in meinem Kopf begann sich ein wenig zu lichten. Der schicke neue Club, viele bunte Cocktails und dann dieser Typ mit den stechend blauen Augen. Wie war bloß sein verdammter Name? Ich streckte mich ein wenig und wackelte mit den nackten Zehen. Sein Name war eigentlich egal. Zum Frühstück würde er ohnehin nicht bleiben, von daher bestand keine Notwendigkeit ihn damit anzusprechen. Ziemlich unsanft rüttelte ich an seiner Schulter. „Hey du, aufwachen, hörst du mich?“ Der Typ schnarchte noch ein bisschen lauter und die Frequenz der Töne veränderte sich wieder leicht, aber ansonsten machte er keine Anstalten wach zu werden. „Hey“, sagte ich und rüttelte etwas stärker an ihm. Mühsam öffnete er die Augen und murmelte irgendetwas, dass ich für guten Morgen hielt. Es hätte aber auch eine Verwünschung meiner Person an einen sehr heißen und endgültigen Ort sein können.
„Los“, sagte ich energisch, „steh auf, es ist Zeit für dich zu gehen.“ Er sah mich an, als wäre ich nicht ganz bei Trost, dann setzte er sich langsam auf. „Morgen Lana“, sagte er und grinste wie ein kleiner Junge, der gerade ein großes Eis geschenkt bekommen hatte.
Ich starrte an ihm vorbei an die Wand und wiederholte etwas zu laut, dass er endlich gehen sollte. Meine Stimme zitterte leicht und ich ärgerte mich. Eigentlich sollte ich doch mittlerweile etwas mehr Routine haben. „Ist ja schon gut“, murmelte er genervt und erhob sich schwerfällig. „Hübscher Hintern“, dachte ich und grinste zufrieden, als er vollkommen unbekleidet durch das Zimmer schlurfte, um seine Sachen zusammen zu suchen. Er zog sich an, während ich mir die Bettdecke bis zur Nasenspitze hochzog und ihm dabei zusah. „Wirklich ein sehr hübscher Hintern und die trainierten Oberarme sind auch nicht zu verachten. Du hättest wirklich eine schlechtere Wahl treffen können, Lana“, sinnierte ich zufrieden stumm vor mich hin und kuschelte mich tiefer in die Decke.
„Kann ich vielleicht noch einen Kaffee haben?“, fragte er vorsichtig und versuchte es mit einem freundlichen Lächeln. „Die Straße runter an der nächsten Ecke ist ein Coffee-Shop, die machen so viel davon, dass sie ihn verkaufen müssen“, sagte ich und war mir deutlich bewusst, wie zickig ich klang. „Ist ja schon gut“, sagte er und bedachte mich mit einem prüfenden Blick. „Keine Sorge meine Liebe, ich werde dich nicht fragen, ob wir uns wieder sehen. Ich kenn die Spielregeln, es war nett mit dir.“ Er wandte sich um, zog die Schlafzimmertür beim Gehen hinter sich zu, kurz darauf hörte ich die Wohnungstür ins Schloss fallen. „Endlich alleine“, seufzte ich erleichtert. Ich wickelte mich in eine Decke ein, schlurfte in die Küche und startete die Kaffeemaschine. Auf dem Tisch lag noch die kleine, mit silbernen Pailletten besetzte Tasche, die ich immer mitnahm, wenn ich ausging. Irgendwo mussten doch hier noch Zigaretten sein. Hektisch kramte ich in der Tasche meiner Jacke, die ich achtlos auf den Boden geworfen hatte. Kaum hatte ich den ersten tiefen Zug inhaliert, klingelte mein Telefon. „Guten Morgen“, erklang Maras fröhliche Stimme aus dem Hörer. „Nicht so laut bitte, ich bin gerade erst aufgewacht“, murmelte ich und hielt den Telefonhörer etwas weiter von meinem Kopf entfernt. „Warst du feiern?“, wollte Mara wissen. Sie klang nervtötend munter und ausgeschlafen. „Mmh“, knurrte ich nur, „neuer Club, hier ganz in der Nähe.“ „Und war´s nett?“, hakte sie nach. „Mmh“, machte ich wieder. In meinen Ohren dröhnte es und ich hatte einen pelzigen Geschmack im Mund. Ich zog an meiner Zigarette. „Ich sehe schon, du brauchst noch eine halbe Stunde. Nimm eine heiße Dusche, ich bin gleich da.“ „Da?“, fragte ich völlig verständnislos. „Du hast es vergessen“, sagte sie etwas weinerlich. „Wir wollten heute einkaufen gehen. Du erinnerst dich? Das Kleid für den Silvesterball mit Tom.“ Sie seufzte leise. „Ach, das Kleid, ja klar.“ Ich rollte mit den Augen. „Komm vorbei, ich bin gleich soweit und dann gehen wir einkaufen. Das hab ich natürlich nicht vergessen.“ Ich konnte einfach nicht lügen. „Prima, bis gleich!“ Es klickte in der Leitung. Ich konnte sie förmlich vor mir sehen, sehr klein, etwas rundlich, mit strahlenden braunen Augen, voller Energie und Tatendrang.
Ich legte das Telefon zur Seite, ließ mich auf den Stuhl plumpsen und stöhnte laut auf. Okay, nun war der Notfallplan gefragt. Eine Aspirin, eine kurze, sehr heiße Dusche und ein starker Kaffee würden schon alles wieder ins Reine bringen. „Verwandlung in ein menschliches Wesen in dreißig Minuten“, befahl ich mir selber laut und drückte den Knopf an der Stereoanlage. Mit Musik ging alles besser.
Eine halbe Stunde später klingelte es an der Tür, ich drückte den Summer und rief durch die Gegensprechanlage: „Komm hoch, die Tür ist offen, ich bin noch im Bad.“
Mara kam schnaufend die Treppen hoch. „Warum ist der Aufzug eigentlich immer noch nicht in Betrieb, die Wohnungen sind doch nun alle bereits seit Monaten verkauft.“ Sie ächzte und warf dann ein Blick in mein Schlafzimmer, das einem Schlachtfeld glich. Mein dunkelblaues Minikleid lag mitten auf dem Fußboden, von den Pumps war auf den ersten Blick nur einer zu entdecken und die teure, dunkelrote Spitzenunterwäsche lag auf Nachttisch und Kommode verteilt.
„Schönen Abend gehabt?“, fragte sie trocken „Ja, es war ganz nett“, sagte ich grinsend und kam aus dem Bad, um sie zu umarmen. „Hallo, meine Süße“, sagte ich und drückte sie fest an mich. Sie roch nach Vanille und Orangen, weil sie fortwährend auf irgendwelchen Bonbons herum lutschte, seit sie das Rauchen aufgegeben hatte. Sie trug etwas zu enge Jeans und einen dicken weinroten Rollkragenpullover. Sie hatte lange dunkle Haare und das bezauberndste Lächeln, dass ich je bei einer Frau gesehen hatte. Wenn sie lächelte, hatte sie wunderhübsche Grübchen und ihre Augen leuchteten wie zwei Sterne. Ihr Gesicht schien von innen heraus zu leuchten und strahlte dabei so viel Wärme und Lebensfreude aus, dass man fast neidisch werden konnte.
Wir hatten uns vor vielen Jahren kennen gelernt, als wir beide einen Kurs für Französisch an der Volkshochschule besucht hatten. Die Sprache hatten wir nie richtig gelernt, dafür schwänzten wir bald regelmäßig den Unterricht und saßen stundenlang mit Milchkaffee, Keksen, Unmengen an Zigaretten und noch mehr Gesprächsstoff in meiner oder ihrer Küche. Eigentlich konnte ich mich kaum noch an ein Leben ohne Mara erinnern. Sie war ein fester Teil meines Lebens geworden, sie wusste mehr von mir, als irgendjemand sonst auf der Welt. Während der letzten Jahre war sie bei jeder großen und kleinen Katastrophe an meiner Seite gewesen. Seit Mara nun aber unsterblich in Tom verliebt war, war alles anders. Sie hatte das Rauchen aufgegeben, ging regelmäßig joggen und ernährte sich biologisch abbaubar, wie ich es ironisch nannte. Tom war Biologe und arbeitete für Greenpeace. Er hatte es geschafft, dass Mara sich innerhalb von drei Monaten total verändert hatte.
Auch wenn ich es mir selber, und ihr gegenüber schon gar nicht, eingestehen wollte; ich hatte Angst. Angst davor, sie mehr und mehr an Tom zu verlieren, Angst, dass ich in Zukunft wieder viel mehr Zeit mit mir alleine verbringen musste. Am meisten fürchtete ich mich aber insgeheim davor, dass ich vielleicht feststellen musste, dass mein Leben doch gar nicht so lustig, entspannt und unterhaltsam war, wie ich es mir selber immer einredete.
Ich schob die dunklen Gedanken energisch beiseite. Jetzt war sie hier und wir würden einen netten Samstag miteinander verbringen. Tom war irgendwo zu einem Kongress gefahren und heute würde einfach alles mal wieder so wie früher sein.
Mara sprühte förmlich vor Aufregung. „Ich muss dir so viel erzählen“, platzte es aus ihr heraus. „Was denn?“, fragte ich neugierig. „Nicht jetzt, später, wenn wir irgendwo einen Kaffee trinken, okay?“ „Ach“, seufzte sie und strahlte mich an, „du wirst dich so freuen.“
Mit dem Bus fuhren wir in die Innenstadt. Der Tag war grau, aber trocken und für November erstaunlich mild. Unzählige Autos und Menschen drängten sich bereits in den Straßen. Es roch nach Abgasen und Bratwurst. Gemütlich schlenderten wir durch die ersten Geschäfte auf der Suche nach DEM Kleid für den Silvesterball irgendwelcher Öko-Aktivisten in irgendeinem Hinterhof-Club. Ich schämte mich fast für meine bösartigen Gedanken, wusste ich doch, dass sie zum großen Teil daraus resultierten, dass ich ein wenig eifersüchtig war und nicht recht wusste, was ich Silvester ohne Mara machen sollte.
„Was ist eigentlich mit dir?“, fragte Mara plötzlich. „Was soll mit mir sein?“, fragte ich verständnislos und ließ die Finger über einen sündhaft teuren, todschicken Kaschmir-Pulli mit großem V-Ausschnitt gleiten. „Was machst du Silvester?“, fragte sie und nahm ein braunes Cocktailkleid näher in Augenschein. „Och“, sagte ich gedehnt, „vielleicht gehe ich irgendwo tanzen, ich werde mal eine Kollegin fragen.“ Mara sah mich prüfend an. Ich konnte vor ihr einfach nichts verbergen. „Du hast keine Kollegin, mit der du über mehr sprechen würdest, als über die Quartalszahlen“, konterte sie trocken. „Du kommst mit!“, sagte sie dann bestimmt. „Ich will nicht, dass du alleine irgendwo hingehen musst, oder zu Hause Trübsal bläst.“ „Ach, du kennst mich doch“, antwortete ich mit etwas gezwungener Fröhlichkeit, „ich hab doch auch alleine jede Menge Spaß.“„Ja, alleine mit irgendwelchen Typen, deren Namen du nicht einmal weißt, nachdem du mit ihnen geschlafen hast“, sagte sie und zog die Augenbrauen hoch. „Komm, ich probiere das jetzt an und du kommst Silvester mit. Tom hat wirklich nette Freunde. Wer weiß….“ Sie zwinkerte mir verschwörerisch zu. „Mara, ich will und brauche keinen Mann, schon gar keinen Greenpeace-Aktivisten. Das würde mir gerade noch fehlen“, protestierte ich heftig.
„Keine Widerrede“, sagte Mara und quetschte sich mitsamt drei Kleidern an mir vorbei in die Umkleidekabine. Ich hörte das Rascheln von Stoffen, dann ein entrüstetes Schnaufen.
„Das Licht hier drinnen ist unmöglich“, quengelte sie, „ich sehe aus, wie ein Monster, wie ein Speck-Monster mit Dellen. Das geht so nicht.“ Sie trat aus der Kabine heraus und ich musste lachen, auch wenn es mir im selben Moment leid tat. Das Kleid in dezentem Leberwurst-braun klebte an ihren runden Hüften und ließ wirklich die Assoziation einer Wurst in Eigenhaut zu. Ihre Haare standen elektrisiert in alle Richtungen ab. „Nein“, sagte ich trocken und unterdrückte ein hysterisches Kichern, „das geht so wirklich nicht.“ „Ich bin zu fett“, jaulte Mara auf. „Nein, du bist nicht fett, du hast weibliche Formen und dafür brauchst du das passende Kleid“, wiedersprach ich ihr energisch. „Du hast gut reden“, maulte Mara weiter. „Du bist ja auch groß und schlank, ich hab die Größe einer Parkuhr und die Ausmaße eines Walrosses.“ Ich lachte. „Du übertreibst maßlos“, tröstete ich sie. „Glaubst du wirklich, ich bin froh darüber, dass ich Schuhgröße 42 habe und eigentlich keinen BH tragen müsste, weil der liebe Gott bei mir eindeutig an der Oberweite gespart hat?“ Mara kicherte laut und drehte sich mit laszivem Hüftschwung in dem Leberwurst-Kleid vor dem Spiegel. Dann legte sie mir den Arm um die Schulter und lachte laut. „Wir sind die Schönsten“, rief sie und hakte sich bei mir ein. „Und damit Basta.“
Beladen mit Plastiktüten saßen wir drei Stunden später bei einem kuscheligen Italiener und bestellten Pasta, Pizza und Cola light. „Das Kleid ist wirklich wunderschön. Es ist wie für dich gemacht“, schwärmte ich. Wir hatten in einem kleinen Geschäft ein Kleid für Mara entdeckt, das wie maßgeschneidert saß. Die dunkelrote Farbe harmonisierte geradezu perfekt mit ihren braunen Haaren und ihrer hellen Haut.
Nachdem sie das Kleid gekauft hatte, schienen die Geschäfte plötzlich voller schöner Dinge zu sein, die nur darauf warteten, von uns entdeckt und gekauft zu werden. Mara erstand innerhalb von kurzer Zeit noch einen Pullover, Unterwäsche und dicke, kuschelige Stricksocken und ich entschied mich nach einigem Überlegen doch für den teuren, aber sehr schicken Kaschmir-Pullover aus dem ersten Geschäft. Mit großartiger Laune und um einige hundert Euro ärmer waren wir schließlich beim Italiener eingekehrt.
„Was wolltest du eigentlich vorhin erzählen?“, frage ich nun doch sehr neugierig. „Mmh“, machte Mara und schob sich noch ein großes Stück Pizza in den Mund. „Pass auf“, sagte sie mit vollem Mund, immer noch kauend. „Also, es ist etwas ganz Tolles. Rate doch mal. Da kommst du nie drauf.“ Ich sah sie entnervt an: „Warum soll ich dann raten? Nun sag schon.“ „Du bist ein Spielverderber“, maulte sie mit übertrieben beleidigter Miene, „wenn du geraten hättest, wäre es viel spannender geworden.“ „Jetzt erzähl es halt“, knurrte ich und spießte eine Tortellini auf die Gabel. „Ich bin schwanger“, platzte sie strahlend heraus. Mir verschlug es die Sprache. Ich verschluckte mich an den Tortellini und gleichzeitig fühlte ich mich, als wenn die Erde gerade ihre Rotationsrichtung gewechselt hätte. Um Fassung zu ringen, machte keinen Sinn. Man hatte mir schon oft gesagt, dass sich sämtliche Gefühle von meinem Gesicht ablesen ließen, wie aus einem offenen Buch. „Du bist was?“, stammelte ich völlig überrumpelt und starrte meine Freundin entsetzt an.
„S c h w a n g e r“, buchstabierte Mara geduldig und grinste, „das ist das mit den Bienen und den Blumen und ach ja, den Klapperstorch nicht zu vergessen.“ „Das kann doch nicht sein“, stieß ich gepresst hervor. „Ihr kennt Euch doch erst drei Monate, Mara, wie soll das denn gehen?“ „Also, dass es so ist, hab ich schwarz auf weiß und nun dazu wie das geht. Hättest du im Biounterricht nicht geschwänzt, müsstest du das eigentlich sehr genau wissen. Im Internet kannst du aber sicher eine Menge darüber nachlesen“, sagte sie süffisant grinsend.
Ich brachte kein Wort heraus, sondern starrte sie immer noch mit großen Augen an.
„Weißt du“, sagte sie plötzlich sehr sanft und sah mich mitfühlend an. „Ich glaube, dass du das, was ich dir jetzt sage, nicht gleich verstehen wirst. Aber ich werde versuchen es dir zu erklären und dann hoffe ich, dass du dich einfach für mich freust. Ich brauche dich. Du bist doch meine beste Freundin.“ Der letzte Satz klang fast wie eine Frage.
Ich fummelte fahrig an meinem Strohhalm herum. Verzweifelt versuchte ich, irgendwie das Chaos meiner Gefühle unter Kontrolle zu bekommen. Ich hatte plötzlich irrsinnige Angst um unsere Freundschaft. Dazu kam aufsteigende Panik. Alles würde sich verändern und am Ende würde ich vielleicht einsam und alleine zurück bleiben. Ich unterdrückte den Wunsch, hysterisch loszulachen. Warum musste ich eigentlich immer kichern, wenn mich eine Situation überforderte? Eine schreckliche Angewohnheit. Ich versuchte meine Gesichtszüge zu kontrollieren. Mara betrachtete mich nachdenklich.
„Als ich es bemerkt habe, stand ich zunächst einfach nur unter Schock“, sagte sie leise. „Es war nicht geplant. Sicherlich, ich wollte immer Kinder, aber doch nicht jetzt und nicht so schnell. Aber dann, weißt du Lana, es fühlt sich richtig an. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich das Gefühl habe, genau auf dem richtigen Weg zu sein. Es wird chaotisch, schwierig, neu, aber irgendwie weiß ich, dass es auch das Schönste sein wird, dass ich je erlebt habe.“ Mara klang atemlos. „Und Tom?“, frage ich trocken, „wie findet der das?“ Sie lächelte und sagte dann ruhiger: „Das ist ja das Schöne daran. Er sieht es genauso. Er war zunächst auch völlig durcheinander und dann hat er sich gefreut, richtig gefreut und er hat gesagt, dass es niemals den perfekten Zeitpunkt für ein Baby gibt, sondern, dass der perfekte Zeitpunkt immer der ist, wenn es passiert.“ Sie strahlte.
„Wir wollen zusammen ziehen, erst mal in seine Wohnung, die ist fürs erste groß genug und liegt eindeutig mehr im Grünen, als meine kleine Bude. Und dann werden wir uns einfach freuen und sehen, was passiert.“ Sie hielt kurz inne und sah mich unsicher an.
„Ach Lana, ich bin so glücklich, das erste Mal seit langer Zeit fühle ich mich richtig gut und hab keine Angst mehr, vor dem was kommt.“
Ich sah sie an und wusste einfach nicht was ich sagen sollte. Mir fielen tausend Dinge ein, die vernünftig waren, die Sinn machten, die sie überdenken sollte und doch sagte ich nichts von alle dem. Ein Blick in ihre Augen machte mich fast demütig und still. Was wusste ich von diesen Dingen? Was verstand ich wirklich von dem, was sie da sagte? Was davon konnte ich auch nur im Ansatz nachvollziehen? Nichts, musste ich mir eingestehen, gar nichts.
Seit der Trennung von Arndt vor gut zwei Jahren hatte ich nur an mich gedacht. Ich hatte viel gearbeitet, mir eine schicke Wohnung gekauft, war ausgegangen und hatte mich amüsiert. Dabei hatte ich immer darauf geachtet, dass mir niemand näher kam, als unbedingt nötig. Es hatte immer Männer gegeben, viele Männer, aber keiner von ihnen war bis zum Frühstück geblieben. Ich hatte mir einen Grundsatz auf die Fahne geschrieben, der Mara oft zum Kopfschütteln gebracht hatte: Wer mir nicht zu nahe kommt, kann mir nicht wehtun. Wer nicht da war, den kann ich nicht vermissen. Mara hatte damals alles mit mir durch-gestanden, die Heulkrämpfe, die Wutanfälle, die Trauer und die Verzweiflung, die mich immer wieder quälte. Sie war immer da gewesen. Sie hatte mich aufgebaut, mir zugehört, wenn ich zum hundertsten Male nach dem Warum fragte, oder einfach nur meinen Rücken gestreichelt, wenn ich wieder einmal hemmungslos geweint hatte. Irgendwann war es leichter geworden. Ich hatte meinen Platz gefunden, aber das Leben hatte mich härter werden lassen.
„Was wird nun aus mir werden?“, fragte ich mich und schämte mich zugleich für meinen Egoismus und den bitteren Gedanken, dass Mara bald bestimmt nicht mehr so viel Zeit für mich haben würde.
Sie durchschaute mich, das sah ich, als ich nun hoch schaute und ihren Blick auffing.
„Lana“, sagte sie leise, „ich würde so gerne sagen, dass zwischen uns alles bleibt, wie es immer war. Aber das wird es nicht, das Kind wird alles verändern, aber das ist nichts Schlechtes. Ich werde weiterhin immer für dich da sein, so gut ich kann. Ich will weiterhin deine allerbeste Freundin sein. Das Kleine wird eine Bereicherung sein. Vielleicht auch für dich, glaub mir.“
Ich straffte die Schultern und sagte dann etwas, wofür ich mich sofort hätte ohrfeigen können. Aber ich wollte irgendetwas sagen, dass sie verletzte, irgendetwas tun, damit doch noch alles wieder wie immer werden würde. Irgendetwas, das Mara dazu brachte, doch noch einmal alles zu überdenken und sich gegen das Kind zu entscheiden. Auch wenn ich tief in meinem Herzen wusste, dass nichts sie dazu bringen würde und auch nicht sollte. „Was ist, wenn es mit Tom nicht klappt? Ihr kennt euch doch kaum. Du weißt doch, wie Männer sind. Hast du darüber schon einmal nachgedacht? Was ist, wenn er dich in ein paar Monaten mit dem Gör sitzen lässt, was dann…?“ Ich beendete den Satz nicht, sondern starrte sie fast herausfordernd an.
Mara sah mich prüfend an und sagte dann gelassen: „Na und. Es gibt keine Garantien, für nichts auf der Welt bekommst du eine. Ich glaube nicht, dass dein Weg der ist, der uneingeschränkt glücklich macht. Für nichts und niemanden Verantwortung zu übernehmen, sein Herz an nichts mehr zu hängen, nur damit es nicht in Gefahr gerät, gebrochen zu werden. Hinter einer hohen Mauer hocken und nur ganz selten mal einen Blick darüber riskieren und sich dann schnell wieder zurückziehen. Mein Weg ist das nicht und er war es auch nie, Lana. Aber ich habe den deinen auch nie in Frage gestellt, sondern war immer glücklich und zufrieden, wenn du gesagt hast, dass du es bist. Das Gleiche hätte ich mir auch so sehr von dir gewünscht.“
„Lass uns jetzt besser gehen“, sagte sie dann hastig, „ich glaube, wir brauchen beide ein bisschen Zeit für uns.“ Sie winkte nach dem Kellner. Draußen auf der Straße umarmten wir uns schnell und sie sagte dann, mit erzwungener Fröhlichkeit: „Ruf mich morgen an. Dann besprechen wir auch die Silvesterfeier. Tschüss Süße.“ Dann ging sie schnell davon. Ich hatte sie tief verletzt, das wusste ich.
Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke nach oben und stapfte durch den einsetzenden Sprühregen. Die Welt war grau und trüb, genau wie meine Stimmung. „Mara hat unrecht mit dem, was sie sagt. Ich verkrieche mich nicht. Ich will so leben. Ich bin frei, Single und genieße meine Freiheit in vollen Zügen. Ich vermisse nichts“, redete ich lautlos auf mich ein. Eine Stimme in mir erhob sich, um leise Zweifel anzumelden, aber ich erstickte jeden weiteren Gedanken im Keim. Ich suchte nach einem Feuerzeug, zündete mir eine Zigarette an, inhalierte den Rauch tief in die Lunge und murmelte dann leise vor mich hin: „Du bist nur müde. Morgen fühlst du dich wieder besser. Schluss jetzt, Lana.“
Mit gesenktem Kopf trottete ich Richtung Bushaltestelle und war froh, mich in der Anonymität der Großstadt einfach verstecken zu können. Der feine Regen benetzte mein Gesicht, so dass ich mir selber einreden konnte, dass ich nicht weinte.
Am nächsten Morgen erwachte ich viel zu früh. Ich hatte den Abend zu Hause vor dem Fernseher verbracht, Unmengen an Schokolade in mich hineingestopft und mich selber bedauert und dabei schrecklich einsam und allein gelassen gefühlt.
Das Fernsehprogramm ließ zu wünschen übrig. Ich konnte mich nicht auf einen Film konzentrieren. Zu allem Überfluss gab es entweder schmalzige Liebesfilme, oder einen Actionfilm mit einem Helden ohne Hirn, dafür mit sehr vielen Muskeln. Entnervt schaltete ich den Fernseher aus. Zum Ausgehen fühlte ich mich zu müde und nicht in der richtigen Stimmung. Schon der Gedanke an eine überfüllte Bar ließ mich schaudern. Ich erkannte mich selbst kaum wieder an diesem Abend. So war ich, für mich völlig untypisch, schon kurz nach zehn unter die Bettdecke gekrochen und hatte mich in den Schlaf geheult. Irgendwie war alles durcheinander geraten. Ich fühlte mich wie der letzte Mensch auf Erden. Die sonst so angenehme Anonymität und meine schicke, blitzsaubere Wohnung hatten mich nicht getröstet, sondern mich noch mehr verzweifeln lassen. „Winterdepression, sonst gar nichts“, hatte ich laut zu mir selber gesagt, aber an diesem Abend störte es mich sogar, dass mir keiner antwortete und widersprach. Ein Zustand, der mich bisher immer zufrieden und glücklich gemacht hatte.
Ich öffnete mühsam die verquollenen Augen und warf einen Blick auf meinen Wecker. Kurz nach acht. „Herzlichen Glückwunsch Lana, das ist mal eine tolle Zeit, um an einem Sonntagmorgen aufzuwachen“, sage ich laut zu mir selber. Ein ewig langer grauer Tag lag vor mir und ich wusste nicht recht, was ich mit mir und der Zeit anfangen sollte. Vielleicht sollte ich Mara anrufen und ihr einfach sagen, dass es mir leid tat. Dass ich mich sehr für sie freute und dass ich immer für sie da sein würde, egal was die Zukunft bringen würde. Ich verwarf den Gedanken, ich konnte unmöglich an einem Sonntagmorgen um kurz nach acht bei ihr anrufen. Tom würde mich hassen und sie würde sich wundern. Früher, als Mara noch alleine gewesen war, hätte ich nicht eine Sekunde gezögert, aber seit Mara jedes Wochenende bei Tom wohnte, hatte sich so Einiges verändert.
Ich versuchte mich bequem hinzulegen, mich in die Decke einzukuscheln und wieder einzuschlafen, aber richtig wollte es mir einfach nicht gelingen. Unruhig warf ich mich hin und her. Ich schlief dann doch noch einmal kurz ein. Ich hatte einen irrsinnigen Traum von einer hochschwangeren Mara, die mir glücklich erzählte, dass sie Vierlinge erwartete und dass ich Taufpatin von allen vier Babys werden sollte. Außerdem bot sie mir strahlend an bei Tom und ihr einzuziehen, um als Babysitter immer zu Stelle zu sein. „Das würde mir gut tun und mein Leben ausfüllen“, behauptete sie und bat mich dann, Babysocken zu stricken. Völlig verwirrt erwachte ich kurze Zeit später wieder und schlug entschieden die Bettdecke zur Seite. Ich fühlte mich schrecklich, völlig zerschlagen und gleichzeitig zappelig. Ich stehe jetzt auf, trinke einen starken Kaffee und dann gehe ich irgendwo spazieren, entschied ich und rappelte mich schwerfällig auf.
Eine Stunde später stand ich dick eingepackt mit Schal und Daunenjacke vor meiner Wohnungstür. Ich brauchte dringend frische Luft, Bewegung und ein bisschen Tageslicht.
Mein Kopf tat mir weh. Während ich darüber nachdachte, wohin ich an diesem grauen Sonntagvormittag gehen könnte, fiel mir ein, dass ich mit Arndt immer gerne im Wald spazieren gegangen war. „Was mit diesem Mistkerl schön gewesen war, konnte doch alleine sogar noch viel schöner sein“, überlegte ich, während ich mich nach meinem Auto umsah. Wieso konnte ich mir eigentlich nie merken, wo ich geparkt hatte? Ich entschied mich dafür, an den südlichen Stadtrand zu fahren und ein bisschen durch den nebeligen November-Wald zu stapfen. „Danach fahre ich zur Sonnenbank und lasse mich durchwärmen. Ich bin ohnehin viel zu blass. Dann mache ich es mir mit einer großen Tasse Kaffee und einer Tüte Kekse auf der Couch bequem“, entschied ich und nickte zufrieden. Bis dahin wäre es bestimmt schon früher Nachmittag und ich konnte bei Mara anrufen und mich entschuldigen. Etwas entspannter und zufriedener startete ich meinen grünen Mini Cooper, den ich endlich entdeckt hatte, drehte die Musik auf und sang falsch und viel zu laut mit.
Ich erreichte den Parkplatz am Rande des Naherholungsgebietes. Er war fast leer, nur zwei Autos standen schon zu dieser frühen Zeit hier. Ein Mann versuchte gerade, seinen furchtbar dicken Hund davon zu überzeugen, in den Kofferraum seines Kleinwagens zu springen. Das gute Tier schaute immer wieder verzweifelt zwischen seinem erwartungsvollen Herrchen und dem geöffneten Kofferraum hin und her. Dann machte er einen beherzten Sprung in die Höhe, wurde aber durch seine Leibesfülle und die Erdanziehungskraft überlistet und landete recht unsanft mit dem Vorderteil im Wagen, während das dicke Gesäß des Hundes zwischen Auto und Waldboden hing. Das Herrchen packte nach dem Hinterteil des Prachtkerls und schob ihn recht unsanft in den Wagen. Der Hund schaute zum Steinerweichen und winselte leise. Ich musste hysterisch lachen. Der Mann sah mich irritiert an, als wäre ich nicht ganz zurechnungsfähig, verstaute den Rest des Tieres im kleinen Kofferraum und warf mit einem lauten Knall die Kofferraumklappe zu. Ein vernichtender Blick traf mich und ich musste noch heftiger kichern.
Ich warf einen kurzen Blick auf die Umgebungskarte, die an dem Parkplatz für Spaziergänger aufgestellt worden war. Ich entschied mich für eine kleine Runde durch den Wald, die ich früher auch schon öfter gegangen war und von der ich wusste, dass ich sie in einer Stunde gut bewältigen konnte. Ich stapfte los und genoss das Rascheln des Laubes unter meinen Füßen und die wundervolle Stille im Wald. Die Bäume hatten fast alle ihre Blätter verloren und der Wald sah mystisch aus im gedämpften Licht des grauen Winterhimmels.
Auf einem breiten Sandweg kamen mir zwei Reiter entgegen. Sie zügelten ihre Pferde und grüßten freundlich. Kurz nach dem sie mich passiert hatten, galoppierten sie wieder an und verschwanden gleich darauf hinter der nächsten Wegbiegung. Ich konnte ihre fröhlichen Stimmen hören, als die eine Reiterin der anderen etwas zurief.
Einen Augenblick sah ich ihnen gedankenverloren nach. Als junges Mädchen war ich auch vom Pferdevirus befallen, wie mein Vater es immer scherzhaft genannt hatte. Jede freie Minute hatte ich im Reitstall verbracht. Aber im Laufe der Zeit hatten andere Dinge immer mehr Zeit in Anspruch genommen und waren wichtiger geworden, so dass ich als Teenager die Reitkappe endgültig an den Nagel gehängt hatte. Seit dem hatte ich kaum noch ein Pferd aus der Nähe gesehen. „Schade eigentlich“, dachte ich. „Vielleicht sollte ich es mal wieder versuchen.“ Aber eigentlich hatte ich dafür sowieso keine Zeit. Ich schlenderte einen schmalen, verwunschenen Pfad durch den Wald abwärts in ein kleines Tal. Brauner Farn wuchs dicht am Weg, in den Spinnenweben dazwischen glitzerten Regentropfen. Obwohl ich krampfhaft versuchte, nicht daran zu denken, fiel mir doch wieder ein, wie es mit Arndt gewesen war. Wir waren häufig hier gewesen, hatten den schweren, erdigen Geruch eingeatmet. Wir hatten die Natur genossen, miteinander geredet oder einfach nur geschwiegen und den Vögel in den Baumwipfeln zugehört. Wir hatten Rehe am Waldrand beobachtet und waren einmal sogar auf Wildschweine getroffen. Diese Begegnung war zum Glück aber glimpflich ausgegangen, da die Rotte uns nicht bemerkt und wir schleunigst die Richtung gewechselt hatten.
Wir hatten den Wald beide sehr geliebt. Arndt hatte auch immer den Traum gehabt, irgendwann raus aus der Stadt aufs Land zu ziehen. Vielleicht ein eigenes Häuschen zu bauen und nur noch zum Arbeiten in die Stadt zu fahren. Ich wollte davon nichts wissen. Ich war glücklich in der Stadt mit den vielen Geschäften, den Clubs und den schicken Restaurants. Unsere Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war modern und geschmackvoll eingerichtet. Mir reichte am Wochenende hin und wieder ein Ausflug aufs Land. In meiner Lebensplanung gab es kein spießiges Einfamilienhaus im Grünen mit einem hübschen Jägerzaun drum herum. Ich wollte nicht irgendwo ankommen, wie viele meiner damaligen Freunde und Bekannten es so nett formulierten.
Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum er irgendwann immer mehr Zeit mit Lisa verbracht hatte. Sie war zum Anfang nur eine Kollegin gewesen. Als ich sie das erste Mal sah, war mir sofort ihre große Zahnlücke zwischen den beiden Schneidezähnen aufgefallen. Sie hatte ihr ein mädchenhaftes, süßes Aussehen verliehen. Ansonsten war an ihr nichts Besonderes, wie ich fand. Klein, schlank mit kurzem dunklem Haar war sie keine Frau, die ich als Konkurrentin für mich und meine Beziehung zu Arndt gesehen hätte. Sie war einfach nicht sein Typ, viel zu burschikos, eine Frau, die lieber mit Jeans und Wollpullis im Garten arbeitete, anstatt auf Partys oder Ausstellungen zu gehen. Sie sprach immer ein bisschen zu laut. Ich fand sie insgesamt etwas derb und nicht besonders attraktiv. Deshalb war ich auch erst ohne Sorgen und Bedenken, als die beiden immer häufiger gemeinsam auf Geschäftsreise gingen. Sie arbeiteten eben beide an demselben Projekt und ich war bestimmt keine Frau, die ihrem Freund eine Szene machte. Als ich hellhöriger und besorgter wurde, war es bereits viel zu spät. „Schluss jetzt“, sagte ich laut zu mir. „Darüber werde ich jetzt nicht mehr nachdenken, das Thema ist beendet und vergessen. Und ich bin froh darüber. Es geht mir besser ohne ihn. Er ist ein mieser Arsch!“ Meine Stimme klang hohl und viel zu laut in dem stillen Wald. Verstohlen sah ich mich um, ob nicht jemand in der Nähe war, der meinen Selbstgesprächen lauschte. „Ich hab mir das richtig angewöhnt“, schalt ich mich, „ständig rede ich mit mir selber. Verdammt, Lana hör auf damit.“ Ich begann beherzt einen Pfad auf einen kleinen Hügel hinaufzusteigen, der mich durch das dichte Unterholz zurück auf den Hauptweg führen würde. Ich schnaufte etwas beim Anstieg und in der kühlen feuchten Luft konnte ich meinen Atem als kleine Wolken vor mir aufsteigen sehen. „Verdammte Qualmerei, kurzatmig wird man davon“, murmelte ich finster vor mich hin. Die Bäume standen hier sehr dicht und Farn und Gestrüpp wucherte über den gewundenen, an vielen Stellen matschigen und glitschigen Pfad. Der Nebel hatte sich verdichtet und die Feuchtigkeit kroch mir unter die Jacke. Ich stapfte energisch weiter und kämpfte eine seltsame, aufkommende Panik nieder. Ich kannte den Weg, auch im dichtesten Nebel würde ich sicher zum breiten Hauptweg zurückfinden. Dieser führte dann direkt zum Parkplatz und zu meinem hübschen, kleinen Auto. Ich holte tief Luft. Es wurde immer dunkler und grauer, der Nebel umgab mich wie eine wabernde Masse. Meine Haare kringelten sich in der Feuchtigkeit. Die Bäume konnte ich nur noch als Silhouetten wahrnehmen, die ihre kahlen Äste in den dunstigen Himmel streckten, wie knöchrige Arme. Ich begann unwillkürlich zu zittern. Plötzlich sah ich einen Schatten vor mir, er huschte kaum zwei Meter vor mir über den Pfad. Ich hörte mich selber erschrocken aufschreien. Der Schatten tauchte wieder zwischen dem Farn auf. Er erinnerte mich entfernt an einen großen Hund. Wo war der Besitzer dazu? Verdammt, konnte er das Tier nicht anleinen? Ich wollte etwas rufen, doch ich brachte nur ein Krächzen hervor. Der Schatten huschte abermals an mir vorbei, diesmal direkt vor meinen Füßen. Meine überreizten Nerven schlugen Alarm. Das Tier hatte eindeutig graues Fell. Ein Wolf?
„Ruhig Lana, es gibt keine Wölfe im Hamburger Umland“, murmelte ich. Der Nebel verschluckte meine Worte und ich konnte kaum noch die Hand vor Augen sehen.
„Ruhig bleiben Lana. Die Feuchtigkeit hat sich im Tal gesammelt, deshalb ist der Nebel hier so dicht, gleich bist du wieder auf der Anhöhe“, versuchte ich mir verzweifelt selber Mut zuzusprechen. Meine Stimme klang dünn und zittrig. Die Nebel senkten sich, wie ein graues Tuch über mich. Ich konnte den Weg mittlerweile nicht mehr erkennen, tappte wie eine Blinde durch das Unterholz, blieb mit dem Fuß an irgendetwas hängen und fiel hin. Ich rappelte mich auf, matschig und nass und mittlerweile völlig panisch. Dann sah ich wieder den Schatten des Tieres, direkt vor mir. Es sah nun verdammt realistisch nach Wolf aus. „Hilfe“, hauchte ich nur und dann stolperte ich über eine Baumwurzel. Wieder fiel ich der Länge nach auf den erdig riechenden Waldboden, meine Hände krallten sich in die bunt gefärbten, feuchten Blätter und der Nebel sank auf mich herab wie eine feuchte, kalte Decke. Meine Zähne begannen zu klappern. Alles drehte sich. Das Letzte, was ich hörte, war der klagende Ruf eines Tieres. Es war eindeutig das Heulen eines Wolfes.