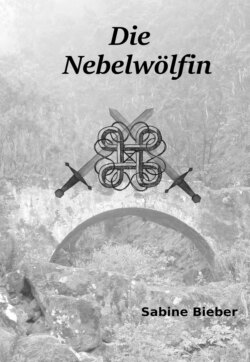Читать книгу Die Nebelwölfin - Sabine Bieber - Страница 7
Kapitel 4
ОглавлениеIrgendetwas war schief gegangen und ich war im offenen Meer gelandet. Es rauschte in meinen Ohren und selbst in der Trance, in der ich mich befand, merkte ich, dass meine Kleidung nass und schwer war. Da waren schmatzende Geräusche. Wahrscheinlich würde ich im nächsten Moment von einem riesigen Hai verspeist werden. Völlig bewegungsunfähig wartete ich auf den Todesstoß. „Seit wann schmatzen Haie?“, schoss es mir völlig zusammenhangslos durch den Kopf. Dann sprach jemand. Die Worte hörte ich, aber sie gaben irgendwie keinen Sinn. Ich versuchte den Kopf zu drehen, aber irgendwas nahm mir den Atem, ich schmeckte feuchte Erde und es knirschte zwischen meinen Zähnen. Ich fühlte, wie ich hochgezogen wurde und schlug mühsam die Augen auf, sie waren völlig verklebt.
Irgendwas stimmte nicht mit der Perspektive. Direkt vor meinen Augen tauchte immer wieder ein Kopf auf und von irgendwo her kam eine Stimme. Ich war nicht tot und einen Hai konnte ich in meinem begrenzten Gesichtsfeld auch nicht ausmachen.
„Hallo“, sagte die Stimme wieder und dann noch ein reichlich verdutztes: „Oh, dich habe ich doch schon mal irgendwo gesehen.“ Langsam klarte sich die Welt um mich herum wieder etwas auf. Da ich atmen konnte, war die Theorie mit dem Meer nicht länger haltbar und ich versuchte, mich aufzurichten und zu orientieren. Ich saß auf feuchtem Waldboden, gleich neben mir war eine sehr große, schlammig braune Pfütze. Meine Kleidung klebte mir feucht am Körper und so kam ich zu der Schlussfolgerung, dass ich bis eben in dieser Pfütze gelegen hatte, und zwar, so wie es aussah, mit dem Gesicht voran. Ich rieb mir mit den dreckigen Händen den Schlamm aus den Augen. Die schmatzenden Geräusche wurden von einem riesigen Pferd verursacht, das ganz in meiner Nähe an einen Baum angebunden war und etwas aufgeregt auf dem nassen Boden hin und her stampfte. Und dann tauchte wieder das Gesicht in meinem Blickfeld auf. Ich hätte es unter tausenden erkannt, auch wenn ich es bisher nur einmal kurz gesehen hatte. Der Mann, der mir am Strand aufgefallen war. Dornat.
„Ich habe es geschafft“, stieß ich knirschend hervor, dann wurde ich ohnmächtig.
„Geht es wieder?“, fragte er. Seine Stimme klang jetzt ehrlich besorgt. „Prima“, sagte ich und versuchte zu grinsen. Ich wollte mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich aussah. Ein Blick auf meine schlammverschmierte Kleidung ließ mich erahnen, wie ich im Gesicht aussehen musste. Aus meinen Haaren liefen kleine braune Rinnsale auf meine Jacke.
„Wie hast du mich denn gefunden?“, fragte ich und der Sand knirschte beim Sprechen zwischen meinen Zähnen. „Oh“, sagte er, und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. „Du warst eigentlich nicht zu übersehen. Es kommt nicht so häufig vor, dass Menschen mitten auf dem Weg bäuchlings im Schlamm liegen. Chiara hat dich zuerst entdeckt.“ Er wies mit der Hand auf die Stute, die immer noch am Baum angebunden war. Sie war gar nicht so riesig, wie ich zunächst geglaubt hatte. Nun wo ich aufrecht saß, sah sie aus, wie ein normales braunes Pferd.
„Kannst du mich zu Faolane bringen?“, fragte ich unsicher. „Klar“, sagte er und lächelte mich freundlich an. Normalerweise hätte ich mich wohl gewundert, dass er keine Fragen stellte. Er fragte nicht, wer ich war, wie ich hieß und wo ich herkam. Aber im Grunde wunderte mich im Moment gar nichts mehr. Ich hatte es nach Salandor geschafft und das war zunächst einmal alles, was zählte.
„Kannst du stehen?“, fragte er und reichte mir die Hand. Ich nickte stumm. „Bis zur Siedlung sind es wohl gute zehn Meilen. Meinst du, du kannst dich hinter mir auf dem Pferd halten?“ Er sah mich etwas zweifelnd an. „Ähm, ich denke schon“, sagte ich vorsichtig, „aber ist das nicht zu schwer, ich meine wegen des Rucksacks?“ Ich sah zweifelnd zwischen ihm und der Stute hin und her. Die Vorstellung, völlig schlammbeschmiert an einen irrsinnig attraktiven Mann geklammert auf einem Pferderücken herumzuhopsen, war mir nicht besonders sympathisch. Selbst gute fünfzehn Kilometer Fußweg schienen mir da noch die bessere Alternative. Er grinste schief und sagte dann betont lässig: „Ach, das schafft sie schon. Dann gibt es heute Abend eben etwas mehr Hafer.“ Er tätschelte der Stute den Hals und ich war mir zu hundert Prozent sicher, dass er merkte, wie unheimlich mir das Ganze war.
Er führte die Stute an einen Baumstumpf und schwang sich dann leichtfüßig in den Sattel. Danach bedeuteter er mir, dass ich auf den Baumstamm klettern und dann hinter ihm auf die Stute steigen sollte. Was im Film immer unheimlich leicht aussah, war in Wirklichkeit erniedrigend und albern. Ich hievte mich irgendwie hinter ihm auf das Pferd, das zum Glück wie eine Statue stand. Bevor ich zur anderen Seite wieder hinunter rutschen konnte, half er mir und schließlich schaffte ich es, irgendwie einigermaßen aufrecht hinter ihm zu sitzen. Schweiß lief mir über die Stirn. Ich versuchte mich nicht an ihm fest zu klammern, aber nach den ersten Schritten von Chiara gab ich auf. Ich konnte das Grinsen auf seinem Gesicht förmlich vor mir sehen, auch wenn er mir nun den Rücken zu wandte. „Ich bin Dornat“, stellte er sich nun endlich offiziell vor. „Du musst Lana sein, oder?“ „Woher weißt du denn meinen Namen?“, fragte ich und meine Stimme krächzte. Waren die Leute hier auch noch hellsichtig? Er hatte sich ja vorhin auch nicht darüber gewundert, dass ich zu Faolane wollte.
„Faolane hat dich angekündigt“, sagte er locker, als wäre es das Normalste der Welt, dass sie meine Ankunft voraus sah, bevor ich selber wusste, dass ich kommen würde.
Ich sagte nichts, sondern konzentrierte mich darauf, mich dem Rhythmus des Pferdes anzupassen. Wir ritten auf einem breiten Sandweg durch einen sommerlich grünen Wald, das Laub der Bäume war dicht und bildete ein grünes Dach über uns. Farn wucherte überall entlang des Weges. Der Weg verengte sich ein wenig und meine Beine streiften Hecken, an denen wilde Brombeeren wuchsen. Irgendwo plätscherte Wasser. Ich versuchte entspannter zu atmen und lockerte meinen Griff um Dornats Körper etwas. Der Wald wurde lichter, der Weg verlor sich auf einer großen Wiese voller Sommerblumen, auf der linken Seite glitzerte ein See in der warmen Sonne. „So muss das Paradies aussehen“, fuhr es mir durch den Kopf. Ich blinzelte in der Helligkeit. Leider war es mir nicht vergönnt den Ausblick noch länger zu genießen, denn Dornat sagte: „Festhalten, Lana“, und Chiara galoppierte an. Ich versuchte mich verzweifelt an meine Reitstunden zu erinnern, aber letztendlich blieb mir nichts anderes übrig, als mich wieder fest an ihn zu klammern. Ich fühlte seinen muskulösen Körper durch das dünne Leinenhemd und beschloss, an nichts anderes mehr zu denken, als daran, gleichmäßig weiter zu atmen und nicht vom Pferd zu fallen. Die Stute galoppierte trotz der Doppelbelastung gleichmäßig über die Wiese. Mir war unsagbar warm, es mussten mindestens zwanzig Grad sein und ich trug immer noch meine verdreckte Winterjacke. Später zügelte Dornat die Stute und ich löste meinen Griff ein wenig von seinem Körper. „Danke“, sagte er leicht zynisch, „nun bekomme ich auch wieder Luft.“ Ich wurde rot und war froh, dass er mich nicht sehen konnte.
Die Landschaft um uns herum hatte sich verändert. Den Wald hatten wir weit hinter uns gelassen und die Stute schritt nun über sanfte grüne Hügel. In der Ferne konnte man schroffe Berge erkennen. Dieses Panorama hatte ich noch von meinem letzten Ausflug in Erinnerung.
Ein Fluss durchzog den flachen Teil der Ebene. Ich roch den Duft von Gras, Blumen und Sommer und schloss kurz die Augen. Es war alles viel zu schön, viel zu phantastisch, um wirklich wahr zu sein. Wir ritten schweigend und ich war froh, dass Dornat nicht viel sagte oder fragte. Was hätte ich ihm auch antworten können? Was wusste er über mich? Aber eine Frage brannte mir doch unter den Nägeln. Als ich nach einiger Zeit Hütten in der Ferne ausmachen konnte, räusperte ich mich und fragte etwas verlegen: „Faolane, sie erwartet mich, hast du gesagt. Stimmt das, wusste sie, dass ich kommen werde? Woher?“
Er zügelte die Stute und wandte sich halb zu mir um. Unsere Blicke trafen sich. Seine Augen waren dunkelbraun, fast schwarz und sahen mich durchdringend an. Dann sagte er leise:
„Hier gelten andere Regeln. Versuch einfach, alles zu vergessen, was du über Vernunft und Dinge, die sein können, die realistisch sind, je gehört hast. Sie erwartet dich schon lange und hat schon lange gewusst, dass du kommen wirst.“
Ich wollte den Mund aufmachen und etwas sagen, klappte ihn aber tonlos wieder zu. Er fixierte mich weiter mit seinen Augen. „Stell keine Fragen. Nicht mir“, fuhr er leise fort. „Sie wird dir alles sagen und zeigen, was du wissen musst.“
Damit wand er sich ab und gab der Stute wieder die Sporen. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig an ihm festklammern, um nicht herunter zu fallen. Meine Gedanken kreisten um seine eigenartige Antwort, doch dann benötigte ich alle Konzentration, um mich auf Chiara zu halten. So begnügte ich mich damit, den Geruch von Sommer, Wind und Pferd einzuatmen. Mein Herz wurde ganz leicht und jubelte: „Zu Hause, zu Hause.“ Ich wunderte mich nicht mehr darüber.
Er zügelte die Stute vor einer Hütte, die ich sofort wieder erkannte. Mühsam kletterte ich vom Pferd und landete prompt auf dem Hinterteil. Es gab keinen Knochen in meinem Körper, der mir nicht wehtat. „Alles okay?“, erkundigte er sich fürsorglich, aber ich konnte das Blitzen in seinen Augen sehen und sein Mund zuckte. Wahrscheinlich stand er kurz davor, einen Lachkrampf zu bekommen. „Danke“, sagte ich, rappelte mich auf und versuchte dabei so würdevoll wie eben möglich auszusehen.
„Na dann, bis bald“, sagte er knapp, wendete Chiara und galoppierte davon. „Bis bald“, sagte ich leise und wand mich zu der Hütte um. Da stand sie, genauso, wie ich sie in Erinnerung gehabt hatte. Das lange graue Haar zu einem losen Zopf geflochten, eingehüllt in ein helles Leinenkleid, das von einem schmalen Band gehalten wurde und ihre Augen leuchteten in der Farbe von Bernsteinen.
„Willkommen zu Hause“, sagte sie leise. Ihre Stimme war so weich wie Samt. Ich konnte nicht anders. Ich machte drei Schritte auf sie zu und sank schluchzend in ihre Arme.
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich weinte. Es schien, als wären Tore geöffnet worden, als würden all die ungeweinten Tränen der letzten Jahre aus mir heraus fließen und ich konnte nichts dagegen tun. Jegliche Selbstbeherrschung war mir abhanden gekommen. Ich weinte und weinte, bis ich selbst zum Schluchzen zu müde war. Sie hielt mich einfach nur im Arm, strich mir mit federleichter Hand über das Haar und schwieg. Irgendwann war ich völlig erschöpft, mein Körper fühlte sich bleischwer an. Ich ließ mich willenlos von ihr in die Hütte führen. Dort stand an der Wand ein einfaches, aus Holz gezimmertes Bett mit einer strohgefüllten Matratze. Felle und eine ungefärbte Wolldecke waren darauf übereinander gestapelt. Immer noch wortlos half sie mir, die völlig verdreckte Kleidung auszuziehen. Dann sank ich auf das Bett. Sie deckte mich sorgfältig zu, hielt meine Hand und begann leise zu singen. Ihre Stimme klang wie flüssiges Gold. Es waren Worte, die ich nicht verstand, in einer Sprache, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Während ich sanft in Dunkelheit hinüber glitt, meinte ich, den klagenden Ruf eines Wolfes zu hören.
Ich erwachte völlig orientierungslos, setzte mich schwerfällig auf und schaute mich um. Meine Sinne brauchten eine ganze Zeit, bis ich realisierte, wo ich war und was geschehen war.
Wie lange hatte ich geschlafen? Wie viel Zeit war seit meiner Ankunft vergangen? Ich war alleine in der kleinen Hütte und nachdem ich die letzte Benommenheit des Schlafes abgeschüttelt hatte, fühlte ich mich wirklich gut und ausgeruht. Interessiert sah ich mich um.
Die Hütte war weiß getüncht und das Dach mit Stroh gedeckt. In der Mitte des einzigen Raumes war eine Feuerstelle, über der ein gusseiserner Topf an einer Kette hing. In einer Ecke des Raumes waren auf einem kleinen Tisch und einem Regal verschiedene Gefäße aus Ton, sorgfältig der Größe nach sortiert, aufgestellt. Kräuter und Pflanzen hingen in getrockneten Bündeln und Büscheln an der Wand und an der Decke. In einer anderen Ecke gab es einen großen Holztisch, an dem vier einfache Stühle standen. Außerdem befanden sich noch ein kleiner Schrank, eine hölzerne Truhe und das Bett, in dem ich lag, im Raum. Alles war einfach, aus Holz, Stein oder Lehm, aber die Hütte war urgemütlich und kuschelig.
Die einzige Tür war aus Holz und bereits etwas wurmstichig. Durch die winzigen, unverglasten Fenster fiel nur wenig Licht in den Raum. Als ich aufstehen wollte, wurde ich sehr schmerzhaft daran erinnert, dass mein Körper es nicht gewohnt war, auf einem Pferderücken hin und her geschüttelt zu werden. Es war schwierig, ein Körperteil zu finden, das nicht schmerzte. Mühsam zog ich mich auf die Füße und humpelte zum Ausgang der Hütte. Ich steckte den Kopf hinaus und die Sonne kitzelte mein Gesicht. Vor der Hütte standen die vertraute Bank aus Holz und ein ebenso knorriger Tisch. Auch hier war eine Feuerstelle, die noch rauchte. Das Feuer konnte noch nicht lange gelöscht sein. Ich sah mich um und entdeckte in der Nähe der Hütten einen kleinen Pferch in dem einige Schafe untergebracht waren. Dösend standen sie in der warmen Sonne und verscheuchten träge die Fliegen, die sie umschwirrten. Eine hübsche rote Katze lief über den festgetretenen Sandboden und hielt kurz inne, um mich interessiert anzusehen. Ich blinzelte, meine Augen hatten sich noch nicht an die Helligkeit gewöhnt und wandte vorsichtig den Kopf, um heraus zu finden, woher das Hufgeklapper kam, das ich gerade gehört hatte. Am anderen Ende der kleinen Hüttenansammlung konnte ich drei Pferde erkennen. Ihre Reiter schwatzten laut und lachten. Einer von ihnen mochte Dornat sein, auf die Entfernung konnte ich es aber nicht genau erkennen.
Schnell zog ich mich wieder in die Hütte zurück. Ich war noch nicht bereit, irgendjemandem gegenüber zu treten, auch wenn ich mir über Fragen, auf die ich keine Antwort geben konnte, langsam keine Gedanken mehr machte. Irgendwie schien jeder hier darauf gewartet zu haben, dass ich kam, oder es war völlig normal, dass wildfremde Menschen einfach irgendwo unvermittelt auftauchten.
In der Hütte atmete ich tief durch, die Lehmwände und die kühle Dunkelheit gaben mir ein tröstliches Gefühl von Sicherheit. Ich ließ mich auf einen der Stühle plumpsen und mein Magen knurrte laut und vernehmlich. Ich strich mir die Haare zurück. Sie waren fürchterlich verklebt und ich konnte mir langsam vorstellen, wie ich aussah. Ich musste mich waschen, etwas essen und dann…ja, was eigentlich dann?
Bevor ich in trübe Gedanken verfallen konnte, vernahm ich Geräusche vor der Hütte. Ich hörte Faolanes weiche Stimme und die Stimme einer Frau, die wie ein fröhliches Zwitschern klang.
Die Tür quietschte in den Angeln und die beiden traten ein. Sonnenstrahlen fielen auf den fest gestampften Lehmboden. Faolane lächelte mich an und sagte mit freundlicher Stimme: „Oh, du bist schon wach. Wunderbar! Geht es dir gut?“ Ihre Augen strahlten und wie immer durchrieselte mich ein warmer Schauer, wenn ich sie ansah. „Das ist Kibira“, stellte sie mir die junge Frau vor, die neben ihr stand und mich mit freundlicher Neugier musterte. Sie war klein, dunkel und etwas stämmig. Vom Alter her schätzte ich sie auf ungefähr fünfundzwanzig Jahre. In einem Tuch trug sie ein Baby, das höchstens ein paar Tage alt sein konnte.
„Ich habe heute Morgen alle Hände voll zu tun“, sagte Faolane weiter, „aber Kibira wird dir zeigen, wo du dich waschen kannst und dich ein bisschen herumführen. Ein paar Dinge kennst du ja noch von damals. Heute Nachmittag kommen die ersten Erntewagen von den Feldern zurück, da wird dann jede Hand gebraucht.“ Ich sah sie unsicher an. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie körperlich gearbeitet und konnte mir nicht vorstellen, wie ich wohl für die Ernte oder die Entladung der Wagen nützlich sein könnte. Scheinbar schien sie aber einfach davon auszugehen, dass ich nun einmal hier war, dazu gehörte und somit auch mit arbeiten würde. Ich war verdutzt über so viel Selbstverständlichkeit aber begann, doch gleichzeitig mich daran zu gewöhnen und es zu genießen.
Kibira kam auf mich zu, drückte mir herzlich die Hand und sagte mit einer Stimme, die mich immer mehr an einen fröhlichen großen Vogel erinnerte: „Herzlichen Willkommen Lana, schön, dass du da bist. Das ist Connor.“ Sie wies auf das Baby. Der Kleine hatte himmelblaue Augen und schaute mich interessiert an. Dann grunzte er leise und schlief wieder ein. „Du musst hungrig sein“, zwitscherte sie weiter. „Wir machen jetzt erst mal etwas zu essen und danach gehen wir zum Fluss, damit du dich richtig waschen kannst.“ Faolane nickte mir aufmunternd zu und verabschiedete sich dann von uns. Etwas hilflos sah ich ihr hinterher.
Kibira machte kein großes Aufhebens um mich und meine Person, sie fragte auch nichts, sondern machte sich an der Truhe zu schaffen, stellte einen Laib Brot, Käse und etwas Obst auf den Holztisch, dazu zauberte sie noch kleine braune Kuchen und Milch von irgendwo her. „Ein Königreich für einen Kaffee“, dachte ich und schenkte mir aus dem tönernen Krug Milch in einen Becher. Während ich aß, merkte ich erst, wie hungrig ich wirklich war. Wann hatte ich das letzte Mal gegessen? War ich wirklich erst ein paar Stunden hier? Kibira nahm sich einen weiteren braunen Kuchen und biss genüsslich hinein. Sie verdrehte die Augen und seufzte: „So werde ich die Pfunde von Connors Geburt nie wieder los, aber es schmeckt einfach zu gut.“ Sie zwinkerte mir zu und erinnerte mich plötzlich an Mara. Ein schmerzhafter Stich durchfuhr mich, ich vermisste sie schon jetzt schrecklich.
Mir fiel ein, dass ich ja noch ihr Abschiedsgeschenk in meinem Rucksack hatte. Sobald ich wieder alleine war, würde ich mir Zeit nehmen und es in Ruhe auspacken. Suchend blickte ich mich um und entdeckte meinen Rucksack in der Ecke der Hütte neben dem Bett. Irgendwie beruhigte es mich, dass ein Teil meines alten Lebens hier war. Nach dem Essen bekam ich gewaltige Lust auf eine Zigarette, aber irgendwie kam es mir komisch vor, mich in dieser Umgebung mit einem Glimmstängel vor die Hütte zu setzen. Außerdem, wenn ich hierbleiben wollte, musste ich ohnehin über kurz oder lang ohne Zigaretten auskommen. Einen Automaten würde ich hier wohl vergeblich suchen. Ich kicherte kurz nervös, bei dem Gedanken. Kibira sah mich fragend an, sagte aber nichts. Connor quengelte leise und sie löste einen Knoten an ihrer Tunika und legte den Kleinen an ihre Brust. Dann lächelte sie mich an und seufzte zufrieden. „Er ist erst sieben Tage auf der Welt und doch könnte ich mir nicht vorstellen, ohne ihn zu sein“, sagte sie und betrachtete ihren Sohn zärtlich.
Ich beobachtete die Szene schweigend. Der trinkende Säugling hatte eine beruhigende Wirkung auf mich und ich fühlte mich nach dem Essen schon wieder müde und schwer. Ich gähnte herzhaft und Kibira sagte, als wenn es das Normalste der Welt wäre: „Die Reise hierher schlaucht, die nächsten Tage wirst du wahrscheinlich viel schlafen, aber das geht vorbei.“ Ich sah sie fragend an und als sie nicht weiter sprach, fragte ich vorsichtig: „Bist du auch hierhergekommen, also aus, äh von, hmm...“ Ich verstummte. Woher kam ich eigentlich? War das noch dieselbe Welt, die ich kannte? War es ein Sprung in eine andere Dimension, waren es nur parallele Welten und man konnte einfach hin und her laufen, wie es einem gefiel? Irritiert schüttelte ich den Kopf. Die Gedanken waren eindeutig zu kompliziert für meinen Zustand. Kibira lachte hell. „Nein“, sagte sie, „ich bin hier geboren, aber es verirren sich immer mal wieder Reisende hierher, einige bleiben, einige gehen wieder, aber in der letzten Zeit sind es wenige geworden. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, dass jemand die Reise hierher zweimal angetreten hat.“ Sie verstummte abrupt und ihr Gesicht wurde mit einem mal sehr ernst. „Faolane wird dir das sicher alles irgendwann erklären, sie weiß mehr als wir alle über das Reisen. Aber noch ist es zu früh. Gib dir etwas Zeit.“ Ich machte den Mund auf und klappte ihn dann wieder zu. Ein Blick in ihr Gesicht sagte mir, dass sie nicht bereit war, weiter mit mir über dieses Thema zu reden. Sie sah plötzlich verschlossen, fast ängstlich aus.
Connor schien satt zu sein und sie wickelte ihn zurück in ihr Tuch. „So“, sagte sie ein wenig zu laut und zu fröhlich, als wenn sie damit finstere Gedanken vertreiben wollte, „nun sollten wir dafür sorgen, dass du nicht länger herum laufen musst, wie ein Erdferkel.“ Sie griff mit der Hand nach meinen schlammverklebten Haaren. „Vielleicht kannst du mir ja auf dem Weg zum Fluss erklären, wieso du den Kopf in ein Matschloch getunkt hast.“ Sie grinste breit und die eigenartig bedrückte Stimmung war verflogen.
In diesem Augenblick traf ich eine Entscheidung. Ich wollte wissen, warum ich hier war, woher ich kam. Ich wollte wissen, warum sich niemand darüber wunderte, dass ich einfach da war und ich wollte auch verstehen, warum mich dieser Ort so magisch angezogen hatte, aber ich wollte es nicht jetzt. Entgegen all meiner sonstigen Ungeduld, diesmal wollte ich mir Zeit nehmen und das genießen, wonach ich mich all die Zeit gesehnt hatte und was mir hier plötzlich zum Greifen nah erschien. Eine große Ruhe breitete sich in mir aus und ich atmete tief die süße Sommerluft ein.
Wir gingen gemächlich durch das kleine Dorf, das wie ausgestorben da lag. Barfuß schlenderten wir über die Wiesen zum Fluss, in dem ich schon das erste Mal gebadet hatte. Ich trug ein Bündel mit frischer Kleidung, die Faolane für mich bereit gelegt hatte, außerdem hatte ich ein paar einfache Sandalen dabei, die ich in meinem Rucksack mitgebracht hatte. Ich konnte auf keinen Fall zu einer Leinen-Tunika meine derben Trekking-Schuhe tragen. Hier gingen alle barfuß, oder trugen schmale Ledersandalen. Meine pedikürten Füße waren aber nicht besonders gut dazu geeignet barfuß über Sandboden mit Steinen zu laufen und so entschied ich, mir diesen kleinen Luxus weiterhin zu gönnen. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich in kürzester Zeit mit schmerzverzerrtem Gesicht hinter Kibira her gehüpft, die trotz des Babys in ihrem Tuch kräftig ausschritt.
Die Sonne schien warm und nach ihrem Stand zu urteilen, schien es bereits Mittag zu sein. Galt hier die gleiche Zeit, die ich kannte? Wie, als wenn ich meine Frage laut ausgesprochen hatte, sagte Kibira: „Wenn wir zurück sind, kommen sicherlich auch die anderen bald zurück. Im Moment holen wir Heu ein und fast alle arbeiten gemeinsam bis zum Nachmittag auf den Feldern. Außer ein paar Männer, die heute Morgen zunächst die Zäune der abgelegenen Weiden kontrolliert haben, sind alle mit der Ernte beschäftigt.“ „Und dein Mann, wo ist der?“, fragte ich neugierig. Sie grinste. „Torge, er würde alles tun, um nur nicht auf dem Feld helfen zu müssen. Die Gelegenheit, mit Dornat ein bisschen durch Feld und Wald zu reiten, lässt er sich nicht entgehen. Wahrscheinlich haben sie es nicht gerade eilig.“ Sie grinste wieder, diesmal etwas schief und mit einem Blick auf das Baby, sagte sie: „Männer! Hoffentlich hat er DAS nicht von seinem Vater geerbt. Ein bisschen Hilfe zu Hause wäre manchmal schön.“ Sie seufzte. Ich lächelte bei dem Gedanken, dass es hier scheinbar die gleichen Probleme gab wie in meiner Welt. Meine Welt, war das noch meine Welt? Entschieden schob ich den Gedanken weg.
Wir hatten den Fluss erreicht und Kibira zog sich aus und legte Ihre Sachen sorgfältig unter einen Baum. Darauf bettete sie behutsam den kleinen Connor, der zufrieden schlief. Ich schaute mich unsicher um, es war für mich nicht normal, splitterfasernackt über eine Wiese zum Fluss zu laufen. Da aber Kibira mit größter Selbstverständlichkeit nackt zum Fluss ging, entledigte ich mich schnell meiner Kleidung und beeilte mich, ins Wasser zu steigen. Während wir uns gründlich wuschen und das kühle Wasser auf der Haut genossen, fragte Kibira: „Wo bist du denn angekommen?“ Ich lächelte unsicher. „Beim ersten Mal auf den Hügeln, die hinter dem Dorf liegen und dieses Mal, naja….“ Ich wand mich verlegen und sagte dann schnell: „In einer Matschkuhle irgendwo dahinten im Wald.“ Ich wies mit dem Finger vage in die Richtung. „Oh, da musstest du ja doch einige Zeit zu Fuß bis zum Dorf gehen“, sagte Kibira mitfühlend. „Nein“, sagte ich und verzog das Gesicht. „Dornat hat mich gefunden und freundlicherweise mitgenommen.“ Kibira konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. „Er hat dich aus einer Matschkuhle gezogen und du bist so mit ihm zurück ins Dorf geritten? Die ganze Strecke hinter ihm auf dem Pferd?“, fragte sie und um ihren Mund begann es zu zucken. „Ja, so war es wohl“, sagte ich knapp und kaute auf meiner Unterlippe. Dann prusteten wir beide zeitgleich vor Lachen los. „Schade, dass ich das nicht gesehen habe“, japste sie. „Jetzt verstehe ich auch, warum Torge und er gestern so gelacht haben, als er von seinem Ausritt erzählte. Ich hab nicht mitbekommen, was so komisch gewesen ist, nur dass er viel länger als geplant für die Strecke gebraucht hat.“ Ich verzog das Gesicht. „Schön, dass er sich über mich amüsiert“, sagte ich trocken. Sie bespritzte mich mit Wasser und ich quietschte.
Vom Baum her war ein leises Greinen zu hören. „Connor“, sagte Kibira und zuckte mit den Schultern. „Bleib du ruhig noch etwas im Wasser, ich schaue nach ihm. Als sie mir den Rücken zuwandte und ans Ufer kletterte, entdeckte ich eine Tätowierung auf ihrem Schulterblatt. Ich konnte im ersten Moment nicht genau erkennen, worum es sich handelte. Neugierig versuchte ich, das Zeichen näher zu betrachten, ohne dass ihr mein Blick auffiel. Das Symbol auf ihrer Schulter schien dem Muster auf meinem Amulett sehr ähnlich. Ich beschloss, später auf jeden Fall danach zu fragen. Sanft berührte ich das Amulett an meinem Hals. Seit ich hier war, war es ruhiger geworden, es brannte nicht mehr auf meiner Haut, sondern war angenehm warm und es schien mir fast Teil meines Körpers geworden zu sein. Ob ich es je wieder abnehmen würde? Die Erinnerung an die Versuche verursachte mir eine Gänsehaut.
Nachdem ich mich gründlich gewaschen hatte, fühlte ich mich das erste Mal seit meiner Ankunft hier wirklich bewusst, lebendig und außerdem sehr sauber. Ich kletterte ans Ufer und ließ mich neben Kibira ins Gras plumpsen, sie schaukelte den kleinen Connor sanft hin und her und hatte die Augen geschlossen.
Irgendwann seufzte sie und sagte dann: „Wir sollten uns langsam auf den Weg machen. Wenn die Erntewagen zurückkommen, wird jede freie Hand gebraucht.“ Sie streckte sich und grinste dann breit. „Gut, dass ich nach der Geburt von Connor dreißig Tage nicht an den Gemeinschaftsarbeiten teilnehmen muss. Das Abladen der Wagen ist wirklich höllisch anstrengend.“ Ein zufriedenes Lächeln umspielte jetzt ihren Mund.
War mir das Dorf vorhin noch wie ausgestorben vorgekommen, so war ich nun beeindruckt von den vielen Menschen, die zwischen hoch beladenen Pferdewagen hin und her eilten. Hunde bellten aufgeregt und Pferde wieherten. Auf den Wagen standen zumeist junge Männer und warfen das gebündelte Heu ab. Alle anderen schleppten die Bündel in zwei große hölzerne Scheunen, wo wieder andere damit beschäftigt waren, alles möglichst platzsparend zu stapeln. Kibira winkte einem großen blonden Mann zu, der auf einem der Wagen stand. Ich vermutete, dass das ihr Mann Torge sein musste. „Da bist du ja“, hörte ich Faolanes weiche Stimme. Sie gab mir einen sanften Schubs und schon stand ich in der Reihe der Träger, wurde mit Heu beladen und trug es in Richtung der Scheune. Ich reichte die Bündel einer jungen Frau, die mit dem Stapeln beschäftigt war. Es war warm und stickig im Inneren der Scheune und ich überlegte gerade, ob ich später nicht noch einmal zum Fluss gehen sollte, als ich eine bekannte Stimme an meinem Ohr vernahm. „Sauber hätte ich dich fast nicht erkannt“, sagte Dornat und grinste frech. Heu hatte sich in seinen dunklen Haaren verfangen und er sah einfach unverschämt gut aus. Ich wusste nicht recht, was ich antworten sollte und beschränkte mich auf ein knappes Hallo. Ehe ich weiter über eine passende Erwiderung nachdenken konnte, war er auch schon wieder verschwunden. Ich ging wieder in Richtung Wagen, um die nächste Ladung Heu in Empfang zu nehmen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, als endlich auch der letzte eintreffende Wagen abgeladen war. Alle waren müde und erschöpft und doch herrschte überall eine fröhliche, freundliche Stimmung. Meine Arme schmerzten, ich hatte schrecklichen Durst und auch schon wieder Hunger und doch fühlte ich mich so gut, wie schon lange nicht mehr. „Wenn du mich sehen könntest Mara“, murmelte ich leise. Kibira tauchte plötzlich vor mir auf und sagte fröhlich: „Da hast du ja deine Feuerprobe gleich bestanden. Geht es dir gut?“
„Eigentlich prima“, sagte ich ehrlich, „außer, dass ich wohl das zweite Bad an diesem Tag nehmen sollte.“
Sie lachte und sagte dann: „Geh dich doch rasch waschen, später kommst du mit Faolane zu uns, ich habe gekocht.“ Müde und zufrieden ging ich zur Hütte zurück. Niemand schenkte mir besondere Beachtung, alle lächelten freundlich oder ignorierten mich einfach. Faolane war schon da, reichte mir einen Becher mit frischem, kühlem Wassern und goss dann Wasser aus einem Eimer in eine große tönerne Schüssel. Dazu reichte sie mir einen Lappen. „Hier kannst du dich waschen“, sagte sie freundlich.
„Kibira hat uns zum Essen eingeladen“, sagte ich, während ich mich gründlich wusch. „Ich war mir sicher, dass ihr euch gut verstehen würdet“, sagte sie und lächelte zufrieden. Setz dich, ich helfe dir mit den Haaren“, sagte sie weich. Während sie meine Haare mit einem Hornkamm entwirrte, sang sie leise vor sich hin. Ich fühlte mich unendlich geborgen und beschützt. Sie flocht mein Haar zu einem dicken Zopf.
Die Sonne stand bereits rot am Horizont, als wir uns auf den Weg zur Hütte von Kibira und ihrer Familie machten. Überall im Dorf brannten Feuer vor den Hütten, Menschen saßen zusammen, aßen und lachten, mir schien die Idylle fast zu perfekt, um erträglich zu sein.
Kibiras Hütte stand am anderen Ende der Siedlung. In einem kleinen Pferch neben dem Haus gackerten Hühner und ein kurzbeiniger, gescheckter Hund kündigte lautstark unser Kommen an.
Hinter dem Haus gab es eine Feuerstelle, außerdem standen dort ein langer Holztisch und zwei Bänke auf denen bunte Kissen lagen. Rings herum waren Fackeln und Kerzen aufgestellt, die alles in ein weich flackerndes Licht tauchten. „Da seid ihr ja“, hörte ich Kibiras zwitschernde Stimme hinter mir. Sie trug einen großen Topf, aus dem es himmlisch duftete. Hinter ihr erschien der große blonde Mann, den ich bereits auf dem Heuwagen gesehen hatte. Er hatte den schlafenden Connor auf dem Arm. „Das ist Torge und das ist Lana“, stellte Kibira uns kurz vor. „Hilfst du mir mit den Tellern?“ fragte sie mich. Ich betrat hinter ihr die Hütte, die sich nicht deutlich von Faolanes Zuhause unterschied. Hier war alles etwas chaotischer, ein Vorhang aus Fellen teilte einen Schlafbereich ab und an den Wänden hingen Zeichnungen, die scheinbar mit Kohle auf Leinenstoff gefertigt worden waren, der straff auf Holzrahmen gespannt war. Ich betrachtete aufmerksam die Zeichnung eines Gesichts. Obwohl die Hütte nur von flackernden Talglichtern erhellt wurde, erkannte ich sofort Torges markante Züge. „Das ist toll, wer hat das gezeichnet?“, fragte ich und wand mich dem nächsten Bild zu, dass eine ältere Frau zeigte. „Ach“, sagte Kibira verlegen, „das war ich, während der letzten Wochen der Schwangerschaft war mir so fürchterlich langweilig.“ In diesem Moment betrat die Frau von der Zeichnung die Hütte. Sie drückte Kibira herzlich. „Das ist meine Schwiegermutter“, sagte sie. Die Frau betrachtete mich kurz prüfend, eilte dann aber hinaus, um Faolane zu begrüßen und Torge ihren Enkel abzunehmen.
Wir saßen unter dem sternenklaren Himmel und aßen einen wundervollen Eintopf aus Kartoffeln, Gemüse und wilden Kräutern, dazu gab es frisches Fladenbrot. Nach der dritten Portion schob ich meinen Teller entschieden zur Seite. „Nein danke“, sagte ich, „aber wenn ich noch einen bisschen mehr esse, werde ich platzen.“ Ich war müde. Der süße Wein, den ich zum Essen getrunken hatte, machte mich ein bisschen schwindelig im Kopf und ich fühlte mich unendlich leicht und frei. „Das riecht ja hervorragend hier“, hörte ich eine vertraute Stimme. Dornat steckte den Kopf um die Ecke und fragte dann vorwurfsvoll: „Habt ihr alles aufgegessen?“ Ich versuchte ihn nicht anzustarren und spielte mit meinem Löffel. Faolane erhob sich leichtfüßig und er ging auf sie zu und sie drückte ihn leicht am Arm. „Warum waren die beiden so vertraut?“, fragte ich mich kurz verwundert. Die Begrüßung von Kibira, Torge und seiner Mutter war freundlich, aber deutlich distanzierter ausgefallen. „Setz dich“, forderte Kibira ihn auf. „Du bist spät.“ Er ließ sich neben Torge auf die Bank plumpsen und verdrückte in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit eine riesige Portion Eintopf.
Kibira betrachtete ihn mit gerunzelter Stirn und ließ dann den Blick zu ihrem Mann schweifen, der ebenfalls auf beiden Backen kaute. „Meine Güte“, sagte sie dann und küsste ihn auf die Wange. „Hoffentlich wird dein Sohn nicht so ein Vielfraß, sonst werde ich bald einen größeren Topf brauchen.“
Der Abend verging schnell. Es wurde viel erzählt und gelacht. Ich selber sagte nicht viel, sondern genoss es einfach, die alltäglichen Geschichten aus dem Dorf zu hören und mich seltsam zu Hause zu fühlen. Ab und an, wenn ich hoch sah, bemerkte ich, dass Dornat mich prüfend ansah. Wenn sich unser Blicke trafen, durchzuckte es mich wie ein Blitz und ich wand mich schnell ab. Zum Glück konnte man im Dunkeln nicht sehen, dass ich rot wurde.
Am nächsten Morgen wurde ich vom Regen wach, der auf das Dach der Hütte prasselte. Ich war alleine, das Lager, dass Faolane sich auf dem Boden eingerichtet hatte, war bereits leer, die Decken sorgfältig zusammen gelegt. Das Feuer glühte noch, sie konnte noch nicht lange fort sein.
Gerade wollte ich mich wieder gemütlich in die Felle kuscheln, um noch ein wenig weiter zu dösen, als mir siedend heiß einfiel, dass ich Maras Geschenk immer noch nicht geöffnet hatte. War ich wirklich erst einen Tag und zwei Nächte hier? Es kam mir vor, wie eine kleine Ewigkeit. Mein altes Leben erschien mir, hundert Jahre weit entfernt zu sein. War dies vielleicht eine andere Dimension, in der die Zeit schneller verging? Die Gedanken verursachten mir Kopfweh. Ich rappelte mich auf, nahm das Päckchen aus meinem Rucksack, der noch immer vollgepackt in der Ecke stand und krabbelte zitternd wieder unter die Decke. In der Hütte war es kühl und etwas feucht.
Ich löste vorsichtig die bunten Geschenkbänder und strich sie glatt. Fast andächtig betrachtete ich das bunte Plastik. „Ein Teil der anderen Welt“, murmelte ich und wunderte mich fast, dass es sich nicht vor meinen Augen in Luft auflöste. Ich öffnete das Päckchen und hielt einen Fotorahmen in der Hand, in dem ein Bild von Mara und mir war. Ich erinnerte mich noch genau, wann das Foto entstanden war. Es war eines meiner Lieblingsbilder von uns beiden. Es war ein phantastischer Tag an der Ostsee gewesen, wir waren beide sonnengebräunt, die offenen Haare vom Wind zerzaust. Im Hintergrund sah man den hellen Sand und das Meer. Mara hatten ihren nagelneuen Fotoapparat auf einen Strandkorb gestellt und das Foto mit dem Selbstauslöser geschossen.
Wehmütig strich ich über Maras Gesicht auf dem Bild. Außer dem Foto war da noch ein kleines, in Leder gebundenes Büchlein. Ich blätterte die erste Seite auf und schluckte.
„Warum Du meine liebste Freundin bist“, stand da, in großen schnörkeligen Buchstaben. Ich blätterte weiter, auf der nächsten Seite war ein Ultraschallbild eingeklebt. Darunter stand „Es wird ein Mädchen. Ich werde ihr von dir erzählen.“
Auf den folgenden Seiten hatte Mara alles aufgeschrieben, was ihr zu unserer Freundschaft eingefallen war. Szenen aus gemeinsamen Erlebnissen, unsere Geschichten, Gedanken, Träume und Worte, die wichtig für uns gewesen waren. Die letzten Seiten waren leer. Mich überkam plötzlich der Gedanke, dass sie darauf warteten, gefüllt zu werden.
Ich schluchzte laut auf und Tränen rannen mir übers Gesicht. „Ich vermisse dich jetzt schon so sehr“, flüsterte ich dem Bild zu. Ich hörte Stimmen vor der Hütte, rasch verbarg ich das Bild und das Büchlein unter den Kissen. Das hier würde mein Geheimnis bleiben. Ich wollte es mit niemandem teilen.
Die Tür wurde geöffnet, ein kühler Windstoß zog in die Hütte und Faolane trat ein. Sie schüttelte sich, wie ein nasser Hund. „Oh, du bist wach. Gut“, stellte sie fest.
Sie sah mich prüfend an und ich war mir sicher, dass sie die Tränenspuren auf meinem Gesicht bemerkt hatte, sie sagte aber nichts. „Ich mache Tee“, sagte sie und wand mir den Rücken zu. Wenig später flackerte das Feuer wieder hell auf und das Wasser kochte in dem Kessel. Ich rappelte mich auf, überlegte kurz, ob ich nicht wieder Jeans und T-Shirt anziehen sollte, entschied mich dann aber doch für die Tunika. Faolane lächelte und reichte mir einen grob gestrickten Pullover aus ungefärbter Wolle.
„Der Regen wird bald aufhören“, sagte sie, wie zu sich selber. Sie reichte mir einen dampfenden Becher Tee, dazu gab es Fladenbrot mit frischen Kräutern und Quark. Außerdem standen zwei tönerne Töpfe mit Marmelade und Honig auf dem Tisch. Ich hatte schon wieder riesigen Hunger. Wenn das so weiter geht, bin ich bald zwei Zentner schwer, dachte ich und leckte mir den Honig von den Fingern.
„Ich muss später zum Weiler in den Hügeln“, sagte Faolane. „Es wäre schön, wenn du mich begleitest.“
„Solange ich nicht reiten muss“, stöhnte ich, während ich mich schwerfällig erhob. Nach der ungewohnten körperlichen Arbeit im Heuschober und meinem Gewalt-Ritt am Vortag tat mir nun wirklich alles weh. Ich hatte das Gefühl, dass ich selbst in den Fingerspitzen Muskelkater hatte. Sie lächelte und beruhigte mich. „Nein, es ist nicht allzu weit. Wir gehen zu Fuß, das wird dir gut tun.“ Um ihre Mundwinkel zuckte es leicht und ich meinte, ein wenig Schadenfreude in ihrem Lächeln zu erkennen.
Sie räumt den Tisch ab und verscheuchte eine große, schwarze Katze, die es sich gerade in meinem Bett bequem machen wollte. Das Tier maunzte beleidigt und trollte sich murrend. „Bist du fertig?“, fragte sie dann freundlich. Ich nickte. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte mich noch einmal hinlegen können, noch immer war ich bleiern müde. Ich gab den Kampf mit meinen Haaren auf und band sie im Nacken mit einem Lederband zusammen.
Sie nahm einen großen Weidekorb und wir verließen die Hütte. Der Regen hatte aufgehört, es roch nach Erde, Gras und Sommer. Ich atmete tief ein. Die Farben des Dorfes und der Landschaft waren so intensiv, dass es beinahe kitschig wirkte. Der Duft nach frischem Heu stieg mir in die Nase und machte mich ein wenig schwindelig. Einmal mehr hatte ich ein völlig unwirkliches Gefühl.
„Wohin gehen wir?“, fragte ich Faolane, die mit langen ruhigen Schritten voran schritt, so dass ich mich beeilen musste, nicht zurück zu fallen. „Wir besuchen Kellye und Marthe.“ Mehr sagte sie nicht. „Okay“, dachte ich, etwas genervt. Ich lerne also mal wieder Leute kennen. Dass Faolane nicht gerade eine Frau der großen Worte und Erklärungen war, war mir nun auch schon klar geworden.
Wir verließen das Dorf diesmal in Richtung der Hügel. Ich entdeckte Gemüsebeete, Apfelbäume und einen Pferch mit Ziegen, die uns neugierig beäugten. Überall grüßten uns fröhlich Menschen, die irgendeiner Arbeit nachgingen. Faolane hatte für jeden ein freundliches Wort oder einen liebevollen Blick. Ich schnaufte, als wir den Anstieg zum ersten Hügel begannen. Faolane wurde nicht langsamer, trotz des Korbes, den sie trug, waren ihre Schritte geschmeidig und kraftvoll. Wir kamen an Bienenkörben vorbei, die auf einer Hügelkuppe aufgebaut waren. Emsig flogen die Bienen hin und her und ihr Summen erfüllte die Luft. Hierher kam wohl dann auch der leckere Honig, den ich zum Frühstück verzehrt hatte. Auf einem der höheren Hügel blieb ich stehen und dreht mich um. Von hier aus konnte man das Meer sehen, dass gegen steile Klippen rauschte. Irgendwo dort musste auch der Strand sein, an dem das Fest stattgefunden hatte. Ich atmete tief ein. „Oh Gott, ist das schön“, sagte ich etwas atemlos. Faolane blieb neben mir stehen.
„Ja, SIE hat uns etwas Wunderbares geschenkt, das wir schützen und bewahren sollen.“ Sie seufzte, als wenn das eine große Last für sie bedeutet. Ich sah sie irritiert an. „SIE?“, fragte ich und schaute Faolane neugierig an.
Sie antwortete nicht gleich, sondern stand da und schloss für ein paar Sekunden die Augen. Mir war, als wenn sie einer Stimme lauschte, die nur sie hören konnte. Sie schien meilenweit entfernt von mir.
Dann war sie plötzlich wieder an meiner Seite, ihre Augen waren klar und wach und sie sagte mit ihrer weichen, sanften Stimme: „Ja, SIE, die alles ist. Anfang und Ende, Leben und Tod, Geburt und Sterben. SIE ist das Meer, die Erde, der Wind in den Bäumen und die wärmende Sonne. SIE ist es, die uns bewahrt und behütet, die uns lehrt friedlich zu leben und den Frieden zu wahren und deren viele Namen doch nur die Eingeweihten kennen.“
Ich sah Faolane an und hoffte, dass sie weiter sprach, aber ihr Gesichtsausdruck zeigte mir deutlich, dass ich in diesem Moment nicht mehr erfahren würde. Sie hatte alles gesagt, was es für mich im Augenblick zu wissen gab, das las ich in ihren Augen. Ich war mir seltsam sicher, dass sie alle IHRE Namen kannte.
Ich fühlte ein Prickeln auf der Haut und trotz des Aufstieges und der strahlenden Sonne, fröstelte ich ein wenig. Ich hatte das Gefühl, immer wieder irgendwelche Brocken zugeworfen zu bekommen, aber das alles ergab keinen Sinn, kein komplettes Bild. Würde ich jemals verstehen, was Salandor war und wer seine Bewohner? Würde ich verstehen, was mich angezogen hatte und warum keiner verwundert darüber war, dass ich hier war? Ich erinnerte mich an die Tätowierung auf Kibiras Schulter und das Symbol auf meinem Amulett. War jetzt der richtige Zeitpunkt danach zu fragen? Ehe ich mir weiter darüber Gedanken machen konnte, schritt Faolane schon wieder forsch aus und ich hastete hinter ihr her. Alles zu seiner Zeit, schien hier wirklich das Maß aller Dinge zu sein.
Wir überquerten einen weiteren Hügel und bald lag vor uns in der Ferne ein Waldgebiet. Der Blick wurde am Horizont wieder von den schroffen Bergen begrenzt, die mir schon bei meinem etwas unfreiwilligen Reitausflug mit Dornat aufgefallen waren.
Auf der Kuppe des nächsten Hügels war eine kleine Siedlung, die meiner neuen Heimat am Meer sehr ähnlich sah. Auch hier standen weiß getünchte Hütten, ein paar Ziegen grasten auf einer Weide und ein riesiger, wolfsähnlicher Hund kam uns entgegen gesprungen und begrüßte Faolane stürmisch und mit viel Gebell. Mich ignorierte der Köter weitestgehend, was mir aufgrund seiner enormen Größe sehr recht war.
„Komm“, sagte sie dann zu mir und schob den großen Hund energisch zur Seite, er winselte leise.
Wir betraten eine der Hütten. Die kleinen Fenster waren auch hier ohne Glas, nur ein paar Tücher dämpften Zugluft und Licht. Die Sommerluft und der Duft nach Gras hatten sich auch in der Hütte verbreitet. Man konnte das Zirpen der Grillen hören.
Auf einem großen, breiten Bett aus Holz lag eine zierliche, alte Frau. Obwohl es in der Hütte warm war, hatte sie sich fest in eine Decke aus Fuchspelz gekuschelt. „Kellye“, fragte die Frau mit kratziger, leiser Stimme. „Nein, Marthe, ich bin´s, Faolane. Und ich habe Lana mitgebracht, sie lebt jetzt bei mir.“ Faolane ließ sich auf dem Bett nieder und nahm die Hände der Frau in ihre. Ich blieb ein wenig abseits stehen und wusste nicht, was ich tun sollte. Faolane winkte mich heran. „Komm her Lana, sie kann dich nicht sehen. Ihre Augen sind schlecht geworden mit der Zeit. Nimm ihre Hand, damit sie dich fühlen kann.“ Zögernd setzte ich mich auf den Rand des Bettes und ließ zu, dass Faolane die Hände der alten Marthe in meine legte. Ich verspürte ein leichtes Prickeln in den Fingerspitzen. Marthes Hände waren knochig und kühl. Die alte Frau hatte die blinden Augen geschlossen und sagte dann wie zu sich selber: „Sehr viel Kraft. Sie wird sie brauchen.“
Dann wand sie sich an mich. „Willkommen Lana. Schön, dass du hier bist.“
Faolane hatte derweilen angefangen, den Inhalt ihres Korbes auf dem Tisch aufzubauen. Es waren Kräuter in kleinen Säcken, Salben in Tiegeln und zwei kleine Flaschen aus Ton. Interessiert schaute ich ihr zu. Anscheinend war Faolane so etwas wie der Arzt im Ort.
Die Holztür der Hütte wurde geöffnet und eine rothaarige, schlanke Frau mit alabasterfarbender Haut trat mit einem großen Strauß Wiesenblumen auf dem Arm ein. Ich erkannte in ihr sofort die Frau wieder, die mit Dornat am Strand getanzt hatte. Sie war fast ätherisch schön. „Faolane, ich freue mich, das du da bist.“ Sie neigte kurz ehrerbietend den Kopf. Rote Locken fielen ihr ins Gesicht. „Ich wollte Marthe eigentlich für den Nachmittag nach draußen bringen, nach dem Regen heute früh ist es so warm geworden.“ Sie ging zum Bett und streichelte der alten Frau übers Haar. „Möchtest du ein bisschen in die Sonne, Mutter?“, fragte sie leise, fast zärtlich. „Hier, riech mal an den Blumen. Ich habe sie für dich gepflückt. Ich stelle sie dir in dem Krug mit dem abgebrochenen Henkel auf den Tisch, ja?“ Plötzlich war auch der große Hund im Raum und schnüffelte vorsichtig an Marthes Hand. Sie lächelte und streichelte das Tier.
Mir schnürte es den Hals zu, ein großer Kloß saß plötzlich in meiner Kehle und ich kämpfte mit den Tränen.
Ich sah mich selbst auf einem hässlichen, gelben Plastikstuhl. Das Zimmer war weiß und kahl, in der Mitte stand das Krankenbett meiner Mutter. Es roch nach Desinfektionsmittel, nach Krankheit, nach Tod. Draußen schien die Sonne und ich wünschte mir nichts mehr, als ihre warmen Strahlen auf der Haut zu spüren. Hier drinnen war es so kalt. Die Apparate gaben immer die gleichen, piependen Geräusche von sich. Der Atem meiner Mutter ging schwer. Eine Schwester schob die Tür zum Krankenzimmer auf und trat mit einem Tablett voller Schläuche und Medikamente ein. „Sie müssen bitte draußen warten“, sagte sie, ziemlich mürrisch. Sie sah müde aus. Ich erhob mich mühsam und schleppte mich aus dem Zimmer. Meine Schuhe quietschten auf dem Linoleum-Boden. Wie viele Tage und Wochen ging das jetzt schon so? Ich hatte aufgehört zu zählen. Ich kam dreimal die Woche her, öfter ließ mir das Leben einfach keine Zeit. Dann saß ich frierend eine Stunde am Bett meiner Mutter und schaute zu, wie sie atmete. Mara hatte mir geraten ihr etwas zu erzählen, aber ich wusste nicht was. Ich hatte nichts zu sagen, ich war müde, erschöpft und leer. Es war ein Unfall gewesen. Keiner konnte genau sagen, warum die Autos ineinander gerast waren. Vielleicht hatte einer der Fahrer gebremst, der nachfolgende Fahrer hatte zu spät reagiert. Ich wollte es nicht wissen. Die Polizei suchte noch nach den Ursachen, ich lebte bereits mit den Folgen. Mein Vater war tot, meine Mutter kämpfte seit Wochen um ihr Leben. Ich hätte die Frage nicht beantworten können, wer es von beiden besser getroffen hatte. Was wäre wenn sie aufwachte, ohne Beine, schwerstbehindert? Wie sollte das alles weiter gehen? Wer sollte sie pflegen, wer sollte das alles bezahlen? Fast schämte ich mich meiner Gedanken. „Sie können jetzt wieder rein gehen“, sagte die Schwester, immer noch etwas unfreundlich. Sie hatte tiefe Ränder unter den Augen. „Nein“, sagte ich leise, „ich muss nach Hause, ich hab noch zu tun.“ Ich ging nicht noch einmal in das kalte, weiße Zimmer. In dieser Nacht starb meine Mutter.
Faolane goss ein bisschen von der Flüssigkeit in einen Becher und reichte ihn Marthe. Diese trank gierig und lehnte sich dann entspannt lächelnd zurück. Ohne Scham streifte Kellye ihrer Mutter das Nachthemd ab und begann sie mit einem Sud aus Kräutern, den Faolane ihr reichte, abzuwaschen. Die alte Frau seufzte zufrieden. Danach kleideten sie sie wieder an, halfen ihr auf und stützten sie. Sie führten sie bis zu einer großen Liege vor der Hütte, auf der sie dann, wieder in ihre Decke gewickelt, lag. Erschöpft schloss sie die Augen. Die Sonne malte kleine Kringel auf ihre runzelige, blasse Haut.
Kellye kam mit einer Kanne kaltem Tee und einer Schale voll Keksen aus der Hütte und wir setzten uns um die Liege herum. Ich schwieg die meiste Zeit und betrachtete die Gräser, die sich im Wind wiegten. Kellye erzählte, dass die Ziegen mal wieder ausgerissen waren, wilde Kaninchen das Gemüsebeet geplündert hatten und dass der Hund eins von ihnen zum Frühstück verzehrt hatte. Faolane berichtete von der Heuernte, die noch vor dem Regen hatte eingebracht werden können. Es waren alltägliche Geschichten. Ich lauschte den Erzählungen und beobachtete das Gesicht von Marthe. Sie hörte zu, ihr Mund verzog sich von Zeit zu Zeit zu einem Lächeln und irgendwann schlief sie ein.
„Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie nach Hause geht“, sagte Faolane leise zu Kellye. Diese nickte und ich wunderte mich darüber, dass sie gar nicht traurig aussah. Ich war mir sicher, dass Faolane mit „nach Hause gehen“, sterben gemeint hatte. Waren die Leute hier nicht ganz normal? War es hier nicht traurig und leidvoll, wenn jemand starb?
Kellye nippte an ihrem Tee, sah dann erst mich an und dann wieder Faolane. Diese nickte fast unmerklich. Dann sagte Kellye: „Ich hab einen weißen Wolf gesehen, vor ein paar Tagen, drüben am See.“ Faolane lächelte und nahm Kellyes Hand. „SIE holt sie heim, sie ist immer noch IHRE Tochter“, sagte sie und es klang fast dankbar.
Ich war irritiert. Mein Blick raste zwischen den beiden hin und her. Der Wolf, den ich gesehen hatte, bevor ich hierhergekommen war, war es ein Wolf aus Salandor gewesen? Wie war das Tier in den Wald südlich von Hamburg gekommen? Musste ich auch sterben oder erschienen den Leuten hier Wölfe auch einfach nur so? Meine Gedanken rasten, mir brach kalter Schweiß auf der Stirn aus. Ich holte Luft und versuchte, mich zu beruhigen, aber stattdessen wallte so etwas wie Verzweiflung und Wut in mir auf. Was zum Teufel geschah hier eigentlich? Faolane schien wie immer eine Antenne für meine Gefühle zu haben. Bevor ich den Mund aufmachen konnte und sie anschreien konnte, dass es mir langsam reichte mit all dem Hokos-Pokus, den Geheimnissen und den Viechern, die einfach irgendwo ungefragt auftauchten und Ereignisse ankündigten, sagte sie : „Wölfe sind IHRE Boten, IHRE Geschöpfe. Sie zu sehen, sie um sich zu haben, bedeutet Gnade. Manchmal sagen sie uns auch, was passieren wird, sie geben uns Zeichen, die wir verstehen müssen oder sie schenken uns Hoffnung und Trost.“ Sie sah mich an, mit diesem Blick, den ich mittlerweile nur zu gut kannte. Dieser Blick, der auf eigenartige Weise dafür sorgte, dass ich keine weiteren Fragen mehr stellte, besser gesagt, nicht stellen konnte.
Ich erhob mich etwas steif, ich war wütend. Sehr wütend. Irgendetwas passierte hier und ich verstand nichts davon. Immer wieder wurden mir winzige Puzzleteile hingeworfen, die aber nicht einmal einen Teil des Bildes ergaben. Geduld hatte noch nie zu meinen Stärken gehört und das hier war für mich fast unerträglich. Kellye wollte aufstehen. Ihr Blick war kühl und prüfend. Ich nahm aus den Augenwinkeln wahr, dass Faolane gebieterisch die Hand hob und sie daran hinderte, mir zu folgen.
Ich stapfte wütend davon. Ich wollte einfach nur weg. Weg von dieser Frau, die mich scheinbar wie eine Marionette steuerte. Weg von all dieser kitschigen Glückseligkeit und diesem seltsam friedlichen Gefühl, das hier allgegenwärtig schien. Ich wollte schreien, dass es irgendwo da draußen Leute gab, die wirklich lebten, die litten, die Kummer und Sorgen hatten, dass das hier nur ein Abklatsch von irgendeiner kitschigen Soap sein musste, aber niemals echt. Und doch, der aufblitzende Gedanke, Salandor auf der Stelle zu verlassen, bereitete mir Schmerzen. Mein Körper fühlte sich an, als wenn er mit glühenden Messern attackiert wurde. Ich konnte, nein, ich wollte nicht fort. Ich ließ mich ins Gras fallen. Irgendwo plätscherte Wasser und über mir am strahlend blauen Himmel zog ein Greifvogel seine Kreise und ließ sich in der Thermik treiben. Es war unwirklich schön hier. Es war mir fast schon unheimlich. Ich lag einfach nur da, ich wusste später nicht mehr, wie lange ich in den Himmel gestarrt und versucht hatte, meine wirren Gedanken und Gefühle zu ordnen. Als ich mich wieder aufsetzte, sah ich Faolane, die neben mir im Gras saß. Wie lange hatte sie schon dort gesessen? Ich hatte sie nicht einmal kommen gehört.
„Lana“, sagte sie leise, „ich weiß, dass das alles sehr viel für dich ist. Ich weiß auch, dass dich tausend Fragen quälen, dass du wütend bist, weil du keine Antworten findest. Und ich spüre, dass du zweifelst, an mir, an dir, an all dem hier. Aber sieh dich um.“ Sie wies mit ihrem ausgestreckten Arm über die Wiese, die Hügel und den Fluss, der am Rande der Wiese munter plätscherte. „Genieße all das erst einmal, versuche erst einmal zu verstehen, was du siehst und was du hörst. Versuche anzukommen, zu dir zu kommen. Du wirst Antworten finden und bekommen und du wirst mehr verstehen müssen, als du vielleicht möchtest.“ Ihre Stimme wurde ernst und dunkel. „Es wird der Tag kommen, da wirst du keine Fragen mehr haben, Lana. Möge der Tag fern sein. Möge SIE dir Zeit schenken. Sei frei, solange du es kannst und genieße die Freiheit, die sich dir bietet. Noch ist Zeit...“ Sie legte mir sanft die Hand aufs Haar und ich spürte, wie sich Wärme und Ruhe in mir ausbreiteten. Ich hätte schwören können, dass ich in diesem Moment den Schatten eines Wolfes am Rande der Wiese sah.