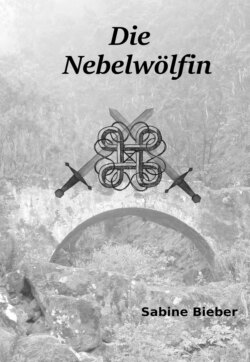Читать книгу Die Nebelwölfin - Sabine Bieber - Страница 6
Kapitel 3
ОглавлениеMir war kalt und mein linker Fuß gehörte irgendwie nicht mehr zu meinem Körper. An der Stelle, an der ich ihn vermutet hätte, war nur noch ein taubes Gefühl. Mühsam schlug ich die Augen auf, meine Glieder fühlten sich an wie Blei. Ich lag völlig verknäult auf nassem, matschigem Waldboden und ein kurzer Blick auf meinen linken Fuß ließ klar werden, dass ich sehr wohl noch selbigen hatte, er aber durch mein verdreht liegendes Bein komplett von der Blutzufuhr meines restlichen Körpers abgeschnitten war. Mühsam rappelte ich mich auf und begann mechanisch, meinen Fuß zu massieren. Nach kurzer Zeit fühlte ich, wie er anfing zu kribbeln, das Blut begann zu zirkulieren und ich spürte meine Zehen wieder. Es war fast dunkel um mich herum. Schemenhaft konnte ich noch den schmalen, farnbewachsenen Pfad vor mir erkennen. Ich rieb mir die Augen, fluchte, weil sie anfingen zu brennen, da ich schlammbeschmierte Hände hatte und zupfte ein paar Blätter aus meinen zerzausten Haaren.
Wie viele Stunden hatte ich hier gelegen? Was war eigentlich geschehen? Ich richtete mich vorsichtig auf und war erstaunt, dass mich meine Füße noch trugen und ich, wenn auch wackelig, auf beiden Beinen stehen konnte. Ich musste ohnmächtig geworden sein. Vielleicht hatte ich zu wenig gegessen. Erst jetzt stellte ich erstaunt fest, dass ich keine Schuhe mehr trug. Meine Füße waren mittlerweile eiskalt und mir schlugen die Zähne hart aufeinander.
Ich tastete nach meinem Hals und erstarrte. In der Hand hielt ich ein Amulett, das an einem schmalen Lederband befestigt war. Mit zitternden Fingern wischte ich mir abermals durch das Gesicht. „Ruhig bleiben, Lana“, sage ich laut zu mir und wunderte mich, wie kratzig und rau meine Stimme klang. „Du gehst jetzt zum Parkplatz, nimmst dein Auto und fährst nach Hause und du wirst nicht nachdenken. Nicht jetzt, später. Los jetzt.“
Ich kletterte den Weg hinauf, stieß mit meinen bloßen Füssen immer wieder an Steine, Äste stachen mir in die Fußsohlen. Im Geiste schickte ich ein Stoßgebet zum Himmel, dass mich niemand sehen möge. „Die werden mich dann wohl direkt einweisen“, dachte ich und musste ein hysterisches Kichern unterdrücken. „Wenn ich dann noch lebhaft erzähle, dass ich eben auf einem Fest am Strand getanzt habe, lassen die mich auch nie wieder aus der Anstalt heraus.“ Ich hörte mich selber kichern, es klang fast gespenstisch.
„Weiter, weiter“, feuerte ich mich selber an. Mein großer Zeh blutete und mittlerweile war mir so kalt, dass ich so laut mit den Zähnen klapperte, dass ich kein anderes Geräusch im herbstlichen Wald mehr wahrnahm.
Ich bin mir bis heute nicht sicher wie ich es schaffte, den Parkplatz zu erreichen.
Ein Jogger kam mir in der Dämmerung entgegen. Zum Glück war der Mann ganz in seinen Lauf vertieft und trug Kopfhörer, so dass er mich nicht wirklich ansah. Mit letzter Kraft und eiskalten Fingern schaffte ich es, die Autotür zu öffnen und mich auf den Sitz fallen zu lassen. Ich startete den Motor, drehte die Heizung auf Maximum und schloss die Augen.
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich einfach nur da saß und nichts tat. Im Inneren des Wagens wurde es langsam warm. „Nach Hause, Lana“, sagte ich laut zu mir, „nicht nachdenken. Einfach nur nach Hause.“ Mit dreckverschmierten Händen umklammerte ich das Lenkrad und schaffte es irgendwie, den Wagen unfallfrei nach Hause zu manövrieren.
Irgendwann, sehr viel später erreichte ich meine Wohnung, flitzte so schnell ich eben konnte barfuß durchs Treppenhaus und mühte mich mit dem Schlüssel an meiner Tür ab. Meine Finger waren eiskalt und ich schaffte es erst im dritten Anlauf, das Schlüsselloch zu finden. Ich trat ein und schlug die Wohnungstür laut hinter mir zu. Ich atmete tief ein, dann ließ ich mich, so verdreckt wie ich war, einfach auf die Couch fallen und schlief sofort ein, tief und traumlos.
Ich erwachte von einem lauten Geräusch. Erst nach einigen Sekunden realisierte ich, dass es mein Telefon war, das hartnäckig klingelte. Es war stockdunkel in der Wohnung. Verwirrt sah ich mich um, mit der Hand tastete ich nach dem Lichtschalter und schubste dabei eine kleine Glasfigur vom Regal. Das laute Scheppern holte mich endgültig in die Realität zurück. Der Anrufbeantworter sprang an und ich hörte meine eigene Stimme, die sich freundlich für den Anruf bedankte und dem Anrufer mitteilte, dass ich gerade nicht zu Hause war. Nach dem Signal-Ton hörte ich Maras Stimme, verstand aber nicht, was sie sagte. Ich war völlig unfähig, mich zu bewegen, jeder Knochen in meinem Körper tat mir weh und ich war schrecklich hungrig. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, gelang es mir, das Licht anzuschalten. Wie eine uralte Frau hievte ich mich vom Sofa hoch. Ich sah an mir herunter und sog scharf die Luft ein.
Ich war vollkommen mit Schlamm und Dreck beschmiert und trug ein merkwürdiges fleckiges Leinenkleid, darüber meine Winterjacke. „Das kann nicht sein“, stammelte ich.
Mir wurde schwarz vor Augen, beherzt kniff ich mich selber in den Unterarm, der Schmerz sorgte dafür, dass das Zimmer aufhörte sich um mich zu drehen. „Ich muss nachdenken“, sagte ich laut und versuchte die Gedanken zu sortieren, die wie eine Flutwelle auf mich einstürzten.
Nervös suchte ich nach Zigaretten, tastete nach einem Feuerzeug und nahm einen ersten tiefen Zug. Mit wurde wieder schwindelig. „Eine Ohnmacht oder ein Traum“, redete ich weiter laut auf mich ein. „Das ist alles nur ein eigenartiger, langer, sehr intensiver Traum. Gleich wache ich auf, bestimmt.“
Wie um eine Bestätigung dieses Gedanken zu bekommen, fuhr meine Hand zum Hals. Ich erstarrte in der Bewegung. Um meinen Hals lag ein Lederband und meine zittrige Hand ertastete ein flaches Amulett. „Das kann doch nicht…“, flüsterte ich und brach dann ab. Ich ließ mich zurück aufs Sofa fallen.
Ich atmete tief den Rauch ein und starrte in die Rauchwolken. Ich wusste nicht mehr, wie lange ich einfach da saß, die Wand anstarrte und meine Gedanken, wie Blitze durch mein völlig überdrehtes und überreiztes Gehirn zuckten.
Irgendwann knurrte mein Magen sehr laut und vernehmlich. Da ich im Grunde ein sehr praktisch veranlagter Mensch und in jeder Situation und zu jeder beliebigen Tag und Nachtzeit hungrig war und essen konnte, erhob ich mich schließlich schwerfällig und schlurfte in die Küche. Ich konnte mich nicht erinnern, je in meinem Leben so ausgehungert gewesen zu sein. Ich schlang in kurzer Zeit mehrere dick belegte Brote, einen großen Vanille Pudding und eine halbe Tafel Schokolade in mich hinein und spülte das Ganze mit einem großen Glas Apfelschorle hinunter.
Danach begann ich, mich wieder einigermaßen lebendig und menschlich zu fühlen. „Nun noch eine heiße Dusche und ich bin zumindest halbwegs wieder hergestellt“, sagte ich laut zu mir. Meine Stimme klang eigenartig dünn und zittrig, aber um mir selber Mut zu machen, begann ich falsch und laut „Yellow Submarine“ vor mich hin zu singen. Ich stellte mit etwas eckigen Bewegungen das dreckige Geschirr in die Spüle und schlurfte ins Bad. Meine dreckigen Füße hatten mittlerweile hübsche Abdrücke auf den hellen Fliesen in der Küche hinterlassen.
Der Blick in den Spiegel versetzte mir abermals einen Schrecken. Mein Gesicht war voller Dreck und Kratzer, in meinen Haaren hingen vereinzelte Blätter und ich zog einen kleinen Zweig heraus.
Meine manikürten Fingernägel waren teilweise eingerissen und meine Hände völlig verdreckt, als hätte ich mit bloßen Händen Grabungsarbeiten durchführt. Wieder fuhr ich mir nervös mit den Händen durchs Gesicht und hinterließ einen weiteren braunen Streifen quer über der Nase. „Sehr schön, Lana“, sagte ich und grinste mein Spiegelbild probehalber an. Das Grinsen war ein wenig schief und gelang mir nicht wirklich. Aus dem Spiegel blickte mich eine reichlich übernächtigte, sehr dreckige Frau mit einem grenzdebilen Gesichtsausdruck an. Ich löste den Gürtel und ließ das eigenartige Gewand zu Boden gleiten. Dann hob ich meine Haare im Nacken und löste den Knoten des Lederbandes. Das Amulett legte ich auf den Rand des Waschbeckens. Ich trat unter die Dusche und drehte den Wasserhahn auf. Das Wasser kam, wie immer, erst einmal kalt aus dem Hahn und ich quietschte und trat einen Schritt zurück.
Plötzlich überfiel mich ein eigenartiges Gefühl. Erst spürte ich etwas, das sich wie eine große Leere anfühlte. Ich fühlte mich selber nicht mehr, stand neben mir und agierte wie eine ferngesteuerte Marionette. Dann setzte Panik ein, ich hatte Mühe Luft zu holen, ich hatte das Gefühl, ein großes, schweres Ding saß auf meiner Brust. Mein Atem ging stoßweise und kalter Schweiß stand mir auf der Stirn. Flecken tanzten vor meinen Augen. Ein Dröhnen und Drängen in meinem Kopf raubte mir fast den Verstand. Fahrig suchte ich Halt, fand aber keinen und riss fast den Duschvorhang herunter. Hastig kletterte ich wieder aus der Dusche und ging, taumelnd wie ein Schlafwandler, auf das Waschbecken zu. Meine Hand griff wie ferngesteuert nach dem Amulett. Meine Finger umkrallten die kleine Scheibe und ich presste das Schmuckstück an mich. Die Welt um mich drehte sich wie ein Karussell.
Mit zitternden Händen verknotete ich das Band wieder um meinen Hals. Der Spuk war so schnell vorbei, wie er gekommen war. Ich konnte wieder frei atmen und meine Hände hörten auf zu zittern. Fast dankbar fühlte ich den Schmerz, als das nun heiße Wasser wie tausend kleine Nadelstiche auf meine Haut traf.
Ich duschte lange, wusch mir gründlich die Haare und massierte meine verspannten Muskeln an den Beinen. Das heiße Wasser und der aufsteigende Dampf beruhigten nach und nach meine überreizten Nerven.
Irgendwann viel später saß ich in ein warmes Handtuch gehüllt auf meinem Bett und dachte nach. Ich hatte entschieden zu viele Zigaretten geraucht, aber mein Zustand war wenigstens wieder als halbwegs normal zu bezeichnen. Wie zur Sicherheit fuhr meine Hand wieder zu dem Amulett an meinem Hals.
Es war mittlerweile nach Mitternacht, der Regen prasselte gegen die Scheibe, eigentlich würde in gut sechs Stunden mein Wecker klingeln und ich müsste aufstehen, um zur Arbeit zu fahren. Daran war nicht zu denken, das hatte ich mittlerweile entschieden. Ich musste mich krank melden. Ich brauchte einfach Zeit um nachzudenken, um zu schlafen, wenn ich denn irgendwann konnte und meine wirren Gedanken und Erinnerungen zu ordnen.
Das, was ich als vermeintlichen Tagtraum abtun wollte, war irgendwie Teil meiner Realität geworden, war irgendwie und irgendwo tatsächlich passiert, das musste ich mir nun eingestehen.
Wenn ich noch letzte Zweifel gehabt hatte, so waren sie durch das Amulett und seine Wirkung endgültig aufgehoben. Ich hatte zunächst darüber nachgedacht, noch einmal zu versuchen, das Amulett abzulegen, aber schon der Gedanke an die Situation im Bad ließ mich frösteln. Wie zur Sicherheit fuhr meine Hand wieder an meinen Hals, der Schmuck fühlte sich warm an und es beruhigte mich, ihn zu berühren. Die kleine Platte war aus Bronze und fast kreisrund. Auf der Oberfläche war ein Muster aus in sich verschlungenen Linien eingeprägt, die mich entfernt an einen endlosen Knoten erinnerten. Ineinander verschlungen, ergaben die Linien ein Viereck mit abgerundeten Ecken. Die Ecken wiederum waren untereinander ebenfalls durch feine Striche verbunden, die mich entfernt an eine Acht oder das mathematische Symbol für Unendlichkeit erinnerten. Ich hatte dieses Symbol noch nie zuvor gesehen und doch kam es mir seltsam vertraut vor. Ich ließ mich zurück fallen und die Bilder vom Strand zogen wieder vor meinem inneren Auge auf. Die Fackeln, die in den Sand gesteckt worden waren und den Strand in ein mystisches Licht tauchten. Das Meer, das leise rauschend und in ewiger Wiederkehr an die Küste spülte und sich weiter draußen in gewaltigen Wogen an felsigen Riffs brach. Ich konnte wieder den Rhythmus der Trommeln hören und die Stimmen der Sänger, die in einer mir vollkommen unbekannten Sprache sangen. Soviel Wärme, Sehnsucht und Leidenschaft hatte ich bisher nie gehört und gefühlt, obwohl ich kein Wort von dem verstanden hatte, was sie sangen. Ich sah die Tänzer wieder vor mir, roch den Geruch von gebratenem Fisch und sah Faolanes goldene Augen. Ich streckte die Hand nach ihr aus, wollte sie berühren. Ich hatte das Gefühl, dass ich dann endlich zur Ruhe finden könnte, nach Hause kommen würde. Ich rief ihren Namen und griff ins Leere. Danach umgab mich nur noch Stille und ich fiel ins Bodenlose.
Am Morgen riss mich das Klingeln des Weckers unsanft auf meinem tiefen, fast komatösen Schlaf.
Völlig verwirrt richtete ich mich auf und brauchte zunächst einige Sekunden, um zu realisieren, wo ich war. Langsam begann mein Gehirn zu arbeiten. Wie automatisch fuhr ich mit der Hand zu meinem Hals und meine Finger umfassten sanft das Amulett. Das mir nun schon bekannte, beruhigende Gefühl und eine wohlige Wärme durchfuhren mich und ich fühlte mich zumindest soweit wieder hergestellt, dass ich es schaffte aus dem Bett aufzustehen und zum Telefon zu schlurfen. Ich musste meinem Kollegen Bescheid sagen, dass ich ein, vielleicht besser zwei Tage zu Hause bleiben würde.
Ben meldete sich und ich war fast erschrocken über den Klang meiner eigenen Stimme, die rau und kratzig klang. Ich murmelte etwas von total erkältet und Ben sicherte mir zu, in der Personalabteilung Bescheid zu sagen. Damit war das Gespräch beendet, das Display zeigte an, dass es keine zwei Minuten gedauert hatte.
Wir waren seit einem halben Jahr Kollegen, mochten uns aber nicht sonderlich. Die große Versicherung, in der ich arbeitete, hatte umstrukturiert und statt mit der netten und fröhlichen Karin teilte ich nun mit Ben das Büro. Er war meist muffelig, hatte ständig schlechte Laune und war dabei auch noch zänkisch, wie ein altes Waschweib. Eigentlich hatte mir meine Arbeit immer einigermaßen Spaß gemacht, aber in den letzten Monaten hatte mich nur noch der Gedanke an die wirklich gute Bezahlung ein wenig motivieren können. Wie es weitergehen sollte, wusste ich nicht. Für eine Kündigung fehlte mir der Mut und ich hatte keine Lust auf einen anstrengenden Bewerbungsprozess, Probezeit und neue Kollegen. Ich hatte aber auch keine Lust auf Ben. So verharrte ich einfach da, wo ich war, versuchte es mir erträglich zu machen und verbot mir energisch jeden Gedanken an die Zukunft.
Ich betrachtete mein Bild in dem großen Spiegel im Flur und fragte mich, warum ich mir gerade jetzt Gedanken darüber machte. Bisher hatte ich es immer geschafft nicht viel über mein Leben und meine Ziele nachzudenken. Ich hatte Ziele gehabt, Träume, Pläne, aber irgendwie waren sie mit der Trennung von Arndt gestorben. Vielleicht auch schon viel früher, ohne, dass ich es wirklich realisiert und bemerkt hätte.
Ob ich glücklich war oder nicht, hatte ich mich lange nicht mehr ernsthaft gefragt. Eine Antwort darauf hätte ich ohnehin nicht gefunden. Große Emotionen, Gedanken, Träume und Gefühle erlaubte ich mir schon lange nicht mehr. Ich hatte beschlossen, dass sie mir nicht gut taten und ich sie auch nicht brauchte. Damit ging es mir eigentlich gut, oder zumindest fühlte ich mich okay. Probehalber lächelte ich meinem Spiegelbild zu.
Ich fuhr mir mit der Hand durch die Haare und starrte weiter in den Spiegel. Die Frau, die ich sah, war groß, sehr schlank, fast ein wenig zu dünn und hatte lange blonde Haare und große blaue Augen, um die heute dunkle Schatten lagen. „Für fast dreißig ganz gut gehalten“, unkte ich und grinste schief in den Spiegel. Mein Spiegelbild zog eine Grimasse.
Ich ging in die Küche, um Kaffee zu kochen, danach würde ich den Tag mit Wolldecke und Schokoladenkeksen vor dem Fernseher verbringen. „Das bringt dich auf andere Gedanken und morgen ist alles wieder im Lot“, sagte ich zu mir selber. „Du bist nur müde und erschöpft, wenn du ausgeruht bist, sieht die Welt wieder ganz anders aus.“ Das Telefon klingelte. Ich zuckte zusammen. Mara wartete kaum ab, dass ich mich gemeldet hatte, sondern plapperte sofort los.
Sie hätte gestern mehrfach versucht, mich zu erreichen, sie hätte auf den Anrufbeantworter gesprochen, auf dem Handy hätte sie mich auch nicht erreicht. Wo ich, um Himmelswillen, gewesen bin, wollte sie wissen und außerdem hätte sie sich ernsthaft Sorgen gemacht. Ich musste lachen, Mara war unglaublich. Nach unserem frostigen Abschied am Samstag hätte manch anderer distanziert oder abwartend reagiert. Nicht so Mara. Ich war mit einem Mal unglaublich froh, dass es sie gab und wunderte mich gleichzeitig, woher all die großen Emotionen kamen, die mich seit gestern ständig überraschten. Ich wollte gerade ansetzten zu erzählen, dann stockte ich und hielt inne. Was sollte ich Mara erzählen? Dass ich im warmen Sand am Meer getanzt hatte, dass ich Faolanes Amulett trug, dass ich mitten im Hamburger Naherholungsgebiet einen Wolf gesehen hatte und durch Nebel in eine andere Welt gewandert war? Und dass diese Welt Salandor hieß und seit diesem Moment mein Leben irgendwie anders war und sich auch komplett anders anfühlte? Sie würde mich für einen durchgeknallten Idioten halte und ich konnte mich glücklich schätzen, wenn Sie mir nicht in kürzester Zeit ein paar kräftige Männer in weißen Kitteln ins Haus schicken würde. Mara wartete meine Antwort zum Glück nicht weiter ab, sondern fragte gleich weiter: „ Bist du krank? Ich hatte schon im Büro versucht dich zu erreichen, aber dein ach so liebreizender Kollege sagte mir, dass du zu Hause bleiben willst.“ „Es geht mir gut. Ich hab mich nur ein bisschen erkältet und dachte, dass ich besser im Bett bleibe, damit es mich nicht schlimmer erwischt“, wich ich ihren Fragen aus.
Dann holte ich tief Luft und traf eine Entscheidung. „Mara, hast du heute Nachmittag Zeit, können wir uns sehen?“ Sie war irritiert. „Ist alles in Ordnung bei dir?“, fragte sie, „du klingst so komisch.“
„Ja, alles in bester Ordnung“, sagte ich und hörte selber die Zweifel in meiner Stimme. „Hast du Zeit?“ „Ja klar“, sagte sie, „ich kann wohl gegen halb vier Feierabend machen und dann komme ich bei dir vorbei. Oder wollen wir lieber irgendwo hingehen, in ein Café oder Restaurant?“ „Nein Mara, komm bitte hierher. Ich möchte gerne in Ruhe mit dir sprechen.“ „Oh Gott, das klingt ja geheimnisvoll“, sagte sie, „hast du gestern deinen Traummann kennen gelernt und willst mir heute erzählen, dass du ihn heiraten wirst, und mit ihm in Grönland leben willst, oder was ist es?“ Sie kicherte und ich musste grinsen. Wenn es das wäre, wäre es zumindest noch erklärbar und realistisch. Ich unterdrückte ein hysterisches Kichern. „Nein, keine Sorge“, versuchte ich sie und vor allem mich selber zu beruhigen, „alles in bester Ordnung, ich will nur in Ruhe mit dir reden und nicht in einer vollgestopften Bar oder in einem Café. Meine Stimme klang leicht gepresst. „Und dir Geschichten von Wölfen, Nebel und Parallel-Welten erzählen“, setzte ich im Geiste nach und mir wurde etwas übel.
„Okay, dann bin ich um vier bei dir und ich bringe Kuchen mit, okay? Hast du noch den leckeren Cappuccino, den wir neulich getrunken haben?“
Typisch Mara, sie dachte auch immer nur ans Essen. Wahrscheinlich würde sie während ihrer Schwangerschaft kugelrund werden und dabei unglaublich süß aussehen. Ich lächelte und wir verabschiedeten uns.
„Oje“, dachte ich, „sollte ich ihr wirklich davon erzählen?“ Mara war verrückt, sensibel und meine allerbeste Freundin, aber ob sie mir das abnehmen würde? Ich musste mit irgend-jemandem darüber sprechen, sonst würde ich noch durchdrehen, entschied ich und Mara war die Richtige, wenn es überhaupt den oder die Richtige für solch eine Geschichte gab. Was, wenn ich wirklich krank war und mir alles nur einbildete? Meine Hand berührte das Amulett und ich seufzte tief. Ich ließ mich auf die Couch fallen und schaltete den Fernseher ein. Die Krisen anderer Leute, die das Fernsehen mehr oder weniger gekonnt in Szene gesetzt hatte, waren im Moment eindeutig leichter zu ertragen, als meine eigenen.
Um kurz vor vier klingelte es an meiner Tür. Ich hatte es immer noch nicht geschafft, mich aufzuraffen oder mich gar anzuziehen, so öffnete ich im Bademantel und mit dicken Wollsocken an den Füßen die Tür. Mara umarmte mich herzlich und sah mich dann mitleidig an. „Du siehst wirklich schrecklich aus“, sagte sie. „Danke“, sagte ich trocken, „jetzt fühle ich mich doch gleich richtig gut.“ Mara ging an mir vorbei und steuerte direkt auf die Küche zu. „Ich koche uns jetzt eine Kanne Tee und dann geht es dir gleich viel besser“, sagte sie und lächelte mich aufmunternd an. Ich schlurfte hinter ihr her und die Gedanken in meinem Kopf drehten sich. Sollte ich ihr wirklich davon erzählen? Vielleicht war es doch besser, das Ganze als das abzutun, was es wahrscheinlich war: ein sehr realistischer Tagtraum oder eine Halluzination. „Hübsche Kette“, sagte Mara in diesem Augenblick und zeigte auf mein Amulett. „Hat sie etwas damit zu tun, was du mir erzählen willst? Ich bin ja schon so gespannt.“ Wir setzten uns an den Küchentisch und ich griff hastig nach meinen Zigaretten. Mara schüttelte den Kopf und sah mich bittend an. „Lana, bitte, ich hab dir doch gesagt, dass ich schwanger bin. Wäre es okay, wenn du hier drinnen nicht rauchst?“ „Okay“, sagte ich und stopfte die Zigarette wieder in die Schachtel. Fahrig knete ich meine Hände. „Schieß los“, sagte Mara und schob sich ein großes Stück Kuchen in den Mund.
Eine Stunde später standen wir auf dem Balkon. Mara zog tief an einer Zigarette und starrte ins Leere. „Das kann nicht sein“, sagte sie zum ungefähr hundertsten Mal in den letzten zehn Minuten. „Aber was, wenn du doch nur geträumt hast?“, fragte sie, ebenfalls schon zum hundertsten Mal. „Aber was ist mit dem Amulett? Was ist mit der Panik, die mich überfällt, wenn ich es ablege?“ Ich sah sie kläglich an. „Ich kann es doch selber alles gar nicht glauben, aber jetzt, wo ich dir davon erzählt habe, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es wirklich passiert ist.“
„Was willst du jetzt tun?“, fragte Mara mit einem Mal ganz pragmatisch. „Na was wohl? Ich gründe eine Firma und organisiere Reisegruppen nach Salandor“, sagte ich trocken. „Was soll ich schon tun? Ich werde es vergessen, jedenfalls irgendwann. Ich werde einfach wieder so leben, wie immer. Gib mir noch ein oder zwei Tage, dann bin ich wieder okay und dann kann ich auch diese Kette ablegen. So hübsch ist sie nämlich gar nicht.“
„Und was, wenn das ein Zeichen ist?“, spekulierte Mara verträumt. „Eine Art Bestimmung, dein Schicksal?“ „Hör auf“, sagte ich energisch. Ich wollte nicht zugeben, dass dieser Gedanke in meinem überreizten Gehirn auch schon mehrfach aufgeflackert war.
Ich umarmte meine Freundin und drückte sie fest an mich. „Danke“, sagte ich leise, „Danke, dass es dich gibt und danke dafür, dass ich dir so etwas erzählen kann und du mich nicht gleich für vollkommen verrückt erklärst. Und…“ Ich stockte. Entschuldigungen waren nicht meine Stärke. „Es tut mir leid wegen Samstag, ich freue mich für dich und egal, wie du dich entscheidest, ich stehe immer zu dir und bin für dich da“, sagte ich leise.
Mara sah mich an und ich sah, dass sie Tränen in den Augen hatte. „Ich hab dich so lieb“, sagte sie und dann versagte ihre Stimme. Wir gaben ein seltsames Bild ab, zwei dick eingepackte Gestalten auf einem Balkon mitten in Hamburg, die sich wie zwei Bojen aneinander kuschelten. Das erste Mal seit meiner unfreiwilligen Reise fühlte ich mich einigermaßen gut.
Die Luft war stickig und verraucht. Ich nahm einen großen, letzten Schluck aus meinem Glas und lächelte den Typen, der neben mir am Tresen lehnte, herausfordernd an. Er grinste, kam ein Stück näher und fragte: „Kann ich dir noch was bestellen?“ „Gerne“, sagte ich und versuchte ein laszives Lächeln. Mit einer fahrigen Bewegung strich ich mir eine Strähne aus dem Gesicht. Mir war etwas übel. Eigentlich trank ich nicht besonders viel, sondern kannte recht genau den Punkt, an dem ich von Cocktails auf Wasser umsteigen musste. Aber heute war es mir egal. Ich wollte Spaß haben, feiern und vergessen. „Ich heiße Karl“, sagte er und prostete mir zu. „Oh Gott, wie kann man denn Karl heißen“, dachte ich, unterdrückte ein aufsteigendes Kichern und hob ebenfalls mein volles Glas. „Lana“, sagte ich und fuhr mir wieder mit der Hand durch die Haare. Mir war ziemlich schwindelig.
Eigentlich sah er nicht schlecht aus. Genau das, was ich heute Abend brauchte, ein netter, gutaussehender Mann, eine Menge Alkohol und paar schöne Stunden, danach sehr viel tiefen, traumlosen Schlaf. Ich plauderte ein paar Belanglosigkeiten mit Karl und wippte im Takt der Musik, die aus den Boxen dröhnte. Mein Kopf tat mir höllisch weh.
Er erzählte von seinem Motorrad und dass er davon träumte, einmal die Route 66 zu fahren. Ich verstand nur die Hälfte, weil es so laut war, aber es war mir auch egal. Ich wollte nichts von ihm wissen. Er und seine Träume interessierten mich nicht im Geringsten, nur ob er später mit mir nach Hause gehen würde und mir ein paar Stunden gnädiges Vergessen schenken würde. Ich zwang mich, ihn wieder interessiert anzusehen und zündete mir noch eine Zigarette an.
Irgendwann legte er fast beiläufig eine Hand auf meinen Arm. Läuft doch gut, dachte ich und schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln. Gerade als er sich dichter zu mir herüber beugte, erschien eine adrette, rothaarige Frau neben Karl. Sie war sehr, sehr wütend und brüllte ihn an, was ihm eigentlich einfiel und wieso er sie einfach alleine stehen ließ. Sie schimpfte immer lauter, ihre Stimme klang hysterisch und überschlug sich fast. Er starrte sie mit ergebenem Dackelblick an und es hätte wohl nicht viel gefehlt, er hätte vor ihr Männchen gemacht. Sie ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und zeterte in derselben Frequenz weiter. Er schaute betreten zu Boden und ich wand mich rasch ab, ein streitendes Paar passte nicht in meine Abendplanung. „Halb zwei in der Nacht. Ich bin reichlich betrunken und habe höllische Kopfschmerzen. Nicht gerade die besten Voraussetzungen jetzt noch jemanden zu finden, der mir einfach ein paar Stunden das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein“, dachte ich. Ich fühlte mich elend und müde. Warum in aller Welt lief seit drei Wochen eigentlich nichts mehr wie früher. Ich berührte leicht das Amulett an meinem Hals und erschauerte. Zweimal hatte ich in den letzten Tagen den Versuch unternommen, es abzunehmen. Es war der blanke Horror gewesen. Mein Körper reagierte darauf, wie ein Drogensüchtiger auf den Entzug und erst wenn ich es irgendwie fertig gebracht hatte, die Kette mit zitternden Fingern wieder zu befestigen, beruhigte sich mein Körper.
Ich hatte Mara davon erzählt, sie versuchte mir Mut zu machen. Sie meinte, dass alles irgendwie noch viel zu frisch wäre und ich mir einfach mehr Zeit geben sollte. „Das ist sicher nur psychisch“, hatte sie dann gesagt, und doch hatte ich den Zweifel in ihrer Stimme gehört.
Nach diesem Montagnachmittag hatten wir das Thema Salandor gemieden. Es schien, als wenn wir beide es aus unserem Kopf verdrängen wollten, in dem wir nicht mehr darüber sprachen. Es war etwas, dass so wider den Verstand war, so wider jede Vorstellungskraft, dass es wohl am leichtesten war, es einfach zu verdrängen und es irgendwann zu vergessen. Ich war mir mittlerweile selber kaum noch sicher, was ich glauben sollte. Wie erst sollte Mara damit umgehen. Ich konnte mich ja schon freuen, dass sie mich nicht gleich auf der Stelle für total verrückt erklärt hatte.
Und doch, es gab keinen Tag an dem ich nicht eine Sehnsucht verspürte. Eine tiefe, unbestimmte Sehnsucht nach etwas, das ich nicht einmal benennen konnte und die ich nicht befriedigen konnte, in dem ich mich mit anderen Dingen ablenkte oder belohnte.
Um mich herum drehte sich alles. Die Musik schien noch lauter geworden zu sein.
Ich taumelte fast zur Tanzfläche, ein Mann stand am Rand, er schaute auf und unsere Blicke trafen sich für einen winzigen Augenblick und ich murmelte verwirrt: „Dornat?“ So sehr erinnerten mich die dunklen Augen an den Mann am Strand von Salandor. Ich sah mich hektisch um, der Mann war verschwunden. „Oh Gott“, stöhnte ich und faste mir an den schmerzenden Kopf.
Ich rüttelte den Mann neben mir, er schien zu schlafen, wie ein Stein. „Hoffentlich ist er nicht tot“, dachte ich einen Moment lang etwas panisch. Aber dann sah ich, wie sich seine nicht besonders ansehnliche Brust rhythmisch hob und senkte. Er gab ein tiefes Schnaufen von sich und wollte sich auf die andere Seite drehen, aber nun wurde ich energisch. „Aufwachen“, fauchte ich, „der Spaß ist vorbei.“ Er gab ein erneutes Grunzen von sich und öffnete die verquollenen Augen. Etwas irritiert schaute er mich an. „Los, die Nacht ist vorbei“, sagte ich unwirsch.
Er erhob sich und ich konnte mir noch einmal das komplette Ausmaß meiner Verzweiflung vor Augen führen. Er war klein, etwas untersetzt und hatte schon lichter werdendes Haar. Eine hohe Stirn und leicht vorstehende Augen rundeten mein Bild des Grauens ab.
Er grinste mich an und fragte, wie ich geschlafen hätte. „Schlecht und nun geh“, sagte ich noch energischer. Ich traute meinen Augen kaum. Der Typ war tatsächlich irritiert und enttäuscht. Was hatte der sich denn bloß vorgestellt? „Vielleicht könnten wir ja…“, startete er einen matten Versuch. „Ab sofort vergessen, dass wir uns jemals begegnet sind“, beendete ich seinen Satz trocken und zog die Decke bis zur Nasenspitze hoch.
Mühsam suchte er seine Klamotten zusammen. Sein Hintern war eindeutig zu dick. Mir tat der Kopf weh, aber trotz einiger Erinnerungslücken war mir doch bewusst, dass das hier eine Verzweiflungstat gewesen war. Eine nicht besonders befriedigende noch dazu.
Wenn ich ehrlich zu mir war, war ich so betrunken gewesen, dass ich mich kaum noch daran erinnerte, wie er hier in die Wohnung gekommen war. Er war einer der letzten Gäste im Club gewesen. Ich war sehr durcheinander, betrunken und vor allem hatte ich mich schrecklich haltlos und alleine gefühlt. Keine gute Voraussetzung für einen netten, entspannten One-Night-Stand. „Dann wird das wohl eher nichts“, maulte der Mann, dessen Name mir auch diesmal nicht wieder einfiel und schlurfte Richtung Flur. „Oh Gott, hoffentlich sehe ich den nie wieder“, dachte ich und verdreht die Augen. Eigentlich sollten Männer einen Führerschein für Frauen machen, bevor man sie auf die Damenwelt los ließ. Dieses Exemplar hatte jedenfalls noch sehr, sehr viele Übungsstunden vor sich und ich würde sie ihm definitiv nicht erteilen.
Ich hatte das dringende Bedürfnis zu duschen und das Bett musste neu bezogen werden.
Als ich aufstand, wurde mir schlecht. Ich würgte, bis ich nur noch Galle spuckte. „Warum hat man eigentlich nie einen Eimer zur Hand, wenn man ihn braucht“, japste ich, zwischen zwei Würg-Attacken.
Mein Kreislauf brach fast zusammen und ich konnte mich nur noch rückwärts aufs Bett fallen lassen. Kalter Schweiß stand mir auf der Stirn. „Jetzt nur nicht bewusstlos werden“, sagte ich zu mir selbst und wartete ab, dass das Zimmer aufhörte, sich um mich zu drehen.
Viel später hatte ich es geschafft aufzustehen und mein Schlafzimmer wieder in einen bewohnbaren Zustand zurück zu versetzen. Immer noch war mir leicht übel und schnelle Bewegungen mit dem Kopf sorgten für verzerrte Doppelbilder.
Ich schaute aus dem Fenster auf die Straße und die graue Häuserfront gegenüber. Das Wetter entsprach genau dem, was man sich in Hamburg unter vorweihnachtlicher Witterung vorstellte. Es regnete Bindfäden, war kalt und Tag und Nacht ließen sich nur durch unterschiedliche Graustufen unterscheiden. Eine dicke Frau mit rotem Gesicht zerrte einen Hund hinter sich her, ein paar Jugendliche standen rauchend in einer Toreinfahrt, ansonsten war die Straße leer.
In einigen Fenstern gegenüber glitzerte Weihnachtsdekoration. Jemand hatte als Krönung des schlechten Geschmacks einen elektrisch beleuchteten Weihnachtsstern in eines der Fenster gehängt, der im Sekundentakt seine Farbe veränderte.
Ich nippte an meinem heißen Kaffee, knabberte an einem trockenen Keks und beobachtete das irre Farbenspiel. In meiner Wohnung gab es kein einziges Anzeichen für Weihnachten. Seit dem Tod meiner Eltern und der Trennung von Arndt hatte ich mich von Jahr zu Jahr mehr zu einem regelrechten Weihnachtshasser entwickelt und versuchte, die Tage einfach nur unbeschadet, ohne größere Depressionen oder Gefühlsausbrüche zu überleben. In den letzten beiden Jahren hatte ich freiwillig gearbeitet, den Nachmittag in einer der letzten geöffneten Shopping Malls verbracht und abends eine der vielen Partys besucht, auf denen die Gäste versuchten der braten-, tannenbaumseligen, heilen Familienwelt zu entfliehen. Jedenfalls war das meine persönliche Interpretation. Einladungen von Freunden oder entfernten Verwandten lehnte ich kategorisch ab.
Es hatte immer funktioniert, ich hatte immer überlebt, aber dieses Jahr fühlte es sich an, als hätte jemand die Decke von meinen mühsam verstauten und zugedeckten Emotionen und Gefühlen gezogen. Egal was ich auch anstellte, ich fand einfach nicht mehr zurück zu dieser inneren Ruhe, die eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber war, eher einer Lethargie ähnelte. Der Regen wurde stärker, der Wind peitsche die Tropfen gegen die Scheibe.
„Wie gut, dass die Häuser innen hohl sind“, murmelte ich und dachte dabei an meinen Vater, der diese Weisheit gerne zum Besten gegeben hatte.
Ich beschloss, mich aus meinen trüben Gedanken zu reißen. Sonnenbank, Pizza und eine DVD würde den restlichen Sonntag retten. Ich zog mich mühsam vom Sofa hoch und mein Blick fiel noch einmal auf eines der gegenüberliegenden Fenster. Eine Frau stand dort und schaute zu mir herüber, sie hatte ihr weißes Haar zu einem Zopf geflochten und ihre Augen schienen mir direkt auf den Grund meiner Seele zu sehen. Ich konnte es aus dieser Entfernung auf keinen Fall erkennen, aber ich war mir sicher, dass ich sie kannte. Von irgendwoher. Ihre Augen waren nicht bernsteinfarben, sondern dunkel. Trotzdem erinnerte sie mich an sie. „Faolane“, rief ich und erst beim Klang meiner eigenen Stimme, bemerkte ich, dass ich laut gerufen hatte. Ich versuchte mit hektischen Blicken, die Frau am Fenster wieder zu finden, aber sie war verschwunden. Ich holte tief Luft. Das Amulett fühlte sich warm, fast heiß auf meiner Haut an.
Fünf Wochen waren seit meinem unfreiwilligen Ausflug vergangen und ständig sah ich Trugbilder aus Salandor vor mir. Das Amulett schien immer stärker ein Teil von mir zu werden. Der Gedanke, es abzulegen wurde von Tag zu Tag unerträglicher. Es war als hätte dieser Tag alles verändert und in mir mühsam geschlossene Ventile geöffnete. Die Emotionen sprudelten nun ungehindert hinaus und ich hatte keine Chance, irgendetwas dagegen zu tun oder mich nicht damit zu beschäftigen.
Ich hatte wieder und wieder versucht es zu verdrängen. Ich hatte mich betrunken, exzessiv gefeiert, hatte versucht, mich mit Arbeit abzulenken. Ich hatte versucht, zu vergessen, zu ignorieren und jedes Mal wenn ich mich am Ziel glaubte, wenn ich es schaffte mich einige Stunden in Lethargie oder Ablenkung zu flüchten, verfolgte mich wieder eine Illusion, ein Trugbild oder irgendetwas, dass mich erinnerte.
„Ich kann nicht mehr“, sagte ich laut, meine Stimme klang kläglich. Tränen liefen mir über das Gesicht, ohne dass ich irgendetwas dagegen tun konnte.
In meinem Kopf erklang eine Stimme, die ich nie zuvor gehört hatte und die mir doch so vertraut schien. Warm und weich, fast als wenn mir jemand sanft übers Haar streicheln würde, sagte sie: „Hör auf, fortzulaufen, Lana, hörst du? Hör auf!“
„Aber ich laufe doch gar nicht fort“, stammelte ich unter Tränen. Die Stimme war verschwunden und plötzlich halte es wie Echo in meinen Ohren: „Wenn du Sehnsucht nach Salandor hast….“ Es durchzuckte mich, wie ein Blitz. War das eine ernsthafte Option? Ich zündete mir eine Zigarette an und dachte nach. Hätte man mir erzählt, dass ich irgendwann ernsthaft darüber nachdenken würde, auch nur aus Hamburg wegzuziehen, ich hätte denjenigen für vollkommen verrückt erklärt und nun dachte ich darüber nach, wer weiß wohin zu gehen. Komischerweise war ich das erste Mal seit dem Tag in Salandor innerlich ganz ruhig. Eine warme Woge bauschte sich in mir auf und ich spürte es mit einem mal ganz deutlich: Sehnsucht.
Ich verschwendete nur einen sehr kurzen Gedanken daran, dass es nicht klappen würde, Salandor noch einmal zu finden. Vielleicht war das bereits das Anfangsstadium des Wahnsinns?
Ich polterte gegen die Tür. „Alles in Ordnung, Mara?“ fragte ich. Von drinnen kamen eindeutige Geräusche. „Oh Gott“, hörte ich dann ihre Stimme. „Es ist, als wenn sich dein ganzer Magen auf links dreht und das jeden Tag aufs Neue.“
Sie öffnete die Tür. „Du bist ganz grün“, sagte ich. „Danke für die Blumen“, maulte Mara. „Es geht mir ohnehin schon schlecht, da wäre es doch schön, wenn du ein paar positive Worte für mich finden würdest. Ja, ich hab auch trotz der ewigen Spukerei schon sechs Kilo zugenommen. Willst du darüber auch noch etwas sagen“, maulte sie weiter. „Aber“, stammelte ich hilflos. Ihre Stimmungsschwankungen waren enorm. „Hilfe“, sagte sie dann plötzlich schwach und trat den Rückweg zur Toilette an. Ich wandte mich ab und unterdrückte ein Würgen.
„Der Frauenarzt sagt, dass es bald vorbei sein wird. Es ist wohl ziemlich normal“, sagte sie etwas später, als wir auf ihrem gemütlichen Cordsofa saßen. Um uns herum standen mehrere Umzugskartons und wartetet darauf, gepackt zu werden. Weil Mara aber ständig übel wurde, kamen wir nicht recht voran. Ein Plüschteddy lag auf dem Boden inmitten des Chaos und sah uns fast vorwurfsvoll an.
„Danke, dass du mir hilfst“, sagte Mara. Ihre braunen Augen strahlten. „Weißt du“, begann sie vorsichtig, „ich hab immer noch das Gefühl, dass es genau das Richtige ist. Das erste Mal in meinem Leben bin ich mir sicher, dass es so sein soll. Das Baby, Tom, der Umzug, nichts davon beunruhigt mich, sondern ich fühle einfach nur Glück und bin gespannt auf alles was nun kommt.“ Sie sah mich erwartungsvoll an und hatte wohl immer noch meine erste Reaktion vor Augen, für die ich mich immer noch schämte.
Ich lehnte den Kopf an ihre Schulter und schluckte hart. „Ach Mara, ich freu mich so für dich“, sagte ich leise. Ich meinte es diesmal wirklich so, wie ich es sagte.
Ich glaube, es gibt keinen passenden Zeitpunkt der schwangeren, besten Freundin zu erzählen, dass man die Stadt verlassen will. Wie sollte es also einen perfekten Zeitpunkt dafür geben, ihr zu erzählen, dass man plante, etwas völlig Verrücktes zu tun? Etwas, das völlig außerhalb des geistigen Fassungsvermögens liegt. Wie sagt man jemandem, dass man ernsthaft erwägt, in ein Traumland zu gehen, von dem man selber nicht mal sicher wusste, ob es wirklich existiert und ob man wirklich dorthin gehen kann.
Da Mara aber meinen Bericht über meine erste, unfreiwillige Reise gut aufgenommen hatte und mich wider Erwarten nicht in die Nervenklinik gebracht hatte, nahm ich meinen Mut zusammen und sagte:
„Mara, ich werde nach Salandor gehen.“ Sie schnappte hörbar nach Luft und öffnete den Mund. „Bitte Mara, lass mich ausreden. Das ist alles total kompliziert und wenn ich mich reden höre, weiß ich auch, wie bescheuert es klingt, von daher will ich es dir einfach nur erzählen, erklären kann ich es wohl ohnehin nicht.“ Sie machte den Mund wieder zu und umklammerte die Teetasse. Ihre Knöchel traten hervor. Ich wünschte mir sehnlichst eine Zigarette.
„Also“, fuhr ich hastig fort, „ich komme einfach nicht mehr zurecht. Verstehst du, was ich meine? Es ist, als wenn mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen hätte, ich schaue in den Spiegel und erkenne mich selber nicht mehr. Ich hab das Gefühl, ich bin wie in einem Nebel und überall sehe ich Trugbilder aus Salandor. Ich habe so sehr versucht, es zu vergessen. Ach Mara, du hast ja mitbekommen, was ich in den letzen Wochen alles angestellt habe und doch, ich finde mich nicht mehr zurecht. Ich glaube, ich bin kurz davor, durchzudrehen und wahnsinnig zu werden.“ Ein Blick in ihre Augen verriet mir, dass sie der Meinung war, dass dieser Zustand bereits eingetreten war. Ich schnappte hektisch nach Luft und merkte, dass mein Gesicht bereits wie im Fieber glühte. „Mara, ich kann nicht mehr“, krächzte ich, „alles, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, holt mich ein. Nur der Gedanke, dass ich noch einmal versuchen könnte „DORTHIN“ zu gelangen, lässt mich irgendwie zur Ruhe kommen. Das Amulett ist wie ein Anker für mich geworden. Wenn ich es berühre, komme ich ein wenig zur Ruhe und zu mir selber….“
„Wie wäre es vielleicht doch mit einer Psychotherapie?“, fragte Mara hart.
„Mara“, ich weinte nun fast, „ich weiß, nein, ich bin mir sicher, dass ich nach Salandor gehen muss und dann wird alles wieder gut. Es ist mein Weg, mein Schicksal, meine einzige Chance, die ich im Moment noch habe. Hier geht es nicht mehr weiter.“
Sie schwieg und betrachtete scheinbar interessiert den Rand ihrer Teetasse.
Tränen rannen mir übers Gesicht.
„Okay“, sagte sie dann tonlos. „Mal angenommen, dass das was du gerade erzählt hast nicht total irrsinnig wäre und nicht klingen würde, wie aus einem sehr schlechten Kitschroman, sondern, sagen wir mal vorsichtig, eine Art realen Bezug hätte. Wie genau willst du das anstellen? Hast du eine Art Masterplan, wie man durch die Dimensionen reist?“ „Ach, und außerdem, bevor ich es vergesse, deine Phantasie und schauspielerische Gabe ist beeindruckend, du solltest über einen Jobwechsel nachdenken.“ Sie grinste schief.
Ich schnaufte und versuchte zu sprechen, ohne, dass meine Stimme zitterte.
„Ich hab mir überlegt, dass ich es einfach versuchen werde. Faolane hat mir erzählt, wann die beste Zeit fürs Reisen ist und außerdem habe ich das Amulett. Aber vorher muss ich ein paar sehr weltliche Dinge klären. Ich hab ja keine Ahnung, was passiert, ob es überhaupt klappt, und wann ich zurückkomme.“
Mara grinste immer noch schief und sagte dann trocken: „Nur noch mal zum Verständnis, wir sprechen hier über einen völlig fiktiven Plan und wenn das Gespräch zu Ende ist, vergessen wir alles, aber wirklich alles, was in den letzten Minuten gesprochen wurde, oder?“
„Ich muss meinen Job kündigen, Versicherungen und Prämien aussetzen und meine Wohnung untervermieten. Ich möchte dich bitten, das Finanzielle über dein Konto zu regeln. Ich habe keine Lust, als vermisst, oder verschollen zu gelten. Viele werden es ohnehin nicht sein, die mich vermissen, aber die Wenigen sollten einfach glauben, dass ich ausgestiegen bin. Sag doch einfach Südamerika oder Karibik, Selbstfindung in Indien oder was auch immer.“ Ich hatte immer schneller gesprochen und holte nun tief Luft. „Du meinst das tatsächlich ernst, oder?“ fragte Mara plötzlich und ich nickte stumm.
„Warum bin ich eigentlich nicht in der Lage, wenigstens einmal pünktlich zu sein“, schimpfte ich mit mir selber, während ich fast im Laufschritt den langen Flur hinunter lief. Die meisten Bürotüren waren verschlossen, die Deckenbeleuchtung schaffte es kaum, den steril wirkenden Flur zu erhellen. Ich hielt kurz an, atmete tief durch und strich meinen kurzen Rock glatt. Dann klopfte ich entschlossen an die Tür. Auf ein kurzes, barsches „Herein“, trat ich ein. Am Tisch saßen mein Personalchef und mein direkter Vorgesetzter. „Jetzt nur nicht nervös werden, Lana“, mahnte ich mich selber. „Frau Mey, guten Tag, möchten Sie einen Kaffee?“ Ich nickte. Nach den üblichen Höflichkeitsfloskeln wurde es ernst. „Sie hatten um dieses Gespräch gebeten. Was können wir für Sie tun?“, fragte der dicke Herr Manthey. Ich konnte mir nicht helfen, jedes Mal wenn ich ihn sah, erinnerte er mich an eine überfütterte französische Bulldogge. Mein Chef, ein kleiner drahtiger Mann mit unglaublich hellblauen Augen fixierte mich über seine randlose Brille. Ich räusperte mich. „Keine Schwäche zeigen. Du weißt, was du willst, Lana“, murmelte ich tonlos. Wie zur Bestätigung meines Vorhabens wurde die Stelle an meinem Hals, an der das Amulett meine Haut berührte, leicht warm und prickelte. Es war kein unangenehmes Gefühl. Nachdem Mara sich von dem ersten Schrecken erholt hatte und mehrere Male gefragt hatte, ob es mir tatsächlich gut ging, war sie, wenn auch mit großen Zweifeln, bereit meinen Plan zu unterstützen. Allerdings ging sie davon aus, dass ich, nachdem alles geklärt war, einen kurzen Trip in den Wald unternehmen würde und dann dreckverschmiert und durchgefroren bei ihr vor der Tür stehen würde und einsehen musste, dass es da nichts gab, wo ich hätte hingehen wollen oder können. „Du kannst dann ja hier wohnen, meine Wohnung ist ja ohnehin noch nicht neu vermietet“, hatte sie lakonisch gesagt. Sie war es auch, die die Idee gehabt hatte, um ein Jahr unbezahlten Urlaub zu bitten. „Erzähl denen irgendetwas von Selbstfindung oder Vergangenheitsbewältigung“, hatte sie gesagt, „aber kündige um Himmelswillen nicht deinen Job. Überleg doch mal. Wenn, wovon ich ausgehe, doch alles anders kommt, musst du doch von irgendwas leben, oder? Ein Jahr kannst du vielleicht irgendwie überbrücken, aber danach hättest du wieder ein Einkommen.“ Sie hatte wieder einmal Recht. Der Job war gut bezahlt und meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt rechnete ich mir nicht besonders hoch aus. Vielleicht war es das Beste so. Wenn es denn funktionierte.
Komischerweise war plötzlich alles ganz einfach. Ab Februar würde ich freigestellt sein und konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich war fast erschrocken, wie leicht das alles gewesen war. Mein Chef gab mir noch den Tipp, mir auf jeden Fall Indien anzusehen. Ich hatte von einer geplanten Weltreise erzählt, das erschien mir ziemlich hip, modern und nicht zu außergewöhnlich. Ich kehrte in mein Büro zurück und als mein Kollege mir den Rücken zudrehte, streckte ich ihm die Zunge heraus. Ich fühlte mich gut. Seit dem Tag, an dem ich den Entschluss gefasst hatte, ging es mir besser, das musste ich mir eingestehen. Ich nahm das Amulett in die Hand und drückte es leicht.
„Nimmst du die Wohnung?“, fragte ich und drehte mich auf den Bauch. Kai streckte sich und ich hatte eine gute Aussicht auf seinen durchtrainierten Oberkörper. „Ja“, sagte er gedehnt, „nachdem ich hier so nett aufgenommen wurde, kann ich ja fast nicht mehr nein sagen.“ Er grinste. Vor nicht ganz zwei Stunden hatte er an der Tür geklingelt, um sich meine Wohnung anzusehen, die ich in der Zeitung möbliert, zunächst für ein Jahr, angeboten hatte. Er war Unternehmensberater, soviel wusste ich schon. Er arbeitete viel und dachte darüber nach, noch einmal für einige Zeit ins Ausland zu gehen. Er wollte sich noch nicht festlegen und sich schon gar nicht mit dem Kauf einer Einbauküche und eines Ecksofas belasten.
„Wann genau kommst du wieder?“, fragte er. „Ich weiß es nicht genau“, sagte ich ehrlich, „aber wir werden uns einigen, du musst hier nicht sofort raus.“ „Ach“, sagte er grinsend und begann mit seinen schlanken Fingern Kreise auf meinen Rücken zu zeichnen, „wenn ich es mir recht überlege, würden wir es wohl sogar eine Zeitlang zusammen hier aushalten.“ Ich antwortete nicht.
In der nächsten Stunde machte ich mir wenig Gedanken über meine Zukunft, sondern schaffte es endlich einmal wieder, mich, meine wirren Gefühle und die Welt zu vergessen.
Die Zeit schien zu rasen. Ich überlebte die Weihnachtstage wie immer, verbrachte viel Zeit mit Mara, die mich nach wie vor von Zeit zu Zeit nach meinem Geisteszustand befragte, aber ansonsten, wie gewohnt in allen Dingen voll hinter mir stand. Ich ging mit auf die angekündigte Silvesterparty der Greenpeace Leute und hatte sogar ein wenig Spaß. Ich kümmerte mich um die Übergabe meiner Unterlagen im Büro und mietete einen kleinen Lagerraum, in dem ich meine persönlichen Dinge aus der Wohnung unterbringen wollte. Durch all die hektische Aktivität kam ich kaum zum Nachdenken und wenn ich doch einmal in die Verlegenheit kam, lenkte ich mich rasch ab. An jenem grauen Dezembernachmittag hatte ich eine Entscheidung getroffen und entgegen meines sonstigen Verhaltens und meiner sonstigen Lebensweise, stand ich zu dieser Entscheidung und fühlte mich eigenartigerweise erstaunlich gut damit. Eigentlich, wenn ich intensiv darüber nachdachte, konnte ich mich kaum an eine Zeit erinnern, in der ich mich so klar, so geerdet und so sicher gefühlt hatte. Das Amulett war mittlerweile ständig warm und wenn ich es berührte, durchfuhr mich häufig eine Welle von Geborgenheit und Glück.
Ich stellte den gepackten Rucksack aufs Bett, zündete eine Zigarette an und sagte laut: „Fertig!“ Was nahm man mit auf eine Reise, die man eigentlich gar nicht machen konnte? Ich hatte mich für Zigaretten, ein wenig Kleidung, ein Bild meiner Eltern und einige andere mehr oder weniger wichtige Dinge entschieden. In das obere Fach des Rucksacks stopfte ich jede Menge Schmerztabletten und ein paar Pflaster und Kondome. Man konnte ja nie wissen…. Es klingelte an der Tür. Es war Mara. Die Schwangerschaft stand ihr gut, die Übelkeitsattacken hatten endlich nachgelassen und ihr Gesicht strahlte eine wunderschöne Gelassenheit aus, die fast überirdisch wirkte. Ihr Bauch war bereits deutlich gerundet und sie hatte eigentlich ständig Hunger.
„Hallo meine Liebe“, sagte sie und drückte mich fest an sich. „Nun ist es also soweit“, murmelte sie, es klang fast wie eine Frage. „Eigentlich muss ich mich nicht von dir verabschieden“, fuhr sie dann leise fort. „Wir waren uns ja einig, dass sich das alles morgen in eine Illusion auflöst und du abends bei mir vor der Tür stehst.“ Sie schluckte hart. Ihr Lächeln wirkte gequält. „Aber nur für den Fall, dass du tatsächlich dahin gehst…“, sie stockte und drückte mir ein Päckchen in die Hand. „Mach es auf, wenn du da bist, okay?“, flüstere sie und drückte mich noch einmal an sich.
Wir versuchten, einen netten Nachmittag miteinander zu verbringen, merkten aber beide, dass wir unglaublich verkrampft waren. Unser Lachen war zu laut und die Gespräche zu platt, es war nichts von dem, was unsere Freundschaft eigentlich ausmachte.
Irgendwann stand Mara auf, drückte mich noch einmal fest an sich und sagte dann fast hastig: „Ich gehe jetzt, ich hab dich lieb. Ich bin immer für dich da, vergiss das nicht.“
Dann ging sie. Ich wusste, dass sie Abschiede hasste, aber kaum war die Tür hinter ihr zugeschlagen, hatte ich das Gefühl, dass ich ihr noch hundert Sachen sagen musste.
Ich ließ mich hinter der Tür auf den Fußboden gleiten und starrte ins Leere.
In dieser Nacht schlief ich kaum. Immer wieder ging ich durch meine Wohnung, die nun, da meine privaten Dinge ausgelagert werden, seltsam fremd und steril war. Ich stand am Fenster und starrte auf die Häuserzeile und nahm Abschied von jeder noch so kleinen Nebensächlichkeit, wie dem leisen Brummen der Heizung und der flackernden Leuchtreklame der Videothek gegenüber. Ich war melancholisch, aber merkwürdigerweise nicht wirklich traurig. Wenn es nach Mara ginge, war dies ohnehin nur eine Farce und morgen Abend würde ich zwar wohnungs- und arbeitslos bei ihr vor der Tür stehen, aber immer noch mit beiden Füßen in dieser Welt sein. Ich wusste nicht, ob ich darauf hoffen sollte.
Vielleicht hatte ich auch einfach schon zu viel verloren, um noch an irgendetwas festzuhalten und zu hängen. Ich versuchte, meine düsteren Gedanken zu unterbrechen und dachte an die kleinen Hütten, an die Wiesen im Sonnenschein, an das Meer, das an den Strand spülte und an das wunderbare Gefühl von Heimat, das ich an diesem fremden Ort erlebt hatte. Ich sah Faolane vor mir und ihre bernsteinfarbenen Augen schauten mir direkt ins Herz. Mit einem Lächeln auf den Lippen schlief ich endlich ein.
Der Wind heulte um das Haus und der Regen prasselte gegen die Scheibe, als ich erwachte. Ein Blick aus dem Fenster genügte, um mir zu zeigen, dass dies eindeutig ein sehr schlechter Tag für einen Waldspaziergang war. Aber bis heute Abend war noch etwas Zeit und vielleicht schlug das Wetter ja noch um. Ich hatte mich entschieden, auf die Dämmerung zu warten, auch wenn ich eigentlich kaum noch stillsitzen konnte. Laut meinem Kalender war heute Vollmond, allerdings würde ich wohl kaum etwas davon mitbekommen, da er sich hinter dicken Wolken verbergen würde. „Ob das entscheidend für das Gelingen der Reise ist?“, fragte ich mich laut. Der Tag zog sich quälend langsam dahin. Zum wiederholten Male begutachtete ich den Inhalt meines Rucksackes und stellte zum tausendsten Mal fest, dass ich in Wirklichkeit keine Ahnung hatte, was ich brauchen würde und ob ich überhaupt irgendwas brauchen würde. Am Nachmittag nahm ich eine lange, heiße Dusche. Mit geschlossenen Augen stand ich einfach da und ließ mir das heiße Wasser auf den Körper rieseln. Wie tausend kleine Nadelstiche traf es auf meine Haut und ich genoss die Hitze und den Dampf. Wie lange würde es dauern, bis ich wieder in den Genuss einer heißen Dusche kommen würde? Ich unterbrach diesen Gedanken abrupt. Ich schlüpfte in eine bequeme Jeans und zog einen dicken braunen Wollpullover an. Dazu trug ich meine neuen bequemen Wanderschuhe. Dann griff ich nach meiner Winterjacke, wickelte mir einen Schal um den Hals und schulterte meinen Rucksack. Einen Moment lang hielt ich vor dem Spiegel inne und betrachtete mich wie eine Fremde. Mein Gesicht war leichenblass, meine Augen leuchteten fast unnatürlich. Ich spürte das warme Pulsieren des Amuletts auf meiner Haut, fast wie einen Herzschlag.
Entschlossen wischte ich mir eine verräterische Träne aus den Augen, trat in den Flur und warf die Wohnungstür mit einem lauten Knall hinter mir zu. „Jetzt nur nicht mehr nachdenken“, sagte ich laut.
Die Fahrt zum Wald erlebte ich wie in Trance. Wie damals parkte ich mein Auto auf dem Parkplatz. Er war leer. Mittlerweile war die Dämmerung heraufgezogen. Es war dieses seltsame Licht zwischen Tag und Nacht, das die Umrisse der Bäume verschwimmen ließ und meine Phantasie begann, Kapriolen zu schlagen. Hatte sich da nicht irgendetwas bewegt, war da nicht ein Schatten hinter dem Farn gewesen? Mühsam stapfte ich weiter. Der Rucksack war höllisch schwer. Ich hatte beschlossen, es an derselben Stelle zu versuchen, an der ich damals unfreiwillig meine Reise angetreten hatte. Kälte kroch unter meine Jacke. Mittlerweile war das graue Zwielicht von der Dunkelheit fast verschluckt worden. Wolkenfetzen zogen schnell am Himmel entlang. Der Regen hatte aufgehört, aber der Mond war nicht zu sehen. Der Wind fuhr durch die kahlen Bäume, deren Äste knackten und ächzten. Das alte Herbstlaub wurde zu meinen Füßen umher gewirbelt und raschelte. Meine Zähne klapperten laut. Ich stolperte zum wiederholten Male und verfluchte zum hundertsten Mal den viel zu schweren Rucksack. Was, wenn ich die Stelle nicht fand? Würde ich mich im Dunkeln im Wald verlaufen und am Ende jämmerlich erfrieren? Ich kämpfte die aufkommende Panik nieder und versuchte mich auf das Amulett und seine Wärme zu konzentrieren. Der Weg vor mir war nicht mehr zu erkennen und ich hatte ohnehin die Orientierung fast verloren. Nur noch Glück konnte mich jetzt zu der Stelle zurückführen, an der ich damals den Weg nach Salandor gefunden hatte. Etwas streifte mein Bein und ich quietschte laut auf. Ein Nachtvogel schrie und etwas raschelte neben mir im Gebüsch.
„Ich hätte eine Taschenlampe mitnehmen sollen“, fluchte ich. Dann begann ich zu hysterisch kichern. Eine erwachsene Frau stapfte mitten im Winter im dunklen Wald umher, beladen mit einem riesigen Rucksack und suchte, ja nach was eigentlich?
Ich stolperte erneut und diesmal konnte ich mich nicht auf den Füßen halten und landete der Länge nach im nassen Laub. Gerade als ich mich aufrappeln wollte, gaben die Wolken den Blick auf den hellen, weißen Vollmond frei. Mir stockte der Atem, so unwirklich schön und gespenstisch zugleich waren der helle, weiße Mond, die dunklen Wolken, die vom Wind über den Himmel getrieben wurden und die schwarzen Baumwipfel, die sich als graue Schatten gegen den Nachthimmel abhoben. Das Amulett brannte jetzt fast schmerzhaft auf meiner Haut. Ich versuchte, den Schal beiseite zu schieben, um es zu berühren. In diesem Augenblick sah ich ihn und obwohl ich so darauf gehofft hatte, schrie ich leise auf. Ein weißer Wolf trat aus dem Nebel hervor und sah mich an. Seine Augen hatten die Farbe von flüssigem Gold. Kurz bevor ich irgendwas tun oder sagen konnte, legte das Tier den Kopf in den Nacken und stieß einen langen, klagenden Laut aus, der in meinen Ohren ein Echo verursachte. Ich schien einen Augenblick völlig körperlos zu sein. Mein Körper und mein Geist schienen sich voneinander zu trennen und ich wusste kaum noch, wo oder wer ich war. Die Welt um mich herum drehte sich und schien sich dann aufzulösen. Überall war irisierendes Licht und ich atmete den Geruch von schwarzer, feuchter Erde. Quälend langsam wurde mir schwarz vor Augen und ich sackte fast dankbar in die Dunkelheit, begleitet von dem Heulen des Wolfes, das zwischen den Welten widerhallte.