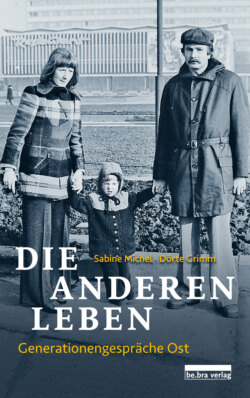Читать книгу Die anderen Leben - Sabine Michel - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеSeit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung stehen Menschen mit ostdeutschen Biografien vor den Herausforderungen einer gesamtdeutschen Gegenwart, die in ihrem identitätsstiftenden Selbstverständnis noch immer zu begreifen ist.
Mit der rasanten Installation westdeutscher Strukturen nach 1990 ist die Auseinandersetzung mit der Zeit des Lebens in der DDR sowohl gesellschaftlich als auch innerhalb der Familien weitgehend ausgeblieben. Wenn es Auseinandersetzungen mit der DDR-Vergangenheit gab, dann oft aus westdeutscher Sicht, die viele Ostdeutsche nicht als die ihre empfanden und in der ihr Anderssein meist als minderwertig und selbst verschuldet behandelt wurde. Dass die Zeit nach 1989 nicht nur Öffnung und viele Möglichkeiten, sondern auch massive persönliche Einschnitte für jeden Einzelnen bedeutete, fand lange kaum Eingang in die gesamtdeutsche Erzählung.
Im »Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit« heißt es 2019, dass sich über die Hälfte der Ostdeutschen als Bürger zweiter Klasse fühlen. Die letzte Bundestagswahl hat auch im Osten des Landes schockierende Wahlergebnisse hervorgebracht. Die demokratischen Strukturen der Bundesrepublik werden von einem erheblichen Teil der Bevölkerung als hohl empfunden und eine fremdenfeindliche, nationalistische Partei feiert Erfolge. Aus Sicht des Westens sollte die Wende 1989 den Osten in die westliche Wertegemeinschaft integrieren. Droht das zu scheitern? Im Osten haben sich das Erbe zweier Diktaturen und die Kränkung der Nachwendejahre in einem Teil der Gesellschaft zu einer demokratieskeptischen Haltung vermischt, die sich nun gegen den nächst »Schwächeren«, die Geflüchteten, das »Fremde« entlädt. Fragen nach dem Warum und Woher werden lauter und dringender. Wir brauchen generationenübergreifende, ehrliche Gespräche, die an die »DNA« Ostdeutschlands herangehen, in deren Diversität sich jede und jeder wiederfinden kann und die mit Schlagwörtern wie Stasi, Unrechtsstaat, Täter und Opfer nicht zu fassen sind.
In einer Szene ihres Dokumentarfilms »Zonenmädchen«, der ihren und den Werdegang ihrer Schulfreundinnen vor und nach dem Mauerfall skizziert, sitzt Sabine Michel mit ihrer Mutter an einem Tisch. »Nicht mal mir hast du erzählt, dass dein Vater Nazi war«, sagt sie zur Mutter. Die antwortet: »Wie willst du denn dann dastehen! (…) Hat eben auch fest gemacht. Hat eben auch härter gemacht. Ich war ein überängstliches Kind und ich wollte so sein wie die anderen.«
Diese Antwort ist ein exemplarischer Ausdruck der DDR-spezifischen Vereinnahmung des Privatlebens. Michels Eltern sind in der DDR mit ihren antifaschistischen und internationalistischen Idealen sozialisiert worden, haben die Wende als Lehrer durch- und überlebt und sind seit nunmehr dreißig Jahren offiziell Bundesbürger. Sie haben ihre Tochter liebevoll und ganz im Sinne der familiarisierten Struktur des sozialistischen Staates erzogen. Eine Auseinandersetzung mit ihrem Leben in der DDR hat bis heute nicht stattgefunden. Eine Kommunikation der Tochter mit ihren Eltern über den wirklichen DDR-Alltag als Fortwirken und ständige Neukonsolidierung autoritärer hierarchischer Strukturen mit wenig Toleranz gegenüber Veränderungen oder Neuerungen, über einen Antifaschismus als Teil der DDR-Staatsideologie und damit als Loyalitätsfalle und über den Versuch des Einzelnen, sich damit irgendwie zu arrangieren, ist immer noch schwer. Diese Filmszene war für Sabine Michel der Beginn der Auseinandersetzung mit der generationenübergreifenden andauernden Sprachlosigkeit in Ostdeutschland.
Dörte Grimm hat an der Seite ihrer Mutter in den Neunzigerjahren den Niedergang und Abbau eines großen Textilbetriebes miterlebt. Der Obertrikotagenbetrieb »Ernst Lück« in Wittstock ist durch die Dokumentarfilme von Volker Koepp bekannt geworden. Hier haben einmal 2 800 Menschen gearbeitet; 1992 wurde der Betrieb eingestellt. Dörte Grimms Mutter musste damals als Produktionsleiterin mehrere Hundert Arbeiterinnen und Arbeiter kündigen. Sie tat es, gegen ihre Überzeugung, und wurde dafür von ihren ehemaligen Kollegen und Kolleginnen angegriffen. Am Ende verlor sie selbst ihre Arbeit. Dieser doppelte Schmerz wirkt bis ins Heute; Kommunikation darüber ist emotional und schwierig. Als 2018 anlässlich des fünfzigsten Betriebsjubiläums das Wittstocker Museum die Türen zu einer Ausstellung öffnete, stellte man fest, dass das betriebseigene Archiv verschwunden war. Von fünfzig Jahren Betriebsgeschichte blieb kaum etwas; nichts, worauf man stolz verweisen, den Kindern erzählen konnte.
Dörte Grimm war zwischen 2016 und 2018 Vorsitzende des Vorstands der »Perspektive hoch drei«. So nennt sich eine Gruppe jüngerer Ostdeutscher der »Dritten Generation Ostdeutschland«, die sich vor zehn Jahren zusammentaten, als sie merkten, dass der Diskurs über Ostdeutschland medial und gesellschaftlich fast ausschließlich von Westdeutschen geführt wurde. Das wollten sie ändern, um Erfahrungen und Wissen von und über diese Generation in der gesamtdeutschen Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Dörte Grimm drehte über Vertreter ihrer eigenen Generation einen Dokumentarfilm: »Die Unberatenen. Ein Wendekinderporträt«. Als sie den Film, in dem auch persönliche Archivaufnahmen ihrer Kindheit zu sehen sind, ihren Eltern zeigte, verließen beide wortlos das Zimmer. Auch hier: Gefühlsstau.
Wenn der Staat DDR kritisiert wird, fühlen sich oft auch die Menschen kritisiert, die in ihm gelebt haben. Das macht Gespräche, auch innerhalb von Familien, über ihr Leben in der DDR so schwierig. Wenige Fragende nehmen eine Differenzierung zwischen Staatsform und alltäglichem Leben vor, aber auch nur wenigen Antwortenden gelingt es, eine Distanz zwischen eigenem Leben und dem Land, in dem sie gelebt haben, herzustellen.
In diesem Buch dokumentieren wir zehn Dialoggespräche zwischen ehemaligen »Wendekindern« – den zwischen 1970 und 1985 in der DDR Geborenen – und ihren Eltern. In ihnen kommen Menschen zu Wort, die von bis zu drei deutschen Staats- und Gesellschaftsformen geprägt wurden. Sie tauschen sich mit ihren Kindern aus und beginnen so auf ganz individueller Ebene eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Wohl wissend, dass es das Wendekind und die Eltern nicht gibt, haben wir Familien aus möglichst unterschiedlichen politischen, beruflichen und sozialen Schichten der DDR und heute der BRD ausgewählt – Familien aus Staats- und Kirchennähe sowie in verschiedenen Familienkonstellationen: eine alleinerziehende Lehrerin, die Mitglied der SED war; ein damals parteiloser LPG-Mitarbeiter; ein ehemaliger Major des Ministeriums für Staatssicherheit, heute erfolgreicher Mitarbeiter einer Bonitätsprüfstelle; eine Verwaltungsmitarbeiterin aus oppositionellen kirchlichen Kreisen; eine gelernte Löterin, die heute als Gebäudereinigungskraft arbeitet; eine Psychologin; eine Immobilienverwalterin, die SED-Mitglied war und sich heute »Reichsbürgerin« nennt – im Gespräch mit ihren Kindern, die Taxifahrer und Soldat der Bundeswehr sind; Kinder, die lange im Ausland lebten; Kinder, die den elterlichen Betrieb übernahmen; Kinder, die sehr erfolgreich alle Chancen für sich zu nutzen wussten; Kinder, die heute noch in Umschulungen stecken, und Kinder, die nicht mehr mit ihren Eltern reden können. Der Anspruch auf eine wie auch immer geartete »Vollständigkeit« wird nicht erhoben.
Insgesamt gestaltete es sich nicht einfach für uns, Familien zu finden, die miteinander ins Gespräch kommen wollten. Theoretisch wussten wir um die Hürden aus unseren eigenen Familien, doch wie schwer es tatsächlich fast allen fallen würde, sich zu erinnern und über diese Erinnerungen zu reden, ohne zu streiten, hat uns sehr berührt. Deshalb haben wir uns für eine Anonymisierung der Gesprächspartnerinnen und -partner in diesem Buch entschieden. Sie tragen hier andere Namen als im Leben. Wir haben überzeugt und ermutigt, waren aber auch immer wieder mit Absagen konfrontiert, manchmal erst kurz vor dem Gespräch. So dauerte es länger, als wir dachten, bis wir die zehn Gespräche geführt hatten. Sie fanden in allen Teilen Deutschlands statt. Was fast alle Familien miteinander verbindet, ist, dass diese Art von Dialog über ihre Vergangenheit zuvor noch nie stattgefunden hatte.
In der öffentlichen Nachwende-Auseinandersetzung erhielt der Osten lange Zeit ein einseitiges Image, das die negativen Folgen des Umbruchs in den Mittelpunkt stellte. Wendekinder erlebten, dass der gesellschaftliche Diskurs über ihre Eltern vor allem negativ belegt war und ist. Ostdeutsche galten und gelten oft immer noch als Jammerossis, schlimmstenfalls wurden sie als SED-Hörige oder Stasispitzel verunglimpft. Darüber zu reden schien lange die Scham über eigene Verfehlungen und die erlebten Ungerechtigkeiten zu vertiefen. Die Familien schweigen oft bis heute, doch in ihrem Schweigen wächst die Wut. Exemplarisch dafür untersuchte Sabine Michel für ihren Dokumentarfilm »Montags in Dresden« Biografien im Epizentrum der seit 2014 stattfindenden Pegida-Demonstrationen.
Obwohl wir beide Filmregisseurinnen sind, haben wir uns für diesen Gesprächsband entschieden, das Medium zu wechseln. In unseren Dokumentarfilmen verstehen wir uns als Interpretinnen einer Gegenwart, wie wir sie wahrnehmen. Auf dem Papier hingegen steht das gesprochene Wort im Zentrum der Aufmerksamkeit, verdichtet sich die Essenz der Botschaft noch einmal in anderer Form – das hat uns gereizt. Die Gespräche werden begleitet von möglichst genauen Beschreibungen der Familien und unseren Beobachtungen und Erinnerungen an ihre Zusammentreffen. Das Eigentliche, das Wesentliche durchscheinen zu lassen, die Eltern und Kinder in ihrem jeweils Besonderen zu erkennen, darum ging es uns. Der Stil eines klassischen Gesprächsbandes wird so aufgebrochen, Impulse unserer filmischen Arbeiten fließen ein und ergänzen den sachlichen Informationsgewinn.
Um in die Zukunft blicken zu können, müssen wir die Vergangenheit begreifen. Basierend auf unseren beruflichen und privaten Erfahrungen des generationenübergreifenden Dialogs und in der Tradition der Oral History, haben wir versucht, Familien in die direkte konfrontative Auseinandersetzung eintreten zu lassen. Wir hoffen, dass diese komplexen Gespräche den Blick auf die DDR-Bevölkerung, die bis heute häufig als homogene Masse wahrgenommen wird, weiten und ein tieferes Verstehen der gegenwärtigen gesamtdeutschen Pluralität ermöglichen werden. Das individuelle Selbst-Begreifen kann so als eine bis in die Gegenwart notwendige innerfamiliäre Herausforderung sichtbar werden, die private und gesellschaftliche Beziehungsmuster und -brüche widerspiegelt, die exemplarisch sind für die Suche nach einem gesamtdeutschen kollektiven Selbstverständnis. Die Gespräche geben Einblicke in Familien und damit in die »Seele« Ostdeutschlands. Sie erzählen von alten und neuen Sehnsüchten, Dazugewonnenem, Verlusten, aber auch von alten und neuen Ängsten und Enttäuschungen. Dafür haben wir überwiegend Eltern und Kinder mit komplizierteren Geschichten und eher schwierigerem Zugang zueinander ausgewählt. Natürlich gibt es viele ostdeutsche Familien, in denen die Generationen gut miteinander kommunizieren. Für dieses Buch erschien es uns wertvoll, darauf aufmerksam zu machen, welche Hürden und Probleme es zu bewältigen gilt und mit welchen Spätfolgen von insgesamt drei deutschen Staatsformen, Mauerfall, Transformation und Nachwendezeit wir es heute zu tun haben.
Die in diesem Buch wiedergegebenen Gespräche können als individuelle Möglichkeit und als Ermutigung verstanden werden, in den Familien neu und ohne Vorwürfe miteinander das Gespräch zu beginnen. Bestenfalls sind sie Handwerkszeug, um aktuelle politische Entwicklungen in Ostdeutschland »anders zu lesen«, zu verstehen und beeinflussen zu können.
Sabine Michel und Dörte Grimm
April 2020