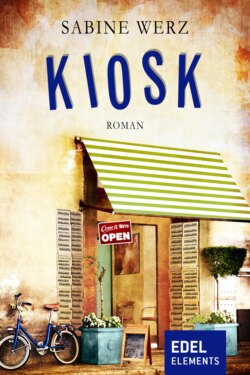Читать книгу Kiosk - Sabine Werz - Страница 6
1
ОглавлениеMit dem Kiosk ist demnächst Schluß, wenn es nach Krahwinkel und seinen Bauplänen geht. Jetzt, wo der Jakob tot ist, der sentimentale Hund, wird sich da wohl was machen lassen. So viel weiß der Krahwinkel, daß die Lena dem Geschäft nicht gewachsen ist.
Er weiß nichts von Karla, die in einem seiner Apartments neben dem Drogeriemarkt wohnt. Keiner am Kattenbug kennt die junge Frau, aber sie kennt den Kiosk und überlegt, ob sie nicht endlich einmal hinübergehen soll. Unschlüssig steht sie am Fenster, schaut durch die Schlitze einer Jalousie in die Frühjahrsdämmerung hinaus. Die Leuchtreklame über der Bude verströmt milchiges Licht. Sie erinnert sich an hellrote Erdbeeren aus Schaumzucker, die den Gaumen rauh schmirgeln, und an Zeitungspapier mit gelbem Tabakgeruch.
Unsinn, denkt sie, ich gehöre da nicht hin. Immer noch lauter Schwätzer da, verhungerte Seelen, die ihr Leben verpaßt haben oder verplempert für kleinlaute Illusionen. Das letzte, was sie braucht. Keiner belügt mich besser als ich selbst, verhöhnt sie sich stumm. Sie zieht die Jalousie hoch und macht das Fenster einen Spalt auf. Wagners Walküren nähern sich von ferne, drängeln durch den Fensterspalt. Von ferne? Vom Kiosk.
Der Antiquar. Unverbesserlich. Ach was. Hat sie im Stich gelassen, war nicht der einzige. Hat er bestimmt vergessen. Weiß sicher nicht mehr, daß es sie gibt. Würde sie nicht wiedererkennen. Hat sich einen Dreck gekümmert. Genau wie Jakob. Soll in Frieden ruhen. Schluß damit. Alle sollen sie in Ruhe lassen, erst recht diese verdammten Walküren.
Schnell schlägt sie das Fenster zu. Sie muß an die Luft, sie braucht ein Bier. Eins? Verfluchter Kattenbug, sie hätte nicht wieder herkommen sollen. Man kehrt nicht als derselbe zurück, wenn man lange unterwegs war. Verfluchter Jakob. Nur raus. Auch Erinnerungen sind Illusionen. Sie hat genug davon. Das hat sie mit dem Antiquar gemeinsam. Am Drogeriemarkt vorbei taucht sie ab in die nächste Gasse. Raus aus der Vergangenheit.
Zur Zeit vom Antiquar war der Laden, der jetzt Drogeriemarkt ist, angefüllt mit schiefen Regalwänden. Bis unter die Decke und in den letzten Winkel des Lagers hinein. Bücher, nichts als Bücher standen darin, die nach Staub und Schimmel gerochen haben, und der Antiquar hockte dazwischen wie der Hüter des verlorenen Schatzes, mit gelbweißer Mähne und mißvergnügtem Lächeln, immer schweigsam und verschlossen. Kein Mensch weiß, wie er davon hat leben können, nur der Antiquar, aber der findet, daß es darüber nichts zu erzählen gibt. Auch nicht darüber, warum er den Laden vor knapp einem Jahr, kurz nach Jakobs Tod, ratzfatz aufgelöst hat.
Was Buddy, der Kumpel vom Dachdecker, ihm sehr übelnimmt, denn er war gerne im Laden und hat die Bücher sortiert. Wie er meint. Er hat die aus dem Regal genommen, die auf dem Kopf standen, einmal gestreichelt, umgedreht und wieder hingestellt. Buddy liebt Bücher, weil die Wörter darin ihren geregelten Platz und eine Ordnung haben, anders als in seinem Kopf, da trudeln sie durcheinander und finden keinen Halt und zerfallen auf dem weiten Weg von da oben bis runter in seinen Mund zu wüsten Buchstabenfolgen, die er dann mühsam mit der Zunge zusammensucht, mehr nach ihrem Geschmack als nach der Grammatik.
Sein Hirn hat eben zu viele Windungen und Sackgassen, in denen die Wörter sich verirren und kaputtgehen. So erklärt er sich das. Die anderen halten ihn für einen Deppen. Schon weil er so ein eingedrücktes Gesicht hat, als hätte einer während der Geburt die Faust mittenrein gepreßt und alles dahin verschoben, wo es nicht hingehört. Was der Wahrheit recht nahe kommt. Aber er ist kein Depp, und der Antiquar hat das gewußt und ihm zugehört. Glaubt Buddy. Manchmal verkriecht er sich auf das Trümmergrundstück neben dem Kiosk und brabbelt gegen die Mauer. Irgendwann muß das doch was werden.
»Markor«, murmelt Buddy jetzt. Es ist fünf vor zehn und schon lange dunkel. Lenchen schiebt ihm ein Päckchen Marlboro hin und eine Dreiviertelliterflasche Korn, die Hausmarke zu zehnneunzig. Scheint zu stimmen. Buddy streckt die Pranken vor und versenkt beides in die Taschen seiner schmutzigen Zimmermannshose, Erbstück vom Dachdecker, ständig verliert der Buddy seine eigenen Sachen.
»Schrei au, Da-da.« Aufgeregte Pause, dann angelt er tief aus seinem Rachen noch ein kratziges »CH« wie in Lachen hervor und schließt zu seiner Verwunderung und Freude mit einem ganzen Wort. »Dach«.
Buddy führt das Wort noch dreimal vor wie einen Tiger, der durch einen brennenden Reifen springt. Lena nickt knapp.
Ihr geht die Geduld vom Jakob ab, der für Sonderlinge was übrig hatte. »Jaja, ich schreib’s beim Dachdecker an, aber nu mach hin, ich mach gleich dicht.« Sonderlinge waren so eine Art Sammelleidenschaft vom Jakob. Vielleicht liegt das am Geschäft. Nach fünfunddreißig Jahren Kiosk kennst du sie alle, die Halbseidenen und Halbgaren, die Besserwisser und Besserverdiener, die normalen Monster und die monströs Normalen, da bleibt am Ende eine Vorliebe fürs Verschrobene übrig. Jakob liebte nun mal Anekdoten.
Oben legt der Antiquar noch einmal den Walkürenritt auf, obwohl ihm die Scheiben gestern erst zerschmissen worden sind. Buddy wirft verklärte Blicke hoch, so schön ist das. Er weiß, daß zu der Musik so Geschichten von Drachen dazugehören und von Zwergen, und alles zusammen klingt fast wie Nebel und ist eine richtige Geschichte von ganz von früher, als es so was noch gab. Wofür es Worte gibt, das gibt es auch, ahnt Buddy dunkel. Der Antiquar hat ihm davon erzählt und Bilder gezeigt und Buchstaben, in denen sich die Drachen verstecken. Goldene Buchstaben und blaue Drachen mit Flügeln. »Das, Buddy, ist mein wertvollstes Stück«, hat der Antiquar ihm anvertraut, und es eines Tages einfach verkauft. Mit dem ganzen Laden, wo es doch hingehört hat. Buddy brummt unwillig und geht.
»Dem alten Querkopf da oben fehlt der Jakob«, sagt das Lenchen mit einem Blick zum Dachgiebel, während sie die Papierkörbe mit der Eisreklame von den Mauerhaken nimmt. Kwiatkowski nickt langsam und wuchtet knirschend den Zeitungsständer über die Türschwelle in den Kiosk. Er packt das rauhgewebte Rollband des Gitters, hakt es los und läßt es genußvoll durch seine Handflächen gleiten. Das Gitter seufzt in den Angeln.
Früher, wenn der Antiquar das Rasseln des Rollgitters gehört hat, ist er oft heruntergekommen. Abends um zehn.
Zwei-, dreimal die Woche, um Bier zu trinken. Im Hof hinter dem Kiosk, wo Knöterich die roten Ziegelwände herabwuchert und Jakob mit dem Dachdecker seine Küche gebaut hat. Eine ziemlich monströse Küche mit gemauerter Front und offenem Kamin in einem viel zu kleinen Anbau. Der Dachdecker hatte dabei mal wieder seine Phantasie nicht im Griff gehabt.
Früher haben Jakob und der Antiquar in der Küche Musik gemacht. Der Jakob mit einer Mundharmonika und der Antiquar mit einem Banjo. Folk war die Droge. So bis in die frühen Achtziger, als Lenchen noch Wallegewänder trug und barfuß gelaufen ist. Nach einer Weile ist es immer das gleiche Lied gewesen.
»Wie zwei Verliebte«, hat sich das Lenchen halb gewundert, halb gefreut. Die beiden sangen irgendwas Schottisches über junge Helden, die in den Krieg ziehen wollen gegen Frankreich und auf sommergrünen Wiesen auf Segelschiffe warten, die sie holen sollen, und dann sterben sie den frühen Tod auf dem Schlachtfeld, und der Refrain sind zerrissene Därme, zerfetzte Schultern und die Flasche als einziger Freund. Den beiden Musikanten gefiel das. Haben sich dabei wohl für echte Kerle gehalten, denkt Lenchen und irrt sich.
Sie hat sich in ihrem Leben öfter in Männern und deren Träumen geirrt und ist ihnen treu geblieben. Sie ist der Typ Siedlerfrau, die klaglos im Präriewagen gen Westen zieht und nebenher Kinder gebärt und Indianer massakriert. Ihr Erster, da war sie dreiundzwanzig, hat alte VW-Busse nach Nepal chauffiert, durchs wilde Kurdistan, durch Afghanistan, jedenfalls immer durch die Wallachei. Und Lenchen neben ihm. Freiheit nannte er das.
Die Busse hat er dann in Nepal verkauft, und davon konnten sie drei Monate »da unten leben« – wie Lenchen sagt – bei Dope, Reisgerichten und Tee mit ranziger Yakbutter. Hat ihr nicht besonders geschmeckt, drum nahm sie später immer Knäckebrot und Margarine mit. Botteram mochte sie am liebsten.
Mit Dope für den Kleinhandel daheim ging es dann irgendwann in einem Flieger zurück, der Dopeerlös finanzierte den nächsten Bus, und ab ging es wieder in die Freiheit, die die Nepalesen ein Heidengeld gekostet hat. VW-Busse waren ein Riesengeschäft, da unten damals. Einmal haben sie einen Bus nicht verkauft bekommen, da mußten sie retour, samt Bus. Statt Dope hat ihr Erster ein Schneetigerjunges aus dem Himalaja mitgenommen, das er einem zwielichtigen Jäger mit platter Nase und verkniffenen Augen abgehandelt hat. Lenas Erster behauptete, das Viech sei mindestens zehntausend Mark wert, weil die Schneetiger vom Aussterben bedroht sind. Das Tigerbaby ist der Lena kurz vor dem Hindukusch auf dem Schoß weggestorben an einem gräßlichen Durchfall. Es hat so erbärmlich gestunken, daß ihr Erster es kurzerhand aus dem Fenster geworfen hat. Seither hat Lenchen es nicht mehr mit dem Träumen, aber spendet einmal im Jahr hundert Mark für den Worldwildlife Fund, Verwendungszweck »Schneetiger«.
Anderen macht sie die Träume nicht kaputt. Schon gar nicht Männern. Auch dem Jakob nicht, dessen Abenteuer Gott sei Dank mehr im Kopf stattfanden und hinten im Hof und in der vollgestopften Küche und in schottischen Folksongs.
Irgendwann war das mit der Singerei dann vorbei. Jakob und der Antiquar haben nur noch Bier getrunken. Geredet hat immer der Jakob. War ein heilloser Lügner, würde der Antiquar sagen. Einer, der sein Leben lang nach Pointen rang, als hätte das Leben eine andere als den Tod. Aber das hat der Jakob nie einsehen wollen und Geschichten erlogen und immer die Wirklichkeit ausgebessert.
»Wat willste?« hat Jakob manchmal gefragt. »Siehste nicht, wie die Leute das freut?«
Lauter sinnlose Geschichten, findet der Antiquar, sinnlos wie das ganze Leben, wenn man sich nichts vormacht. Der Jakob freilich hat sich immer was vorgemacht und sich für eine lokale Größe gehalten, weil er einmal ein Lied über den Kattenbug gedichtet hat, das in der Rundschau abgedruckt und von einem kleinen Karnevalsverein zum Erkennungslied erkoren worden ist. Danach galt der Jakob als Kölns fröhlichster Kioskbesitzer, und manchmal schauten Journalisten vorbei, Volontäre mit Hang zur großen Sozialreportage, um über ihn und den sterbenden Kattenbug zu berichten. Dann hat der Jakob Sprüche geklopft, »da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen, Geschichten«, und hat nicht weiter gewußt. Besser er hätte den Mund gehalten, findet der Antiquar.
In diesem Jahr wollte Jakob sein Jubiläum feiern: Fünfunddreißig Jahre fröhlicher Kioskbesitzer vom Kattenbug. Ein Straßenfest hat er geplant, das immer größere Ausmaße annahm und die Gasse zu sprengen drohte, Jazzkapellen auf Pritschenwagen, ein Kinderkarussell, selbstgezimmerte Reibekuchenbuden vom Dachdecker, Lotteriespiele für einen guten Zweck, Trödelstände entstanden in seinem Kopf und ein Ansturm der Presse.
»Der Kattenbug, das ist überhaupt das Leben, da liegt die Welt drin«, hat er getönt, fröhlich übersehend, daß das ganze Land im Sommer zum Straßenfest wird und die Jazzkapellen einen bis auf die Rolltreppen neu eröffneter Einkaufszentren verfolgen. Lenchen hat ihn wie immer machen lassen, bis kurz vor Schluß.
Am Ende ist Jakob erstickt. Lungenkrebs. Den letzten Atemzug hat er nicht mal mehr ausgestoßen, die Luft ist woanders entwichen, wo Jakob sie nicht mehr brauchen konnte. Kwiatkowski, der Maulheld, hat aus seiner Zeit als Totengräber mal erzählt, daß die Leichen sogar im Sarg noch furzen. Kein Wunder, daß der Antiquar so was nicht wissen will.
Vier Wochen nach der Diagnose war Jakob schon tot. Ohne letzte Worte. Unpassendes Ende für einen geborenen Faselhans, würde der Antiquar sagen, wenn er davon erzählen würde. Aber er hat sich seither ganz aufs Schweigen verlegt.
»Der Jakob ist die Stimme, und du bist das Ohr«, hat Lenchen früher immer gemeint, und wenn sie ein wenig betrunken war, hat sie hinzugefügt: »Zusammen gebt ihr einen ganz anständigen Mann ab.«
Unsinn, würde der Antiquar sagen und wieder den Walkürenritt auflegen. Gerade wimmeln und wuseln die Streicher ein dramatisches Furioso zusammen, hektisch, so als müßten sie verstreute Noten vom Boden auflesen und dabei die Bläser einholen oder einen Bus.
Die können schon nerven, diese Walküren, denkt Kwiatkowski und holt die im Aprilwind knatternde Eisfahne ein. Überhaupt Wagner, viel zu aufgedonnert, kein Sinn für Stille. Gute Musik öffnet in uns verborgene Räume, bei Wagner ist es so, als schlüge er mit Wucht alle Türen zu. Findet Kwiatkowski.
Nikita wiederum, die sich von Pflasterstein zu Pflasterstein – nie auf den Strich treten und nur jeden zweiten Stein nehmen – auf den Kiosk zuarbeitet, in der Hoffnung, ihn zu erreichen, bevor Kwiatkowski das Rollgitter hinabfahren läßt, findet das Wüten der Wagnergeigen wunderschön. Da wird sich der Eckenflüsterer nicht aus seinem Versteck bei der verlassenen Metzgerei heraustrauen. Der steht da, seit Jakob tot ist, und murmelt Verwünschungen. Und vielleicht verstummt unter der Musik auch die schwindelhohe Ziegelmauer vom Trümmergrundstück neben dem Kiosk, die ein einziges Wispern und Flüstern ist, weil sich in ihrem Moos und ihren Ritzen nachts die Dämonen und Spottgeister versammeln.
Es ist nicht leicht, wenn man neun Jahre ist und die eigene Mutter vor den Dämonen beschützen muß, die überall lauern, weil sie so wunderschön ist, daß an ihr ständig das Häßliche Rache nimmt. Beim Tarotspiel zieht die Mutter immer den Tod, ein höhnisch grinsendes Gerippe.
Ratsch – das Rollgitter ist unten, und Nikita erschrickt, zwingt ihren Atem nieder. Jetzt muß sie ganz leise sein, um die Hölle nicht zu wecken. Mit doppelter Anstrengung starrt sie aufs Pflaster, nur keinen Strich berühren, den Fuß ganz vorsichtig auf den übernächsten Pflasterstein setzen und lautlos ausatmen. In der Badewanne übt sie unter Wasser regelmäßig das Luftanhalten und hat es schon auf eine Minute gebracht.
Früher hat der Jakob oft in der Kiosktür gestanden und gewartet, ob sie noch kommt. »Na, Spritzbilla, wo marschierte lang«, hat er gerufen, und der Antiquar stand daneben und hat so grimmig geguckt, daß die Mauer verstummte, und alles war gut. So wie den Antiquar stellt Nikita sich Gott vor, ein unversöhnter alter Zauberer, der das Böse in Schach hält, weil er noch viel böser sein kann und viel mächtiger, wenn er will und man ihn gnädig stimmt. Das Rollgitter trifft mit schnappendem Geräusch auf die Eisenschiene am Boden.
»Wird immer kauziger«, sagt Kwiatkowski im Kiosk zu Lenchen und meint den Antiquar. Lenchen hört nicht hin. Sie sitzt auf einem umgedrehten roten Bierkasten, zählt leise flüsternd das Geld und kraust die Stirn. »Das geht nicht mehr lang«, sagt sie.
»Ach was, so schlimm ist das doch nicht«, meint Kwiatkowski.
»Nicht schlimm? Es läuft beschissen.«
»Was meinen Sie?«
»Den Laden. Die Umsätze gehen immer weiter runter. 758 Mark an einem Sonntagabend mit Fußball-Länderspiel. Da trinkt man doch Bier, und ich habe zwölf Sorten kalt. Was haben wir früher an den kalten Getränken verdient.« Sie stellt den roten Kasseneinsatz mit dem Silbergeld auf die Eistruhe. Die Münzen klirren kurz und sacht.
»Glauben Sie, es liegt am Walkürenritt?«
Lenchen zuckt die Achseln. »Vielleicht am Drogeriemarkt. Die verkaufen Jacobi 1880 zu 7,98, und Bier und Sekt haben sie auch, hat der Dachdecker erzählt.« Der treulose Verräter der, denkt sie. Bei mir schreibt er an bis zum Letzten, und da nimmt er die Sonderangebote mit, und das nach allem, was der Jakob für ihn getan hat.
»Aber die haben kein Lenchen im Drogeriemarkt.« Kwiatkowski glaubt, daß so oder ähnlich Sätze klingen müssen, die ein Lenchen trösten. Lena steckt sich eine Zigarette an, zieht heftig und legt sie gleich wieder über die Kante vom Aschenbecher. Gewohnheitssache. Beim Bedienen hat sie nie die Hände zum Rauchen frei, da verqualmen ihre hektisch angezündeten Zigaretten nach wenigen Zügen im Aschenbecher, oft mehrere gleichzeitig, und überziehen die Negerküsse mit einem blaugrauen Schleier, der sie zäh macht und nach kaltem Rauch schmecken läßt.
Lenchen schaut Kwiatkowski fest an. »Die kommen nicht wegen mir, außer vielleicht der Dachdecker und sein Anhang, weil er anschreiben kann. Den anderen fehlt der Jakob.« Sie schweigt. Ihr fehlt er auch.
Kwiatkowski greift sich ein Bier aus dem Kühlschrank. »Auch eins? Die Laternen sind ja jetzt an.« Das ist so ein alter Scherz von Jakob. Lenchen trinkt frühestens nach Einbruch der Dunkelheit, meistens erst wenn der Laden zu ist. Erst ein Bier, dann eine Flasche Amselkeller, der mal Amselfelder hieß und aus Jugoslawien stammte. Ohne Stiele und Stengel gekeltert.
»Kann eins brauchen. Aber nehmen Sie eins von hinten, die sind kalt.« Sie trinkt und denkt nach. »Kwiatkowski, ich schaff das auf Dauer nicht alleine.«
»Ich bleib Ihnen noch eine Weile erhalten, so zweimal die Woche mach ich ’nen Tag.« Ihm wird mulmig, während er das sagt, zwar macht er das schon so, seit Jakob tot ist, aber wenn er was verspricht, wird’s offiziell. Sofort abhauen möchte er dann, auf Nimmerwiedersehen. Aus der Ferne sind ihm Freundschaften am liebsten. »Kwiatkowski, du bist ein Windhund«, hat der Beuys einmal zu ihm gesagt und einen Windhund auf eine Serviette gemalt. Die Serviette hat er noch immer.
Lenchen kann mit Kwiatkowskis Versprechen nicht viel anfangen. »Zweimal die Woche reicht nicht. Der Einkauf, fünf Tage Schicht, die Buchhaltung, die Remittenden, die Bestellungen – das ist zuviel. Außerdem gehört mir der Laden nicht mal. Jakob war ja immer noch mit seiner Ersten verheiratet, hatten auch das Kind.«
Kwiatkowski schüttelt langsam den Kopf. »Unsinn, die haben das Erbe ausgeschlagen, das Kabuff gehört Ihnen.«
Lenchen zieht die Stirn in Falten. »Und die Schulden.« Das »Kabuff« nimmt sie übel. Außerdem: Blut ist dicker als Wasser, denkt sie, sagt sie aber nicht, denn Kwiatkowski haßt solche Sätze, so viel weiß sie. Solche Sätze sind der Grund, weshalb er Lenchen immer noch siezt. »Jakob hat es anders gewollt«, schützt Lenchen vor.
»Er konnte doch nicht wissen, wie schnell das gehen würde. Mit«, er scheut das Wort Krebs, »mit der Krankheit, sonst hätte er den Laden und das Haus Ihnen vermacht. Bestimmt hat er nicht gewollt, daß Sie sich Sorgen machen. Er hatte ja noch so viele Pläne.«
Ja, Pläne hatte er noch gehabt, der Jakob, aber damit kann ein Lenchen nichts anfangen, und Schulden machen ihr Angst, und Angst macht sie kleinmütig und gegen ihre Natur geizig. Ihr kann nur noch ein Wunder helfen, aber an Wunder glaubt sie so wenig wie an Träume. Kwiatkowski weiß das, höchste Zeit, daß er abhaut.
»Egal, was Jakob wollte, ich schaff’s nicht, den Laden hochzuhalten.« Aber bis zum Hindukusch mit einem Tiger auf dem Schoß, das schaffst du, denkt Kwiatkowski, sagt aber nur: »Dann nehmen Sie einen Teilhaber mit rein. Irgendwas Junges, ein anderes Gesicht, lockt vielleicht andere Kunden an. Die aus der Leichenhalle, die haben Geld.«
»Jemand Fremdes im Laden? Das hat der Jakob nie gewollt. Da hätte er lieber alles an den Krahwinkel verkauft.«
»Da sei Gott vor«, sagt Kwiatkowski mit gespieltem Entsetzen. An den Krahwinkel wird auch Lenchen nicht verkaufen. Schulden hin, Schulden her.
»Aber einen Teilhaber wollte er nicht. Nee, war immer ein Familiengeschäft. So mit der offenen Kasse, da kann man einem Fremden nicht trauen.«
Du traust keinem mehr, denkt Kwiatkowski nüchtern und erinnert sich an die Szene vor zwei Tagen, als Lenchen wegen einem halben gefrorenen Toastbrot, das er Buddy geschenkt hat, eine Szene gemacht hat und nicht glauben wollte, daß er – der Kwiatkowski – so was aus seiner eigenen Tasche bezahlt. Er klaut doch keine halben Brote und spielt damit den Wohltäter. Geld ist nicht wichtig.
Seit Jakob tot ist, glaubt Lenchen schutzlos der Gier und Verschlagenheit der Menschen ausgesetzt zu sein. Ganz verbiestert hält sie an dem Glauben fest, daß sie ohne Mann aufgeschmissen ist, ohne einen, der ihr sagt, wo es lang geht. Ob in Nepal oder im Geschäft. Noch ein Grund dafür, daß Kwiatkowski sie siezt. Je näher man sich auf dem Kattenbug kommt, desto mehr hat man sich hinterher vorzuwerfen. Am Ende ein ganzes Leben. Er ist schon viel zu lange hier. Nur wegen Jakob, der die Welt für sich auf diesem kleinen Stück Straße zusammengepreßt hat. Das hat ihn fasziniert wie die Leichen, die er mal gewaschen hat.
»Die wahren Mysterien finden heutzutage auf dem Hauptbahnhof statt«, hat der Beuys gesagt. Kwiatkowski will den Seelen auf den Grund gehen, aber sich nicht in deren alltäglichen Kleinmut verstricken. Hier muß jedenfalls bald Feierabend sein, zumal er das Stipendium für Florenz in der Tasche hat.
»Versuchen Sie es erst mal mit einer richtigen Aushilfe, halbtags«, sagt Kwiatkowski entschlossen. »Ich mach mal ein Schild an die Tür.«
Lenchen nimmt noch einen Schluck aus der Flasche, dann steht sie auf. »Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber es müßte jemand sein, dem Jakob vertraut hätte.«
»Wie wäre es dann mit dem Dachdecker?« fragt Kwiatkowski.
»Machen Sie keine blöden Witze. Das mit dem Dachdecker war nur so ’ne Schwäche von Jakob. Der hatte nun mal ein Herz für Sonderlinge.« Wie für dich, fügt Lenchen heimlich an.
Sie verschwindet hinter der Wolldecke, die die Zugluft aus dem Bierraum abhalten soll, dann klappt die Eisentür zum Hof. Lenchen verzieht sich in die Küche, um alleine ihren Amselkeller zu trinken und vor dem zu großen Kamin mit dem toten Jakob zu sprechen, darüber, wie wütend sie sein Verschwinden macht und daß sie morgens immer noch sein Kissen umarmt, ganz fest, bis ihr die Luft wegbleibt und sie aufstehen muß, um den Laden, den sein Vater gegründet hat, in Schwung zu halten.
Sie bleibt kurz im Hof stehen und betrachtet den grünenden Knöterich. Das Leben geht eben weiter, die Lücken schließen sich lautlos, kann sterben, wer will. Irgendwie ist sie froh, daß Kwiatkowski die Führung übernommen hat. So kennt sie es, und so will sie es, auch wenn der Kwiatkowski erst knapp über vierzig ist und überhaupt nicht ihr Typ, ein Mann ist er doch. Wenn sie nur wüßte, wovon der so träumt. Totenköpfe? Ekelhaft. Aber daß er überhaupt nicht träumt? Gibt’s nicht. Männer haben immer Träume, unsinnige Träume, die Frauen ein wenig zurechtstutzen müssen, aber behutsam. So sieht Lenchen die Liebe und hat viel geliebt in ihrem Leben und hat die Männer so behutsam zurechtgestutzt, daß die überhaupt nichts davon gemerkt haben.
Sie klinkt die Tür zur Küche auf und macht Licht. »Ich muß endlich mal staubwischen«, sagt sie laut zu den Möbeln.
Kwiatkowski steht noch im Kiosk, bereut mehr und mehr, worauf er sich mit dem Gespräch eingelassen hat, und malt mit schöner Künstlerschrift ein Schild. »Zuverlässige Aushilfe mit Kioskerfahrung gesucht.« Gut möglich, daß das sein Abschiedsgruß wird. Er atmet befreit auf.
Oben verklingen die Walküren.
Noch einmal läßt Kwiatkowski das Gitter hoch, zieht Tesastreifen vom Roller und will eben das Schild am Glas befestigen, als sein Blick durch die Scheibe nach unten gelenkt wird.
Besser der als keiner, denkt Nikita, obwohl sie dem Kwiatkowski nicht traut, wegen der Totenköpfe, die im Fenster seiner Wohnung schräg gegenüber ausgestellt sind und mit leeren Augenhöhlen in die Gasse starren. So was muß doch die Teufel anlocken und den Schlimmsten von allen, den Eckenflüsterer.
Kwiatkowski öffnet die Tür und fragt: »Wie üblich?«
»Vier Reiss, einen Gorbatschow kalt, eine West Big«, trägt Nikita mechanisch vor. Kwiatkowski greift sich eine Plastiktüte, schlägt sie mit lautem Knall in der Luft auf, öffnet den Kühlschrank und füllt Reissdorfkölsch und eine 0,7-Flasche Wodka hinein, dann greift er ins Zigarettenregal und legt ein Päckchen 25er dazu. Nikita steht mit dem unergründlichen Ernst eines mißtrauischen Kindes auf ihren dünnen Beinen und streckt die Hände nach der Tüte erst aus, als Kwiatkowski sie ihr reicht. »Magste nen Lutscher?« Kopfschütteln, so was steht nicht auf dem Programm, dafür die abschließende Formel: »Mutti zahlt morgen.«
»Klar, kein Thema.«
Geld gibt die Mutter ihr nie mit. Sie hat Angst, daß man Nikita wegen des Geldes überfallen könnte. Logik ist nicht die Stärke von Nikitas Mutter. Sie gehört zur Gattung der überspannten Schwarmgeister. Deshalb heißt Nikita auch Nikita, nach dem Song von Elton John, bei dem sie den Vater des Mädchens kennengelernt hat. Sie hat die Schnulze sogar auf dessen Beerdigung spielen lassen, da war sie im siebten Monat schwanger und schon nicht mehr ganz bei Trost. Mit »Gott ist mein Zeuge« hat sie am Grab von Pjotr der russischen Drogenmafia Rache geschworen, dabei hatte die mit Pjotrs Tod gar nichts zu tun, aber noch Geld von ihm zu bekommen. Nikitas Mutter hat danach eine Weile Polizeischutz gehabt und fühlte sich wie die Hauptperson eines großen Schicksals, das ihr die Tarotkarten ankündigen. Auf ihre Art ist sie eine hübsche Frau, die ihre Lippen zu laut schminkt, die Haare zu blond und die Fingernägel zu lang trägt. Zur Schönheit fehlt ihr die Klasse oder die Unschuld. Ordinäres Weibsstück, meinen die einen, dumm wie Brot, die anderen. »Ein bißchen naturtrüb is sie schon«, hat der Jakob gesagt, »aber immerhin nicht so dumm, sich für klug zu halten. Das sind die Schlimmsten.« Das Mädchen, das sie dann zur Welt gebracht hat, konnte sich nicht retten vor ihrer verwirrenden Gefühlsvielfalt, ihren Küssen, den pinkfarbenen Söckchen, den Barbiepuppen, den Teddybär-Schnullern, den Disneyvideos und den Nervenzusammenbrüchen.
Nikita hat es, seit sie denken kann – und das hat sie früh gelernt –, nie leicht mit ihrer Mutter und deren Hang zum Überschwang gehabt. Die Mutter ist eine vertraute Fremde. Nikita ist die Welt der Zahlen lieber. Drei mal drei macht neun. Mathematik. Im Rechnen hat sie eine Eins. Sie hätte auch lieber einen Zirkel als noch eine Barbiepuppe, aber davon versteht Mutti nichts.
»Hat wohl wieder Besuch, deine Mama?«
Nikita guckt ihn unter einer schwarzen Haarsträhne lauernd an, dann dreht sie sich um und geht. Sie hat Schlagseite da, wo sie die Tüte trägt. Das Klimpern der Flaschen fängt sich im Straßenschacht und hallt lange nach.
»Ich schau dir hinterher, bis du durch die Haustür bist«, ruft Kwiatkowski. Über ihm nehmen die Walküren ihren Ritt noch einmal auf.
»Das ist aber sehr nett von Ihnen«, sagt leise eine Stimme in seinem Rücken. Der Tonfall ist kalt und rachsüchtig. »Erst einem kleinen Mädchen Bier und Schnaps verkaufen und es dann alleine in die Nacht schicken. Echt großzügig, Sie Arschloch.«
Mehr erstaunt als beleidigt dreht Kwiatkowski sich um. Sein Erstaunen wächst. Vor ihm steht eine Frau, von Mitte oder Ende Dreißig. Sie sieht aus wie ein betrunkener Engel. Ihr Gesicht hat etwas Altmodisches und ist sehr blaß. Ein Lukas Cranach hätte sie zum Modell gewählt. Ihr Blick ist lauernd und weltentrückt zugleich, vielleicht weil sie betrunken ist.
Im Arm hält sie einen Hundewelpen mit Knickohren, ihr blondes Haar – Engel sind immer blond – hängt dem Welpen wie ein zerfranster Vorhang vor der Nase. Der Hund schnappt danach und verwickelt sich mit seiner keck vorstehenden Schnauze darin. Die Frau ist Karla.
Kwiatkowski wird das erst viel später erfahren, jetzt hält er sie für eine Erscheinung. Da fragt man nicht nach Namen. Sie erinnert ihn an jemanden. Das geht ihm seit seiner Zeit als Totengräber und Leichenwäscher öfter so. Irgendwo, glaubt er, jedes fremde Gesicht schon einmal gesehen zu haben, vielleicht weil er Sehnsucht nach dem Metaphysischen im Leben hat.
Der Engel hält es nicht mit der Metaphysik. »Ist die Stelle noch frei?«
»Was?«
»Die Stelle«, kommt es ungeduldig und mit tastender, beschwipster Stimme von Karla. Sie löst eine Hand unter dem Welpenbauch und deutet auf das Schild, das an einem Fetzchen Tesafilm von Kwiatkowskis rechter Hand baumelt.
Was will so eine in so einem Kiosk, fragt sich Kwiatkowski, als er schon den Mund öffnet und »Ja« sagt. Karla hört gar nicht hin, sie ist ganz bei der Musik, die wieder über die Gasse hinwegbraust wie ein Schwarm Helikopter.
»Die Walküren«, sagt sie, »schöne Aufnahme. Die Wiener Philharmoniker?« Sie redet jetzt, als müßte sie etwas unter Beweis stellen, das geht ihr flüssig von der Zunge, aber sie redet zusammenhangloses Zeug. »Am schönsten sind die Wagneraufhahmen von Glenn Gould. Kurz vor seinem Tod hat er das Siegfried-Idyll auf dem Klavier eingespielt. Haben Sie das schon mal gehört?« Sie schweigt kurz, ihre Stimme flattert, als sie sagt: »Das ist die traurigste Musik, die ich kenne. So herz ...« Sie bricht ab, für ein Wort wie herzzerreißend ist sie nicht mehr nüchtern genug, und wenn sie nüchtern wäre, nähme sie es nicht in den Mund. Sie schafft nur ein »hinreißend«.
Kwiatkowski nickt, obwohl er gar nichts darüber weiß und nicht mal mitbekommt, was sie sagt. In seinem Kopf läuft wie eine Endlosschleife immer nur die Frage: »Was will so eine im Kiosk?« Er formuliert es laut ein bißchen verbindlicher. »Warum wollen Sie so einen Job annehmen? Ich meine, so wie Sie...« Er macht eine Pause, das Wort aussehen ist zu schwach.
Karla sieht nicht einfach gut aus, vielleicht sieht sie nicht einmal gut aus, das weiß er im Moment nicht, will sich auch gar nicht entscheiden. Erscheinungen beurteilt er nicht nach ihrem Aussehen, dazu hatte er davon bislang zu wenig. Schädel kennt er genauer. Ihrer ist sehr fein, vor allem der Jochbogen und die Schläfenbeine.
»Ich meine, was wollen Sie hier, so wie Sie sind«, schließt er endlich. Er würde gerne die blonde Strähne aus dem Hundemaul befreien. Die gehört da nicht hin.
Karla kichert angeschickert in den Welpenpelz. »So wie ich bin? Wie sind Sie denn? Hört Wagner und stellt kreuzblöde Fragen.« Sie holt tief Luft und ist wieder die andere, die sich atemlos um etwas bewerben muß. »Glauben Sie, daß man seinem Schicksal entkommen kann? Daß man irgend etwas in seinem Leben selbst bestimmt?« Sie schaut ihn eindringlich an.
»Alles«, sagt er knapp.
»Sie irren sich, Sie irren sich gewaltig.«
Kwiatkowski ist ratlos. Karla wird trotzig. »Ich weiß, wie betrunken ich bin, aber ich will den Job auf jeden Fall, wegen der Walküren. Das ist nämlich ein Zeichen. Hab ich drauf gewartet.« Sie macht eine Pause, schluchzt plötzlich auf, was ein ganz jämmerliches Geräusch und ihr peinlich ist. »Zu lange.« Sie dreht sich plötzlich um und läuft stolpernd in Richtung von Krahwinkels City-Apartments.
Wohnt also in der Leichenhalle, registriert Kwiatkowki enttäuscht. Nüchtern wird sie unerträglich sein, denkt er, und Betrunkene mag er auch nicht. Es spricht also nicht viel für sie. Höchstens die Walküren. Daß er die eben noch verflucht hat, ist ihm entfallen.
Womit der Antiquar unfreiwillig in eine Geschichte hineingeraten ist, die er nie erzählen würde. Ausgerechnet der Walküren wegen. »Da kannste mal sehen«, würde Jakob frohlocken, »das Leben hat eben doch seine Pointen«, und würde sich ins Fäustchen lachen. Erst recht, wenn er noch hören könnte, daß direkt nach den Walküren die ersten Töne vom Liebestod in die Gasse hinabtaumeln wie die Birkenpollen aus dem Fenster vom Dachdecker. Der Antiquar ist über den Walküren eingeschlafen, und die Platte läuft erbarmungslos weiter, obwohl er Tristan und Isolde noch viel weniger mag als den Walkürenritt. Und darin würde Kwiatkowski ihm recht geben.
So wie er jetzt dasteht, umwogt vom an- und abschwellenden Überschwang der Oboen und den wehmütigen Geigen kommt er sich ziemlich lächerlich vor. Er verzieht sich hinter sein Rollgitter.
Nikita hingegen verharrt wie angewurzelt vor dem Gründerzeithaus, in dem sie gar nicht wohnt, sondern zwei Nummern weiter in den Festungshäusern. Es gehört zu ihrem Schutzritual, hier vorm Fenster der Rosenkreuzer neun Kreuze zu schlagen. Sie läßt die Hand beim achten sinken, als der Liebestod anhebt. So süße Musik hat sie noch nie gehört. Als habe die blonde Frau sie aus ihrem Mantel geschüttelt. Zu der paßt die Musik.
Nikita schaut dankbar in das Fenster der Rosenkreuzer. Das blasse Plakat vom Gott und dem Licht ist weg. Statt dessen hängt dort ein Gemälde von einem Regenbogen, der sich grellbunt über ein Meer von Menschen wölbt, die sich die Haare raufen und entsetzlich schreien und jammern. Das sieht ganz schrecklich aus, findet Nikita. Darunter steht: Fürchtet euch nicht und erinnert sie an das, was Marion Kratz, die Enkelin von der alten Quittländer, über den Schutzpatron der nahgelegenen Kirche erzählt hat. Sankt Pantaleon heißt der, und dem haben Heiden die Arme auf den Kopf genagelt, weil er an Gott geglaubt hat, und darum ist er heilig geworden.
Die Musik dahinten ist besser, tut aber ein bißchen weh. Ein letztes Kreuz wird geschlagen, dann darf sie rauf zu Mutti und ihrem Besuch. Es ist ausnahmsweise keiner von den klapperdürren Kerlen, die ihr immer über die schwarzen Haare streicheln und gerührt »Pjotr« murmeln, wenn sie nicht gerade ganz hektisch sind und fürchterlich zittern und dringend ins Bad müssen, um sich Spritzen dagegen zu geben, oder reglos an die Decke starren. Wenn sie an die Decke starren, sind sie Nikita am liebsten, dann könnten sie tot sein und Pjotr wegen des Eckenflüsterers Bescheid sagen.
Schließlich ist Pjotr ihr Vater und würde was tun, wenn er Bescheid wüßte. Vielleicht ist er sogar ein Heiliger, denn er hat viel Kummer gehabt, bevor er starb, hat ihre Mutter gesagt. Der jetzt im Bett bei ihr Hegt, riecht schlecht und hat Muskeln. Spritzen braucht er nicht, nur Tabletten in Silberpapier. Manchmal muß er nachts weg, danach bringt er Pizzakartons mit, die machen Fettflecken auf der Bettwäsche.
Nikita wünscht sich was, während sie die Haustür aufschließt. Sie will die blonde Frau wiedersehen. Ganz bald. Wird wohl ein paar Gebete kosten, egal, die kann sie auch unter der Bettdecke beten. Der liebe Gott sieht alles.