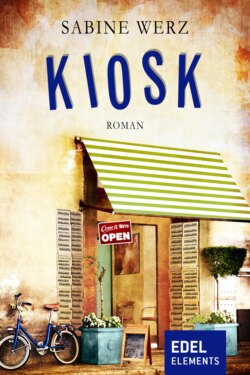Читать книгу Kiosk - Sabine Werz - Страница 8
3
ОглавлениеKarla ist heute morgen spät aufgewacht und ziemlich verkatert.
Neben dem Bett steht der Hund und junkst. Karla mag entschieden keine Hunde und wundert sich, wie dieser hier herkommt. »Also, wie kommst du hierher?« fragt sie den Welpen streng. Der hopst aufs Bett, hechelt und wedelt und freut sich über die Anrede. Sie schubst ihn weg und fällt in die schlafwarmen Kissen zurück.
Hinter geschlossenen Lidern dämmert ihr langsam, was gestern so passiert ist, nachdem sie die Wohnung verlassen und sich in die Dämmerung gestürzt hat.
Angefangen hat es »Beim Fährmann«, wo sie ihren Untergang begießen wollte. Der »Fährmann« ist dafür genau die richtige Kaschemme. Lauter menschliches Treibgut an der Theke. Sprachlos. Der Wirt war mal Matrose, weshalb eine rotweiß angemalte Sparbüchse in Form eines Rettungsbootes auf dem Tresen steht. Für die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. An den Wänden hängen Netze, zwischen deren Maschen und Plastikkrebsen sich öliger Schmier fängt. Auf der Verzehrkarte in moosgrünem Plastik stehen Heringstopf, Nordseemuscheln und ein Schnaps, der Windstärke zwölf heißt. Es riecht nach vergorenem Bier, altem Fett und schlecht geputzt, so süßlich muffig wie der Wirt. Der ist kein Menschenfreund, und die Kneipe macht ihn nicht besser.
Dafür ist das Kölsch billig. Einsachtzig, das gibt’s in der ganzen Ecke nicht noch mal. Einsachtzig, eine Weile hat Karla über nichts anderes nachgedacht und ausgerechnet, wieviel Kölsch sie hier noch für ihr Erspartes trinken könnte. Dabei kam eine stattliche Anzahl von ungefähr dreitausend Stück raus. Dreitausend minus fünf, die sie schon getrunken hat. In Kölsch gerechnet steht sie also nicht schlecht da, so ohne Job und Zukunft. Nimmt sie hingegen ihre Miete als Vergleichsgröße, sieht es düster aus. Tausendfünfhundert kostet der marmorgeflieste Apartmentwürfel, in den sie vor einem halben Jahr eingezogen ist. Mit Job und einem sehr unscharfen Vorhaben. Das war purer Leichtsinn.
»Wie konntest du nur«, nörgelt eine Stimme in einer Ecke ihres Gehirns. Die Stimme ihrer toten Mutter, die einen Speicherplatz von ungefähr zehn Millionen Gehirnzellen in ihrem Kopf beansprucht und bereits hellwach ist. »Wie konntest du nur?«
Der Hund leckt ausgiebig ihr Gesicht, sie schiebt ihn wieder beiseite und steht auf, um der Stimme zu entkommen. »Geh weg«, herrscht sie den Hund an und schubst ihn mit dem Fuß über den Marmorboden. Seine Krallen machen dabei ein kratzendes Geräusch.
In der Küche sucht sie nach Kaffee, keiner da. Also 2995 Kölsch minus weiterer drei im »Fährmann«, soviel kostet der Kaffee bestimmt. Der Gedanke an Bier dreht ihr den Magen um. Sie geht ins Badezimmer, sperrt die Tür vor dem Hund zu und stellt sich unter die Dusche. Sie zieht den Hebel vor. Mit dem warmen, harten Strahl prasseln weitere Erinnerungen auf sie herab. Ja, wie konnte sie nur, antwortet sie der Stimme aus dem Bett. Natürlich hätte sie wissen können, daß eine halbe Forschungsstelle beim Stadtarchiv nicht von Dauer ist. Wer interessiert sich schon brennend für den Kölnischen Fernhandel im ausgehenden fünfzehnten Jahrhundert? Die Stelle ist gestrichen. Seit gestern ist sie arbeitslos.
Kein ganz neuer Vorgang für Karla, sie kennt das von ihrer Zeit als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni, den Assistenzjahren am Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte und von dem Job an der bibliographischen Forschungsstelle. Es gibt so gut wie niemanden, der sich brennend für eine promovierte Historikerin mit dem Schwerpunkt mittelalterliche Wirtschaftspolitik interessiert. Mit ihrem Zweitfach Archäologie ist erst recht nichts zu holen.
»Hättest eben doch Medizin studieren sollen.« Mutters Stimme hat sich unter die Dusche gemogelt.
»Ich kann keine Menschen aufschneiden.«
»Aber alte Steine ausbuddeln, die niemand haben will. Und Mumien würdest du doch wohl auch aufschneiden.« »Stimmt, mit Begeisterung.« Allerdings sind römische Mosaike ihr Spezialgebiet, alte Steine eben.
Karla läßt Wasser in ihren Mund laufen, es steigt in der Mundhöhle an wie in einem Auffangbecken, sprudelt über, rinnt ihr zu den Seiten wieder heraus.
»Vom Unglück ziehe ab die Schuld, was übrigbleibt, trag mit Geduld.« Mutter.
Schuld?
»Ich war immer die Beste, Mutter, in der Schule, im Studium, wie du es gewollt hast.«
»Du warst eben nicht gut genug.« Die Stimme der Mutter mischt sich mit der eigenen.
»Der Arbeit fehlt es insgesamt an Eigenständigkeit, dennoch eine erschöpfende Bestandsaufnahme«, hieß es schon in der Beurteilung ihrer Examensarbeit. Nach großer wissenschaftlicher Begabung klingt das nicht.
Karla stellt die Dusche ab und friert. Sie wickelt sich in ein Frotteetuch und setzt sich auf den Toilettendeckel. Ihre Begabung reicht für weniger als dreitausend Kölsch. Und dafür hat sie eine Menge andere Dinge im Leben vernachlässigt. Männer zum Beispiel. Nicht, daß sie keine gehabt hätte, aber Männer waren für sie eher ein Abenteuer, keine Notwendigkeit. Was ihr fehlt, ist das Talent, einen Gefährten zu finden, der sie vor den eigenen Abgründen bewahrt oder wenigstens darum weiß, weil er selber welche hat.
»Man muß eben Kompromisse schließen, sich anpassen«, sagt die Stimme ihrer Mutter.
»Das mußt gerade du sagen«, antwortet Karla.
An diesem Punkt hat sie sich gestern das fettige Skatspiel gegriffen, das einer auf der Theke hat liegen lassen, und die Bildkarten aussortiert. Hat sie schon als Kind gerne gemacht. Die Könige und Buben und Damen fein säuberlich voneinander getrennt, um neue Paare zu bilden. Es hat ihr nie gepaßt, daß der pompöse Herzkönig mit der feingesichtigen Herzdame zusammen sein soll, dann schon lieber die schafsgesichtige Pikdame für ihn. Der Karobube schlägt mit seinem schmalen Edelmanngesicht den altväterlichen Wollbart ohnehin um Längen. Also die liebliche Herzdame zum Karobuben oder vielleicht doch die Karodame, die so schlicht und würdig ist in ihrem blauroten Mieder? Aber welche Dramen beschwört sie herauf, indem sie eine Königin einem Buben anvermählt? Nicht einmal bei einem albernen Kartenspiel kann sie sich für die richtige Zusammenstellung entscheiden.
»Männer und Frauen passen nicht zusammen, mein Kind«, tröstet scheinheilig her mothers voice. »Mach es wie ich, schau, daß du alleine klarkommst.«
Kommt sie aber nicht. Insgesamt fehlt es mir eben an Eigenständigkeit, verhöhnt Karla sich stumm. Der Hund kratzt an der Badezimmertür, wirft sich dagegen. Diese Nervensäge hat sie bei einem anderen Spiel gewonnen. Karla steht auf und läßt den Welpen herein, er schliddert mit auseinanderdriftenden Beinen zur Duschtasse und trinkt daraus. »Was mir jetzt noch fehlt, ist ein Satz Flöhe.« Während sie gestern Karten sortiert hat, ist im »Fährmann« die Tür aufgegangen. Sie schaut in Gedanken noch mal hin. Zwei junge Männer kommen herein, schlaksig in viel zu langen Lederjacken mit ausgebeulten Taschen und Combat-Hosen. Dem einen hängen Rastalocken ins Gesicht, der andere trägt gegeltes Raspelhaar und eine runde Sonnenbrille mit gelben Gläsern. Mit der selbstgewissen Arroganz junger Studenten, kaum älter als fünfundzwanzig sind sie, begutachten sie die staubigen Netze, das Stundenglas aus angelaufenem Messing, die Rettungsbootsparbüchse und nicken sich in einem besoffenen Reggae-rhythmus zu. Mit wiegenden Schritten kommen sie an die Theke, stützen sich mit den Ellbogen ab und ziehen sich auf zwei Hocker wie Mickey-Rourke-Doubles.
»Ja?« wirft der Wirt ihnen gleichzeitig mit seinem schmutzigen Wischtuch entgegen.
»Kölsch.«
»Kölsch.«
Die getrennte Bestellung entlarvt sie endgültig als Studenten. Fehlt nur noch, daß sie unter dem Tresen ihr Geld nachzählen. Aber das tun sie nicht, statt dessen öffnet der mit den Rastalocken seine Lederjacke, und ein Hund, der Hund, guckt vor. Karla legt die Karten weg und entschließt sich zu einem anderen Spiel. Vielleicht weil sie schon angetrunken ist, vielleicht weil sie am Ende ist, vielleicht, weil ihr zu allem Überfluß durch den Kopf schießt, daß sie schon achtunddreißig ist, ohne Job und ohne Mann und ohne Sex und nicht tot. Sie streckt die Hand nach rechts aus, wo Rastalocke sitzt, schiebt sie unter seinem Arm durch und krault den Hund unterm Kinn, der strampelt sich aus der Lederjacke frei, springt auf die Theke und läuft zu ihr hin.
»Tiere sind hier nicht erlaubt, wegen der Hygiene«, mufft der Wirt. Sie trinken ihr Bier aus und gehen. Vor der Tür erklären die Mickey-Rourke-Kopien, was sie in Kneipen wie dem »Fährmann« treiben. Sie spielen »ohne Tabu«, Biertrinken in Kneipen, die über die Schmerzgrenze gehen. Leben als ob man voll fertig wär. Rund um den Kattenbug sind sie schnell fündig geworden. Karla entscheidet sich mitzuspielen, die beiden haben nichts dagegen, vor allem der Raspelhaarige nicht.
Nach der dritten Bierschwemme legt er auf der Zülpicherstraße den Arm um Karla, während sie Bierbecher zertreten und durch Pommesschachteln und fettiges Falaffelpapier waten. Karla haßt den billigen Studentenmüll, aber immerhin halten die anderen Passanten, alle unter dreißig, erwartungslos, angewidert und unbekümmert, sie auch wieder für eine Studentin. Als Studentin war sie halbwegs im Lot, sozial einzuordnen, gut benotet, planlos anerkannt. Damals war ihr Lebensgefühl von tausend Möglichkeiten beflügelt und nicht von einer beschissenen Wirklichkeit gegängelt.
Sie gehen in Kneipen, in denen die Menschen ihnen immer ähnlicher werden, und langweilen sich lustig bei zu laut aufgedrehten Schlagerplatten, die Karla als Teenager peinlich fand.
»Schön ist es auf der Welt zu sein,
sagt die Biene zu dem Stachelschwein«.
»Gehn wir zu uns«, stellt der Raspelhaarige mehr fest, als daß er es vorschlägt. Karla kommt mit, weil sie den Hund auf dem Arm und die Hand des Raspelhaarigen auf der Schulter trägt. Es geht zum Kattenbug, wo die beiden in einem der Häuser mit rissigem Putz und ausgeleierter Haustür wohnen, fünf Treppen hoch, unterm Dach. Das Holzgeländer wackelt, und die Stufen klingen hohl. Vor der Wohnungstür schauen die beiden Jungs sich kurz an, als hätten sie was miteinander abzumachen. Der mit den Rastahaaren sagt »Also dann« und nimmt Karla den Hund ab. Durch einen rotgestrichenen Flur, in dem ein Gewirr aus Skianoraks, Mänteln, Wolljacken und der Geruch einer Frau hängen, gehen Karla und der Raspelkopf zu seinem Zimmer.
Sie hören Rammstein, und er zieht ihr den Mantel aus, den Pullover streift sie sich selber über den Kopf, sie hat es eilig. Er kniet hinter ihr, legt die Hände um ihre nackten Brüste, drückt ein paarmal zu, er hat es auch eilig und gehört zu den Gierigen. Das ist das Vorspiel. Dann liegen sie ineinander verschlungen auf einem Futon, mit nassen Gesichtern und schnappen nach Küssen und Luft. Ihr Atem ist herb vom vielen Bier, morgen wird er süßlich sein und schal. Soll sie bis zum Morgen dableiben? Ob sie sich zur Abwechslung in dieses brutal sorglose Jungengesicht verlieben könnte? denkt Karla kurz, als er über ihr liegt, da flammt das Licht auf.
»Annette ist unten«, schreit der Rastalockige mit falscher Lässigkeit ins Zimmer.
»Scheiße.« Der andere rollt sich vom Futon, als suche er auf freiem Feld Deckung vor feindlichem Beschuß. Karla liegt nackt da und schämt sich für ihn.
»Hast Glück, daß die Quittländer die Tür hinter uns abgesperrt hat. Annette kommt nicht rein.«
»Wo ist der Schlüssel? Ich schmeiß ihn runter.«
»Quatsch, bring ihn ihr runter, dann merkt sie nix, hab keine Lust auf Beziehungspunk.« Er betrachtet mit distanziertem Wohlgefallen Karlas Brüste, sie angelt nach ihrem Mantel, der andere ist schon in den Hosen und aus der Tür. Der Rastalockige sammelt Karlas Kleider auf und kickt die seines Freundes mit dem Fuß unter einer Stehlampe zu einem Haufen zusammen. »Komm mit in die Küche.«
Karla geht ihm nach, die Hände in den Manteltaschen, in der Rechten knetet sie ein altes Tempo. Der Rastalockige schaut ihr beim Anziehen zu, es geht schnell. Die Wohnungstür geht, Schritte auf dem Flur, eine muntere Rothaarige schaut kurz hinein und sagt »Hi«. Ihr Freund zieht sie zurück in den Flur. »Da störste.« Sie kichert übertrieben anzüglich. Dann tönt wieder Rammstein, Karla zündet sich eine Zigarette an, obwohl sie gar nicht raucht. Ihre Hände sind so nackt.
»Tut mir echt leid, willste noch ’n Bier?«
»Braucht dir nicht leid tun. Ich geh dann.« Karla zieht die Reißverschlüsse ihrer Stiefel hoch und merkt, wie betrunken sie ist. Sie kann nicht mal wütend sein. Das Pochen zwischen ihren Beinen läßt nach. »Bleib doch noch.«
»Wozu?«
»Ich find dich auch nett. War doch ein geiler Abend.«
Karla ist schlecht. »Ich finde mich überhaupt nicht nett, okay? Ist unten jetzt offen?« Sie reißt die Küchentür auf und die Schultern zurück. Nur noch einen starken Abgang hinlegen.
Liebe ist kein Geschenk, nach dem dreißigsten sollte man damit nicht mehr rechnen. Das Leben ist kein Kindergeburtstag, sondern Krieg, man darf sein Gesicht nicht verlieren. Mit Sinnsprüchen knüppelt sie sich vorwärts. Endlich ist sie durch den roten Flur und an der Wohnungstür. Der Rastalockige ist hinter ihr. Er hat den Hund auf dem Arm. »Nimm den ruhig mit, du magst ihn doch? Annette will ihn sowieso nicht, war auch so ’ne Scheißidee von Jochen. Der denkt nie nach, weißte. Alles Party, Party, Party.« Jochen heißt er also, ist kein schöner Name. Karla nimmt den Hund, weil ihr nichts Besseres einfällt, dabei macht man im Krieg keine Gefangenen, nicht in so einem.
Sie erschrickt, als sie die schwindelnde Treppe hinabschaut. Und das mit Hund auf dem Arm. Krieg ist Krieg, sie faßt nicht mal nach dem Geländer, sondern geht beachtlich gleichmäßig die Stufen hinab. So sieht Gleichmut aus, denkt sie, und hält den Rhythmus fünf Stockwerke durch, obwohl der Rastalockige sie gar nicht mehr sehen kann, nur noch die Quittländer durch den Türspion.
Karla läßt die ausgeleierte Haustür krachend hinter sich ins Schloß fallen. Sie überlegt, ob sie weinen soll, womit die Frage beantwortet ist. Eigentlich muß sie jetzt nach links, wo die Apartments neben dem Drogeriemarkt liegen. Was soll sie da? Der Walkürenritt des Antiquars läßt sie aufhorchen. Die Musik kommt von der anderen Straßenseite. Da leuchtet ein paar Meter entfernt noch das Rechteck einer offenen Tür. Der Kiosk. Und Wagner. Ein Mann steht mit dem Rücken zu ihr und ruft einem kleinen Mädchen was nach, das eine klirrende Tüte schleppt.
Karla kann mit Kindern noch weniger anfangen als mit Hunden, aber was der Mann da ruft, ist scheinheiliger Dreck. Die Kleine schaut sich nicht mal um, kämpft nur mit der Tüte. Gott, ist der Mann ein Arschloch, so viel Körper und so wenig Hirn, Arschloch. Und das will sie ihm sagen. Erst als sie kurz hinter ihm ist und es ihm sagt, dreht er sich um. Auch so ’n Herzkönig.
Kwiatkowski ist ein bulliger, braungelockter Mann mit eckigem Gesicht, dem Kreuz eines Lastschleppers und barocken Hüften, fehlt nur die Wolle am Kinn, dann könnte er einen von den drei Musketieren spielen. Sie weiß nicht mehr, was sie dann noch so gesagt hat, nur daß an seinem Daumen ein Schild gebaumelt hat. Aushilfe gesucht oder so. Und dazu die Walküren.
Karla springt auf. Sie ist wieder in ihrem Badezimmer angekommen. Das Frotteetuch gleitet von ihren Hüften, der Welpe spielt Beute damit. »Scheiße, ich hab den Job angenommen«, kreischt Karla fast, »im Kiosk!« Der Welpe erschrickt und unterwirft sich mit Hundeblick.
»Wenn du so weitermachst, endest du als Heringsverkäuferin«, tönt ganz nah an ihrem Ohr die Mutter. »Und glaub ja nicht, daß dir dabei irgendein Mann aus der Patsche hilft.« Heringsverkäuferin hat sie immer gesagt, wenn sie mit Karlas Leistungen nicht zufrieden war oder Karla die feine Grenze jenes Schutzraums zu übertreten drohte, den die Mutter um sie und sich selbst errichtet hatte. Heringsverkäuferin.
»Nach allem, was ich für dich getan habe.«
Und kein Mann, der ihr da raushilft. Das hat sie nun geschafft. Nur daß es keine Heringe sind, die sie verkaufen wird, sondern Kamelle, wie man im Rheinland die Bonbons nennt. Und Kamelleverkäuferin klingt noch viel lächerlicher als Heringsverkäuferin.