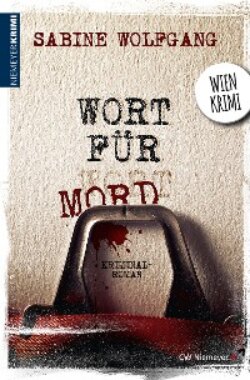Читать книгу Wort für Mord - Sabine Wolfgang - Страница 8
ОглавлениеKapitel 2 – Die Entscheidung
August 2008
Ihr Wecker läutete. Sie musste ihre Tabletten nehmen, das spürte sie im Kopf, im Herzen und in den Beinen. Sie fühlte sich abscheulich und sah auch so aus. Vor dem Einschlafen hatte sie gerade noch ihr Buch weglegen, aber kein Eselsohr mehr auf die letzte gelesene Seite machen können, wie gewöhnlich, bevor sie es auf ihrem Nachtkästchen deponierte. Am Tag zuvor war das unmöglich gewesen. Sie war matt. Jeder Muskel und Knochen in ihrem Körper bestätigte diese Empfindung. Sie kam sich alt und kraftlos vor. Ihre Krankheit war real.
Sie hörte Frank Kaffee kochen und Karola und Jasmin das Haus verlassen. Würde sie es wahrhaftig nicht miterleben, wie die Kinder die Universität absolvierten und einen Beruf ergriffen? Der Gedanke daran trieb ihr Tränen in die Augen, die sie zu ignorieren versuchte. Die Krankheit gab es nicht, solange sie sich nicht mit ihr auseinandersetzte. Sie existierte nicht, wenn sie die Gutgelaunte und Gesunde mimte. Der Krebs war unerwünscht im Hause Hogitsch.
Paula machte sich frisch, so gut es ging, jedes Mal wieder dankbar dafür, das Badezimmer direkt vom Schlafzimmer aus betreten zu können. So war es ihr möglich, ihr desolates Aussehen morgendlich in Ordnung zu bringen, bevor sie ihrer Familie gegenübertrat. Erstaunlich, wie leicht sich Frank und die Kinder täuschen ließen. Ihr Talent, Menschen auferstehen zu lassen, befähigte sie offenbar dazu, sich selbst zu verwandeln und traurige Tatsachen geschickt vor anderen zu verbergen.
„Es duftet wunderbar“, flüsterte sie, während sie ihrem Ehemann von hinten einen Kuss auf den Nacken gab. Frank liebte es, sie mit dem Frühstück zu überraschen, wenn er zu Hause war. Die Tatsache, dass er sich beruflich fast ständig auf Reisen befand, hatte ihr eine jahrelang andauernde Karriere ermöglicht. Sie hätte nie so ertragreich schreiben und publizieren können, wäre er immerfort präsent gewesen. Seine häufige Abwesenheit bewirkte jedoch, dass sie sich nicht so gut kannten, wie das bei einem sich liebenden Ehepaar üblicherweise der Fall war. Er hatte nicht einmal bemerkt, dass sie etwas vor ihm verbarg.
„Ich bin bis elf Uhr noch für dich frei. Dann muss ich zum Flughafen.“
Frank verstand es zwar, seine für sie und die Kinder übrige Zeit so intensiv wie möglich zu gestalten, dennoch kam es ihr häufig so vor, als wäre die Familie nur ein weiterer Termin in seinem prall gefüllten Kalender. Hinzu kam, dass berufliche Treffen meist Vorrang hatten.
„Das ist schön. Wann kommst du zurück?“
„Ich denke, in zehn Tagen bin ich wieder da. Bei diesem Projekt ist leider nichts hundertprozentig fix, aber ich gebe dir Bescheid, sobald ich mehr weiß.“
Mit diesen Worten reichte er ihr den viel zu vollen Brotkorb und zwinkerte ihr zu, als wäre er frisch verliebt. Seine nassen Haare hingen ihm wirr ins Gesicht, was ihn um mindestens fünf Jahre jünger erscheinen ließ. Sie glaubte kaum, dass er demnächst 50 wurde. Lag es daran, dass sie als seine Frau die Veränderung an seinem Äußeren nicht bemerkte, oder sah er wirklich noch genauso aus wie vor zehn Jahren?
„Perfekt. Ich brauche die Zeit ohnehin. In ein paar Tagen soll das Konzept für ‚Zwischen den Zeilen‘ fertig sein.“
Paula war sich dessen bewusst, dass dieses Projekt eine große Herausforderung für sie darstellte. Biber & Benson, ihr Partnerverlag seit 13 Werken, wünschte sich einen Kassenschlager für das Weihnachtsgeschäft 2009, wie ihre Bücher früher bezeichnet werden konnten, bevor ihr Vertrag aufgekündigt wurde.
„Der neue Roman?“
Paula seufzte. Gewiss hatte sie ihrem Ehemann von den Anforderungen des Verlags und der Story dahinter erzählt.
„Du weißt doch. Zwei ungeklärte Morde in einer Kleinstadt. Ich wollte es zuerst nicht machen, weil es zu stark an ‚Unverhofft‘ erinnert, habe mich aber überreden lassen.“
Bei Frank dämmerte es. „Tut mir leid. Jetzt weiß ich, was du meinst. Die Geschichte für dein letztes Buch.“
Für Paula war es wie ein Faustschlag in die Magengrube, dies aus seinem Mund zu hören. Ihr definitiv letztes Buch. Der Verlag hatte ihren gemeinsamen Vertrag beendet, obwohl die Verkaufszahlen für die meisten ihrer Werke stets jegliche Erwartungen übertrafen, wobei sich die Nummer zehn als am erfolgreichsten und ihr absolutes Meisterwerk herausstellte. Mit dem darauf folgenden Roman allerdings war ihrer Erfolgskarriere ein jähes Ende bereitet worden. Ausgelöst durch dieses Verkaufstief entschied Peter Biber, den Vertrag mit ihr zu beenden, um „jungen, frischen Autoren Platz zu machen“. Die Aussage hatte sie damals schwer getroffen, vor allem deshalb, weil sie nach ihrem 40. Geburtstag ohnehin schon in ein tiefes Loch gefallen war. Und obwohl nach der Kündigung noch drei weitere Bücher herauskommen sollten und sie dadurch allesamt Zeit gewannen, die Entscheidung einmal mehr zu überdenken, rüttelte Biber nicht an seiner Anordnung und zeigte sich konsequent. Insgeheim hoffte Paula, mit dem zwölften Werk einen so großen Erfolg einzufahren, dass sich alle über die schlechteste Verlagsentscheidung, die je getroffen wurde, die Haare rauften und man die Schriftstellerin anflehen würde, doch wieder an Bord zu kommen. Dann ertappte sie sich bei dem Gedanken, den Verlagsleiter bitten und betteln zu lassen, während sie auf Zeit spielte und seine Verzweiflung auskostete.
Vorübergehend sprach niemand mehr von der Entscheidung des Verlagsleiters, was Paula als mögliche Wendung interpretierte, doch stur wie er war, machte Biber letztendlich Nägel mit Köpfen, ließ seinen Worten Taten folgen und kündigte ihr nächstes Buch bereits überall als letztes Werk an. Und während sie zwischenzeitlich immerhin ein wenig besser mit der Entscheidung des Verlags zurechtkam, befand sie sich nun erneut mitten in einem Tief, ausgelöst durch eine niederschmetternde Hiobsbotschaft, die ihr vor ein paar Wochen mitgeteilt worden war – sie war ernsthaft krank.
Paula strich sich die dunklen Locken aus dem Gesicht und konzentrierte sich auf ihr Marmeladenbrot, um nicht die Beherrschung zu verlieren und aufsteigende Tränen im Keim zu ersticken. Ihre Werke erregten Aufsehen. Nur weil der Verlag das nicht mehr zu schätzen wusste, musste sie nicht ihre kriminalistischen und schriftstellerischen Fähigkeiten infrage stellen. Sie würden sie später einmal anflehen, ihre Serie fortzusetzen, wenn sich kein Erfolg mit ihren „Frischlings-Autoren“ einstellte.
„Du wirst es wieder großartig hinkriegen“, warf Frank seiner Frau mit einem Lächeln zu, als ob er gewusst hätte, dass sie an sich zweifelte. „Ich glaube, wir haben genug Zeit, uns nach dem Frühstück noch einmal hinzulegen.“ Paula nahm endlich sein Schmunzeln an.
„Ruf an, wenn du dort bist!“
Und so war Paula wieder alleine. Sie konnte sich auf „Zwischen den Zeilen“ konzentrieren und würde Biber & Benson beweisen, dass in ihr immer noch Potenzial schlummerte. Wie sie dies trotz ihrer Erschöpfung allerdings anstellen sollte, erschloss sich ihr nicht.
Nach Franks Abreise ließ sie sich auf ihre senffarbene Couch sinken, erschöpft davon, stundenlang eine glückliche, gesunde Frau zu mimen, und schlief auf der Stelle ein. Ihre Träume handelten von Buchseiten, Tatwaffen, Polizeibeamten, Drohbriefen und Gefängniswärtern. In ihrer gegenwärtigen Lage, aber auch sonst, wenn sie an keinem Roman arbeitete, gelang es ihr kaum abzuschalten. Paula Hogitsch war Autorin. In jeder Sekunde ihrer Existenz.
Der nächste Morgen begann besser als der Tag davor. Möglicherweise lag das an Franks Abwesenheit. Weilte er nicht daheim, hatte sie die genialsten Einfälle. Kam er früher als erwartet von einer Dienstreise zurück, brachte sie es nicht fertig, einen sinnvollen Gedanken zu Ende zu führen, und formulierte ihre Sätze wie ein mittelbegabter Siebtklässler. Frank inspirierte sie. Doch nur dann, wenn er nicht physisch anwesend war.
Seit Jahren maßte sich der Verlagsleiter an, Paula Hogitsch Anweisungen für einen „Kassenschlager“ zu geben. Peter Biber überstrapazierte diesen Begriff, und das wusste er, doch er gehörte zu jener Sorte Mensch, die nur Zahlen im Blickfeld hatten. Ob er schon jemals eines der Bücher, die er verlegte, gelesen hatte? Paula schämte sich für diesen Gedanken und verdrängte ihn schnell wieder. Peter war in Ordnung, doch eben ein reiner Geschäftsmann. Wie man einen Roman konzipierte, aufbaute und umsetzte, durchschaute er nicht. Sein Vorgänger Rainer Benson wusste darüber besser Bescheid, doch mit Paulas neuntem Werk hatte er sich in die Rente verabschiedet, und so war sie gezwungen, sich mit ihrem neuen Chef zufriedenzugeben.
Just nach Bibers Einstieg in den Verlag schuf Paula mit ihrem zehnten das bisher erfolgreichste Werk ihrer Karriere, was der Neuankömmling ohne zu zögern auf seine Neustrukturierungen, innovativen Ideen und moderne Marketingoffensiven schob. Auch sie zeigte sich begeistert von den Zahlen, doch ebenso rasch klang ihr Enthusiasmus wieder ab, als Biber eine folgenschwere Entscheidung traf.
„Die Idee zu ‚Zwischen den Zeilen‘ ist mir im Urlaub gekommen“, verkaufte ihr der Verlagsleiter damals seine Vorstellung zum Abschluss-Kassenschlager. Bis zu ihrem 13. Werk hatte er sie nicht mit seinen inhaltlichen Ideen belästigt, doch nun bildete er sich offenbar ein, beim letzten Werk unbedingt sein eigenes Konzept umgesetzt sehen zu müssen. Er liebte es, sich in Szene zu setzen. Jeder verstand es, seine Geistesblitze wohlwollend lobend zu kommentieren: Sie waren „brillant“, was immer er sich zusammengereimt hatte.
„Zwei Morde in einer Kleinstadt oder in einem Dorf – ganz wie Sie wollen. Paula, Sie wohnen doch in einem kleinen Ort. Stellen Sie sich dessen Einwohner vor. Die Routine, die dort vorherrscht. Die Gesichter, die jeder kennt. Und dann plötzlich geschieht ein Mord. Niemand kann sich erklären, was dahintersteckt. Wer kann es gewesen sein? Ein Fremder? Ein Stadtbewohner? Der Fall bleibt ungelöst und wird zu den Akten gelegt. Dann, einige Zeit später, Mord Nummer zwei. Steht er in Zusammenhang mit der Tat von damals? Oder haben die beiden Fälle vielleicht gar nichts miteinander zu tun? Wird die Polizei die Verbrechen aufklären und den oder die Täter endlich hinter Gitter bringen?“
Paula stand das Bild vor Augen, wie Peter damals die Idee vor versammelter Mannschaft in seinem Büro präsentiert hatte und es nicht erwarten konnte, Beifallsstürme zu ernten. Als das Team abwartend reagierte, verharrte er in seiner Siegerpose, während sich seine Miene zunehmend verfinsterte. Paula leitete den Beifall ein, um die unangenehme Situation zu retten, woraufhin sich die Mundwinkel des Verlagsleiters nach oben zogen und er sogar eine Verbeugung andeutete.
„Brillant“, flüsterte man durch den Raum.
„Paula, was sagen Sie? Können Sie damit etwas anfangen?“ Peter forderte sie mit seinen direkten Fragen heraus.
„Natürlich. Eine gute Geschichte. Ich möchte nur anmerken, dass sie der in ‚Unverhofft‘ ähnelt.“ Paula hatte sich über all die Jahre ihre vorsichtige Ausdrucksweise bewahrt. Das Thema war nicht neu.
Der Blick von Peter ließ erkennen, dass er mit dem Titel des Buchs nicht viel anfangen konnte. Wie war jemand wie er nur in der Lage, diesen Verlag zu führen, wenn er sein eigenes Programm nicht einmal kannte?
„Mein Neuntes?“, half ihm Paula auf die Sprünge.
„Oh, tut mir leid.“ Seine Entschuldigung klang aufrichtig. „Ich kenne Ihren neunten Roman natürlich. Ähnlichkeiten bestehen, das lässt sich nicht leugnen, aber bestimmt nicht mehr als bei Ihren anderen Geschichten, wenn man sie miteinander vergleicht.“
Das klang wie eine Beleidigung. Deutete er damit etwa an, dass sie aufgrund begrenzter Fantasie immer das Gleiche schrieb?
„Es liegt an Ihnen, die Story abwechslungsreich zu gestalten und clever zu variieren. Was ich Ihnen vorgestellt habe, dient als Grundgerüst. Sie haben alle Freiheiten der Welt. Ich möchte nur, dass der kleine Ort als Location dient und zwei Morde unaufgeklärt bleiben. Die Atmosphäre in dem Kaff authentisch zu schildern dürfte Ihnen nicht schwerfallen. Sie wohnen doch in einem kleinen Ort.“
Peter wiederholte sich, was Paula nicht leiden konnte.
„Frankendorf“, warf sie ihm über den Tisch zu, ahnend, dass er damit nichts anzufangen wusste. Der Ort lag etwa 100 Kilometer von Wien entfernt. Paula war sicher, dass er nie etwas davon gehört hatte.
All das ging ihr an diesem Morgen durch den Kopf, bevor sie ihren Computer in Betrieb nahm. In einer Woche sollte das Exposé vorliegen. Auch hierin unterschied sich der neue Verlagsleiter von Rainer Benson: Er verlangte detaillierte Konzepte mit einer Länge von etwa 20 Seiten.
Rainer hatte ihr mehr vertraut und sie in Ruhe arbeiten lassen, sobald er nach einem kurzen Gespräch wusste, worüber sie schreiben wollte. „Klingt hervorragend“, lautete sein Standardkommentar zu ihren Ideen. Danach war sie ungestört in ihr Werk eingetaucht, ohne Kontrolle, ohne Druck. Paula seufzte. Wie sehr wünschte sie sich in solchen Momenten Peters Vorgänger zurück.
Während ihr Computer hochfuhr, der aufgrund zunehmender Altersschwäche von Mal zu Mal mehr Zeit für diese Prozedur benötigte, versuchte sie, sich in die Geschichte hineinzudenken. Laufend passierten auf der ganzen Welt Morde, die unaufgeklärt blieben, doch Paula bevorzugte es stets, sich weniger mit den realen Verbrechern als vielmehr mit ihren Fantasiefiguren auseinanderzusetzen. Solange die Gräueltaten da draußen niemanden betrafen, den sie kannte, ließ sie all die Vorfälle in der Welt so wenig wie möglich an sich heran und lebte lieber in ihrem eigenen Universum mit den von ihr erschaffenen Protagonisten. Erfundene Figuren handeln zu lassen, so wie es ihr gefiel, und sie dazu zu bringen, zu tun, was sie verlangte, fand sie zeit ihres Lebens ansprechender.
Um ihren Gedanken ungestört freien Lauf zu lassen, holte sich Paula einen Krug Wasser aus der Küche. Davon konnte sie nie genug kriegen. Es wirkte wie eine Droge auf ihre Kreativität und ihren kriminalistischen Spürsinn. Als sie das Gefäß aus dem Küchenschrank über Kopfhöhe nahm, fiel ihr ein Bleikristallglas entgegen, das sich zu knapp am Rand des Kastens befunden hatte und nun klirrend auf dem Boden landete. Es handelte sich um das letzte aus einer Serie, die von ihrer inzwischen verstorbenen Großmutter stammte. Das Glas zersprang in Tausende von kleinen Scherben.
Bevor Paula den Krug mit Wasser füllte, beabsichtigte sie, die vielen winzigen Glasstücke, den Rest von Omas Vermächtnis, der am Küchenboden verstreut lag, aufzukehren. Beim Niederknien fuhr ihr ein stechender Schmerz durch den Kopf und verdunkelte sekundenlang das Bild vor ihren Augen. Ihre körperlichen Beschwerden meldeten sich zurück. Schwächelte bloß der Kreislauf, oder hatte der Krebs etwas damit zu tun?
Seit einem Monat lebte sie völlig alleine mit der niederschmetternden Diagnose, doch sie war noch immer nicht bereit, Frank und die Kinder einzuweihen, und zu mutlos, die richtigen Worte zu finden. Hatte sie womöglich bald nicht einmal mehr ausreichend Kraft, um überhaupt darüber zu sprechen? Und ging es ihr nun wirklich wegen ihrer Krankheit so schlecht oder deshalb, weil sie von der Diagnose überrumpelt worden war? Manchmal wünschte sie, nicht zum Arzt gegangen zu sein. So wäre nach wie vor alles wie früher, und sie müsste sich nicht schlagartig mit Themen auseinandersetzen, die sie mehr in die Realität denn in die Fantasie zwangen.
Der Schmerz wurde erträglicher, als sie sich einige Minuten auf ihrem Lesesessel ausruhte. Sie musste mit ihrer Arbeit beginnen, um später nicht unter Druck zu geraten – so eine Stresssituation würde sie in ihrem angeschlagenen gesundheitlichen Zustand kaum ertragen. Es gab keine andere Wahl, als sich zu zwingen und die Schwächemomente zu übertünchen. Sie war erfolgreich. Sie war Autorin. Sie war Paula Hogitsch.
„Haben Sie schon mit Ihrer Familie gesprochen?“ Der Mediziner redete ihr seit drei Wochen ins Gewissen, doch er wusste genau, sie nicht dazu zwingen zu können und sich ferner nicht in ihre Angelegenheiten mischen zu dürfen. „Warum lassen Sie sich nicht helfen? Ihr Mann und Ihre Kinder haben ein Anrecht darauf, zu erfahren, wie es um Sie steht.“
„Ich weiß.“ Paula versuchte, gefasst zu bleiben. „Ich schaffe es einfach nicht. Glauben Sie mir, ich werde es ihnen demnächst sagen. Aber bis dahin will ich die Zeit genießen, die mir mit meiner Familie bleibt.“ Mit Tränen in den Augen schluckte sie und wagte es nicht, ihren Arzt anzublicken.
Frank würde sofort seinen Job aufgeben, was sie auf keinen Fall zulassen würde. Sie war nur imstande, die Krankheit zu besiegen, wenn sie viel Zeit alleine verbrachte und schreiben durfte. Doch sosehr sie sich seit der Diagnose Heilung durch ihre schriftstellerische Tätigkeit erhoffte, so konsequent wurde sie bis dato enttäuscht. Jedes Mal, wenn sie von einer leeren Seite am Computer angestarrt wurde, krampfte sich ihr Magen zusammen, als würde sie von einer ausweglosen Schreibblockade heimgesucht. Noch nie zuvor hatte sie so empfunden, wenn sie einem schriftstellerischen Vorhaben nachgehen wollte.
Der Zwang, in den nächsten Tagen endlich ein Konzept fertigzustellen, hing über ihr wie ein Damoklesschwert. Die Schwierigkeiten, es zu erstellen, konnten kaum daran liegen, dass sie aus der Übung war. Schließlich hatte sie ihr letztes Werk erst vor ein paar Monaten abgeliefert. In den vier Wochen im Juli hatte sie sich die dringend nötige Ruhe gegönnt und sich vom Schreiben, Tüfteln und Grübeln zurückgezogen, doch in den Jahren zuvor war sie spätestens Anfang August gestärkt und voller neuer Ideen zurückgekommen und hatte im Nullkommanichts ein Konzept für das nächste Werk zu Papier gebracht, das sie – beflügelt von der neu entfachten Schreiblust – kurz darauf auszuarbeiten begann.
Mangelte es ihr nun tatsächlich an Kraft und Konsequenz, weil der Krebs an ihr nagte? Schafften es die Medikamente und die bald startenden Behandlungen, den Verfall zu stoppen? Oder zumindest zu verhindern, dass sie sich fühlte wie jetzt? Vielleicht ging ihr nur ein schriftstellerisches Erfolgserlebnis ab, durch das sie Genesung erleben würde. In zwei Monaten erschien ihr 13. Roman „Im Duett“. Vielleicht würde sie durch seinen Erfolg einen Push erleben, den sie so dringend nötig hatte.
Eine E-Mail von Peter Biber verriet ihr, dass er bereits auf das Konzept wartete, obwohl er ihr als Deadline den 1. September vorgeschrieben hatte, der erst in vier Tagen war. Wie es ihr in der Vorbereitung ginge, wollte der Verleger wissen. „Ich bin dabei“, fauchte Paula den unschuldigen Laptop an, als könnte sie Peter auf diese Art und Weise zufriedenstellen. An besagtem Tag würde er ein fertiges Exposé in seinem Posteingang vorfinden, woraufhin die richtige Arbeit begann. Der Zeitrahmen erstreckte sich wie immer bis Mai nächsten Jahres. So war sichergestellt, dass Lektorat und Druck eine Veröffentlichung im Oktober oder November, rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit, garantierten.
Nicht einmal so hilflos wie jetzt hatte sich Paula damals gefühlt, als sich abgezeichnet hatte, dass sich „In alle Ewigkeit“ nicht verkaufte. Ihr elftes Werk konnte schonungslos als größter Flop ihrer gesamten Karriere bezeichnet werden, auch wenn sie sich selber darum bemühte, diesen grässlichen Begriff lieber nicht in den Mund zu nehmen. Wann immer Peter das Buch so nannte, zog sich alles in ihr zusammen, als hätte ihr jemand in den Magen getreten. Obwohl damals eine Lesetour und unzählige Marketingaktivitäten – genau wie die vielen Male zuvor – unternommen wurden, stockte der Verkauf aus unerklärlichen Gründen, wofür nicht einmal die Verlagsleitung eine Erklärung fand.
Paula hatte gehofft, dass man verlagsintern darüber hinwegsah, doch diesen großen Misserfolg ignorierte niemand, auch wenn sie es noch so sehr wollten. Und dann kam sie. Die unfassbare Entscheidung, den Vertrag mit ihrem einstigen Zugpferd nicht zu verlängern. Der zwölfte Roman war zu jener Zeit im Entstehen, und auch für einen 13. und 14. war bereits ein Vertrag abgeschlossen worden, doch danach war Schluss. Obwohl ihr von einem auf das andere Mal klar wurde, dass ihre Karriere als Schriftstellerin jederzeit zu Ende gehen konnte, war die endgültige Entscheidung des Verlags für sie damals schwerer zu ertragen gewesen als erwartet. Tagelang hatte sie sich zu Hause verkrochen, in einer Art Schockstarre, die eine schier unerträgliche Zukunftsperspektive mit sich brachte. Was würde Paula anstellen, wenn sie keine Romane mehr schrieb? Oder würde sich ein neuer Verlag ihrer erbarmen und sie unter ihre Fittiche nehmen? Befanden sich ihre Buchverkäufe am absteigenden Ast, stand es auch um andere Kooperationen schlecht. Frank hatte damals immer wieder versucht, ihr gut zuzureden, und ihr geraten, sich darauf zu konzentrieren, was sie schon geschaffen hatte. Wie viele andere Autoren brachten im Vergleich zu ihr so eine Vielzahl erfolgreicher Werke zu Papier? Er hatte zwar recht, dennoch war es für sie so, als würde man sie ihrer Talente berauben und ihr die Existenzgrundlage nehmen.
Trotz ihres unangenehmen Gefühls zwang sich Paula dazu, die ersten Worte zu Papier zu bringen, als schlagartig laute Musik durch ihre Wohnzimmerfenster drang. „Kann man hier nicht einmal in Ruhe arbeiten?“, brüllte sie, woraufhin der Lärm abrupt verstummte. Womöglich wieder einer der Nachbarn, der annahm, alleine auf der Welt zu sein.
War es das schwüle Wetter, das ihr derart Kopfschmerzen bereitete? Sich auf die Geschichte zu konzentrieren, fiel ihr schwerer als je zuvor. Die Gedanken in ihrem Kopf ergaben jählings keinen Sinn mehr. Wer ermordete wen? Welches Motiv gab es? Hatte sie sich schon auf eine Tatwaffe festgelegt? Wo spielte sich alles ab? Was genau forderte Peter Biber in der Besprechung?
Schweiß perlte über ihre Haut und vermischte sich auf den Wangen mit aus den Augen quellenden Verzweiflungstränen zu dicken Tropfen, die aus ihrem Gesicht fielen und vereinzelt auf der Tastatur ihres Laptops landeten. War sie nicht mehr in der Lage, sich auf ein banales Konzept zu konzentrieren? Niemand verlangte von ihr, in den kommenden Tagen oder Wochen bereits ein fertiges Manuskript abzuliefern, sondern bloß ein mehrseitiges Exposé.
Instinktiv wurde ihr bewusst, dass nun ebendies eintrat, was bereits in den letzten Wochen ihre zweitgrößte Befürchtung gewesen war, die sich unmittelbar an ihre größte – das Fortschreiten der Krankheit – reihte. Immer wieder schossen ihr inmitten der Nacht jene Gedanken in den Kopf, die sie aufschrecken und stundenlang wach liegen ließen. Und dabei ging es nicht mehr nur um das Verfassen eines banalen Konzepts, sondern um den gesamten Roman, den sie vertraglich vereinbart hatte. Mit einer vorübergehenden Schreibblockade konnte sie umgehen. Aus Erfahrung wusste sie, dass man jener Platz gewähren sollte und gezwungen war, eine Pause einzulegen, bis es, wenn man sie erst einmal überstanden hatte, besser als zuvor weiterging. Doch dieses überwältigende Gefühl, das sie nun plagte, war mächtiger. Es bescherte ihr eine Unfähigkeit, gleich einem Blackout, die sich langanhaltender anfühlte. Außerdem schuldete sie es sich selbst, sich nun in vollem Umfang ihrer Gesundheit zu widmen und allen Behandlungen, die auf sie warteten, und Ruhephasen, die sie brauchte, Raum zu gewähren.
Paula Hogitsch war am Ende ihrer Karriere. Doch leider nicht nach dem 14. Werk, sondern davor.
Am nächsten Tag machte sich Paula auf den Weg. Ihr wurde schlagartig klar, dass sie unter Zwang stand, mit Peter klar Schiff zu machen. Ohne sich anzukündigen, setzte sie sich in ihr Auto und fuhr nach Wien Hütteldorf, wo sie ihr Fahrzeug abstellte und die U4 bis Pilgramgasse bestieg. Gesundheitlich fühlte sie sich besser als am Tag davor, was sie zur Annahme brachte, die lange Fahrt hin und retour problemlos auf sich nehmen zu können. Vorsichtshalber führte sie den Schlüssel für ihre Wiener Wohnung mit, sollte sie nicht mehr in der Lage sein, die Rückreise am Nachmittag anzutreten.
In der U-Bahn beobachtete sie die Menschen, die ein- und ausstiegen, in Gedanken versunken und geistig bei einer Besprechung, dem Feierabend oder der Familie waren. Sie liebte es, ihr Gegenüber und andere Umstehende genau zu mustern, Stimmungen zu erfassen und sich Geschichten zu den Gesichtern zusammenzureimen. Dazwischen gab es die eine oder andere Person, die ihrerseits Paula länger musterte und sie als Schriftstellerin entlarvte. Ab und an war es bis dato passiert, dass man sie ansprach und um ein Autogramm bat oder ihr unaufgefordert Kommentare zu ihren Werken mit auf den Weg gab.
Von der U-Bahn-Station der Pilgramgasse nahm sie das letzte Stück zu Fuß zum Verlagssitz, der sich seit jeher in der Lindengasse im 7. Bezirk, dem Kreativzentrum der Stadt, befand. Paula liebte die Gegend und hatte jahrelang überlegt, ihre Wohnung in Margareten zu verkaufen und sich stattdessen als Zweitwohnsitz in Wien Neubau niederzulassen. Die Preise, die man in der Hauptstadt mittlerweile für Immobilien bezahlte, hielten sie hingegen davon ab.
Immer wenn Paula in der Stadt unterwegs war, inhalierte sie die Atmosphäre, als verweilte ein Großstädter am Land, der zum ersten Mal wieder den betörenden Geruch von Wald, Wiese und Tieren wahrnahm. Obwohl sie das besinnliche Landleben liebte, wie sie es mit ihrer Familie führte, vermisste sie die kreative Luft, die durch die Gassen wehte, die zahlreichen Möglichkeiten, die die Stadt zur Unterhaltung bot, sowie die charmante Grantigkeit, die einen unabdingbaren Teil des Wiener Kosmos darstellte.
Kurz kam ihr der Einfall, in jener Umgebung derzeit kreativer sein zu können als auf dem Land, verwarf ihn jedoch wieder, als ihr der bloße Gedanke an das Konzept einen imaginären Schlag in die Magengrube bescherte. Zügig überquerte sie die Mariahilfer Straße, ohne dieses Mal im Thalia auf Bücher-Beutefang zu gehen. Obwohl es für sie üblicherweise zu einem Wien-Besuch dazugehörte, sich zumindest für eine Stunde der Literatur in ihrer Lieblingsbuchhandlung, wo damals alles begonnen hatte, zu verlieren, setzte sie ihren Weg zum Verlag unbeirrt fort und verzichtete auf eine fantasievolle Pause.
„Peter, ich …“
„Paula! Schön, dass Sie persönlich vorbeikommen. Sie wollen mir das Konzept unbedingt direkt übergeben, nicht? Gut so. Ich würde da ohnehin gerne noch etwas mit Ihnen besprechen. Denken Sie, es ist geschickt, wenn der Mörder ein Jungspund ist, oder soll er doch lieber schon etwas gesetzter sein? Christopher meint, ein älterer Übeltäter wäre vielleicht besser, aber ich bin mir da nicht sicher. Einen ganz jungen Mörder hatten wir noch nie …“
„Peter!“ Paula unterbrach seinen Redeschwall. Das war typisch für den Verlagsleiter, der nur das hörte, was ihm auch zusagte.
„Oh. Entschuldigen Sie. Sie wollten etwas sagen. Also, jung oder alt?“
Nie schaffte er es, seine Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen und sich nur auf sein Gegenüber und dessen Anliegen zu konzentrieren.
„Weder noch. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich es nicht fertigbringe.“
„Was? Einen jungen Mörder zum Leben erwecken? Aber Paula!“
„Peter, bitte! Hören Sie mir einfach zu. Es ist wichtig, dass Sie mich jetzt reden lassen.“ Endlich hatte Paula seine Aufmerksamkeit. Peter wurde leicht rot und versuchte, sich seine Verärgerung über die Ablenkung nicht anmerken zu lassen.
„Ich habe mir das überlegt. Ich schaffe es einfach nicht. Es ist an der Zeit, mich endlich auf meine Familie zu konzentrieren und das Schreiben ad acta zu legen. Ich habe einfach nicht mehr die Muße dazu.“
Paula war völlig klar, dass ihre Worte in Peters Ohren keinen Sinn ergaben. Nach ihrem letzten Werk konnte sie all das, was sie nun aufzählte, bis an ihr Lebensende machen und sich Tag und Nacht mit ihrer Familie beschäftigen. Außerdem hatte sie bis dato noch nie damit zu kämpfen gehabt, einer Aufgabe nicht gerecht zu werden oder unter Schreibblockaden zu leiden. Sie merkte, dass sie ihn nicht mit einer Lächerlichkeit wie jener abspeisen konnte, und gestand sich ein, ihm die Wahrheit zu schulden. Schließlich befand sie sich in einem aufrechten Vertragsverhältnis mit dem Verlag und hatte Verpflichtungen. Doch als wollte sie den Mann, der ihr vor Jahren mit der Kündigung der Zusammenarbeit so wehgetan hatte, hinhalten und für dumm verkaufen, spielte sie auf Zeit und wartete dessen verdutzte Reaktion ab.
„Ich weiß nicht, was Sie meinen.“ Er verstand es, seinem Ärger mit den Augen und nur wenigen Worten auf eine Art Ausdruck zu verleihen, die jeden einschüchterte. Mit Peter Biber spielte man keine Spielchen.
„Okay, tut mir leid.“ Was rede ich, dachte Paula, ich bin diejenige, die Verständnis verdient. Dann holte sie tief Luft und blickte dem Verlagsleiter entschlossen ins Gesicht. Ihr war bewusst, dass es nur zwei Möglichkeiten gab: den Roman zu schreiben und ihren kranken Körper mit dem Druck, einen Abschlussbestseller zu verfassen, zu belasten oder Peter Biber jetzt die Wahrheit zu gestehen. Ihrer Gesundheit zuliebe entschied sie sich für Letzteres.
„Ich bin schwer krank“, sagte sie mit fester Stimme, wobei ihre Worte durch den Raum schossen wie Pingpong-Bälle.
„Was?“ Die Miene ihres Gegenübers änderte sich schlagartig. „Was … was haben Sie da gerade gesagt?“
Zum ersten Mal, seit sie Peter kannte, kam es ihr so vor, als interessierte er sich für Paula, den Menschen, und nicht für die Erfolgsautorin.
„Es ist Krebs. Ich will nicht darüber reden.“
Peter war erschüttert. Zahlreiche Charaktere hatte Paula Hogitsch in ihren Romanen mit Worten ums Leben gebracht, doch jetzt befand sie sich selbst im Angesicht des Todes. Der Verlagsleiter räusperte sich verlegen, als er bemerkte, dass er gedanklich schon die Schlagzeile ihres Nachrufs formulierte. Und dann glaubte er, etwas anderes an Paula zu bemerken: Die immer leicht spröde wirkende Schriftstellerin erkannte, dass sie sich ebenso vor dem Sterben fürchtete wie ihre Figuren, die ihrem grausamen Schicksal hilflos ausgeliefert waren. Die sie dieser Angst aussetzte.
Paula bat ihn inständig darum, es niemandem zu erzählen und besonders den Medien gegenüber Diskretion zu wahren. Die Information, dass die große Schriftstellerin Paula Hogitsch an Krebs litt, sollte keinesfalls das Verlagshaus verlassen. Sie hatte ihn nicht eingeweiht, weil sie ihm so vertraute, sondern nur deswegen, weil sie ihm durch die schriftliche Abmachung mit dem Verlag die Wahrheit schuldete. Nie und nimmer hätte er es akzeptiert, wäre sie ohne Angabe triftiger Gründe vom Vertrag zurückgetreten.
Es würde ein Geheimnis zwischen ihm und wenigen eingeweihten Verlagsmitarbeitern bleiben, dass das 14. Werk von Paula Hogitsch nicht von ihr selbst stammte – denn eines war sicher: Es musste erscheinen. Die Fans warteten bereits ungeduldig auf den überall angekündigten neuen Roman.