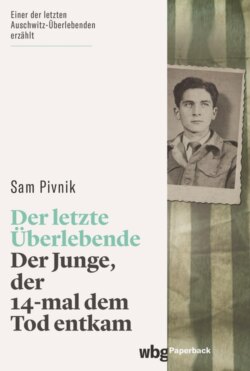Читать книгу Der letzte Überlebende - Sam Pivnik - Страница 10
2
Eine Welt wird auf den Kopf gestellt
ОглавлениеIch feiere meinen Geburtstag nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Genauer gesagt, seit dem 1. September 1939, denn an diesem Tag marschierten die Deutschen in Polen ein. Ich weiß nicht, ob ich an diesem Geburtstag noch Geschenke bekam, vermutlich schon. Es waren schwierige Zeiten, aber meine Mutter war daran gewöhnt, mit der Familienkasse zu jonglieren, und meine Eltern hätten mich nie enttäuscht. Es war ein Freitag, ein warmer Spätsommertag, und der Himmel über Będzin war wolkenlos. Die Schule hatte nach den Sommerferien noch nicht wieder begonnen, erst am Montag würde es so weit sein. Und so spielte ich mit meinen Freunden auf der Straße. Wer dabei war, weiß ich nicht mehr genau, aber vermutlich Yitzhak Wesleman, Jurel und die drei Gutsek-Jungen. Einer von uns hatte sicher einen Fußball dabei. Irgendeiner hatte immer einen Fußball dabei. Aber an diesem Tag war alles anders.
Es lag nicht daran, dass ich dreizehn Jahre alt geworden war, wir hatten noch keine Vorstellung davon, Teenager zu sein. Es hatte nichts mit uns zu tun, und doch waren wir darin gefangen. Etwas ging unten in den großen Kasernen vor sich, gleich beim Bahnhof. Leute eilten dorthin, rannten zu zweit oder zu dritt die Straße entlang, murmelten vor sich hin und machten ernste, erregte Gesichter. Wir folgten ihnen.
Ich habe immer gern Soldaten beobachtet, bevor Soldaten für mich auf einmal etwas ganz anderes bedeuteten. Unser Ortsregiment war die 23. Leichte Artillerie, die wie der größte Teil der polnischen Armee noch beritten war. Wir Jungen sahen bei den Paraden auf dem Hauptplatz zu, wenn die glänzenden Stiefel aufs Pflaster schlugen, betrachteten die kakifarbenen Uniformen mit den grünen Schulterklappen und den glänzenden Knöpfen und Abzeichen. Von Zeit zu Zeit verließen sie die Stadt, um Manöver durchzuführen. Dann zogen die Pferde die lackierten Kanonen, und die Räder ratterten über die Steine.
An diesem Tag jedoch war es anders. Nichts war auf Hochglanz poliert, und selbst ein Dreizehnjähriger erkannte die Verzweiflung und Panik. Allerdings sahen wir nicht viel, weil so viele Zuschauer gekommen waren. Wir fragten ein paar Erwachsene, was eigentlich los war, warum dieser Aufruhr? Wir hatten doch schon so oft zugesehen, wenn die Soldaten ins Manöver gezogen waren. Kriegsspiele. Das machten Soldaten eben. Ich erinnere mich bis heute an die Antworten. Ein Mann drehte sich zu uns um und schaute uns mit all der schrecklichen Erfahrung eines langen Lebens an. Er sagte uns, die Deutschen seien einmarschiert. Wir sahen uns verständnislos an. Er versuchte es noch einmal, sagte, jetzt sei Krieg. Keine Reaktion. Er zuckte mit den Schultern und gab es auf. Vermutlich murmelte er eine böse Bemerkung über die Jugend von heute, wie es so viele Generationen schon getan hatten.
Ich blieb wohl bis zum Vormittag dort und beobachtete das Kommen und Gehen, hörte dem Knarzen der ledernen Stiefel zu, dem Schnauben und Wiehern der Pferde, dem Rasseln von Stahl und den gebrüllten Kommandos. Kurz vor Mittag öffneten sich die riesigen Kasernentore, und das Regiment marschierte hinaus. Keine Kapelle, keine Fahnen. Ein paar Leute in der Zuschauermenge jubelten den Soldaten zu, klatschten und winkten. Die Soldaten jedoch sahen ernst und konzentriert aus und starrten nur geradeaus.
Wir beobachteten, wie die Letzten von ihnen um die Ecke am Hauptplatz gingen, dann kehrten wir zu unserem Fußballspiel zurück. Erst nach einer Weile nahmen wir das Geräusch wahr: ein dumpfes Grollen wie Donner in den fernen Karpaten. Aber es wurde lauter. Manchmal hörte man über unsere Rufe und das Geräusch unserer Stiefel, die den Lumpenball trafen, in der Ferne ein Knallen und Krachen. So etwas hatten wir noch nie gehört, keiner von uns. Aber jetzt wussten wir, dass der Krieg nach Będzin kam. Und nichts würde jemals wieder so sein wie früher.
Damals und noch lange danach wussten wir nicht, dass die Deutschen die polnische Grenze um fünf Uhr fünfundvierzig überschritten hatten, während das Morgengrauen wieder einen schönen Tag ankündigte. Eigentlich war der Einmarsch schon für den 25. August geplant gewesen, aber dann hatten sie ihn noch einmal aufgeschoben, um ganz sicher bereit zu sein. Außerdem mussten sie warten, bis „wir“ sie angriffen. Das war natürlich alles nur vorgeschoben. Am Vortag morgens um acht hatten polnische Truppen angeblich einen deutschen Radiosender in Gleiwitz angegriffen, gar nicht weit von Będzin entfernt. Jeder Pole wusste, dass das Unsinn war, aber die meisten Deutschen glaubten die Geschichte. Tatsächlich handelte es sich bei den angeblichen polnischen Angreifern um SS-Leute in gestohlenen Uniformen. Das ganze Fiasko war inszeniert worden, um den Polen die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Es gab keine Kriegserklärung. Nur zivilisierte Länder gaben Kriegserklärungen ab. Die Deutschen gaben dem Angriff den Codenamen „Fall Weiß“ und setzten dreiundfünfzig Divisionen gegen uns ein. Zu dieser Zeit hatten wir dreißig Infanteriedivisionen plus neun in Reserve, elf Kavalleriebrigaden und zwei motorisierte Brigaden, dazu ein paar kleinere Unterstützungseinheiten wie zum Beispiel die Pioniere. Die Armee von Krakau war am 23. März als Stützpfeiler der polnischen Verteidigung gegründet worden. Sie war unsere nächste übergeordnete Einheit und bestand aus fünf Divisionen, einer berittenen Brigade, einer Brigade Gebirgsjäger und einer Brigade Kavallerie. Kommandeur war Oberst Władysław Powierza, sein Vorgesetzter war General Antoni Szylling, der Divisionskommandeur.
An diesem Freitag, als alles begann, wusste ich nichts von alledem, aber bald redeten die Erwachsenen von nichts anderem mehr, und wir schnappten vieles auf. Armeen, Divisionen, Bataillone, Regimenter, Kavallerie, Artillerie – alles nur Wörter, die mir vollkommen unverständlich waren. Als der Nachmittag kam, traten wir immer noch gegen den Ball, aber jetzt hörten wir das Dröhnen von Propellerflugzeugen, die sich von Westen her näherten. Wir wussten, dass die polnische Luftwaffe einen guten Ruf genoss, aber wir hatten sie noch nie in Formation fliegen sehen. Es dauerte eine Weile, bis man seine Augen darauf eingestellt hatte und alles wahrnahm. Dann sahen wir die Welle tarnfarbener Bomber, deren Geschütze in der Sonne blitzten. Als sie die Burg erreichten, teilte sich die Formation, und einige Flugzeuge drehten ab, um verschiedene Teile der Stadt anzugreifen. Jetzt sahen wir die schwarzen Kreuze auf den hellblauen Unterseiten der Tragflächen. Viel später erfuhren wir, dass dies ein erstes Beispiel für die tödliche neue Taktik der Deutschen gewesen war: der „Blitzkrieg“ hatte begonnen. Zuerst kam der Luftschlag, dann das Gemetzel am Boden. Während die Maschinen über uns dröhnten, ahnten wir nicht, dass die Stadt Wieluń (Welun), etwa hundert Kilometer Luftlinie von uns entfernt, bereits bombardiert worden war. Drei Viertel der Häuser waren in Schutt und Asche gelegt, zwölfhundert Menschen waren tot, die meisten von ihnen Zivilisten.
Ich erinnere mich noch an das dumpfe Geräusch, als die ersten Bomben fielen. Sie trafen den Bahnhof mit dem Flachdach und der Jugendstilfassade, schlugen auf Zink und Kupfer und zerstörten die Kommunikationsmittel und die Lebensadern von Będzin. Es ist seltsam: Man hört nicht nur, wenn eine Bombe einschlägt, man spürt es. Die Druckwelle fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Wir spielten weiter, aber weniger selbstsicher als zuvor. Schwarzer Rauch hing über den Türmen der Burg. Die Flugzeuge verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Allmählich begriffen wir alle, dass etwas Schreckliches passiert war, und dachten an unsere Familien. Wir mussten jetzt wirklich nach Hause!
Ich rannte die Modrzejowska hinunter und durch Herrn Rojeckis Torbogen. Meine Mutter und Hendla bereiteten bereits das Sabbat-Essen für den Abend vor, aber von meinem Vater war keine Spur zu sehen. Ich wusste, er war in der Synagoge oder im stibl, gemeinsam mit den anderen Ältesten und dem Rabbi. Irgendwer musste doch wissen, was da vor sich ging, warum uns der totale Krieg überschwemmte. Ich plapperte auf die beiden Frauen ein, erzählte, was ich gesehen hatte, und übertrieb dabei vermutlich schamlos, wie es Dreizehnjährige so tun. Meine Mutter sagte nichts dazu, sie plauderte nur übers Essen und den Sabbat. Instinktiv wusste ich, dass mein Vater an diesem Freitagabend keinen Obdachlosen mitbringen würde, wie sonst so häufig. Vermutlich hatte er meiner Mutter verboten, mit uns über die Ereignisse des Tages zu sprechen. Jahre später erfuhr ich, dass Großbritannien und Frankreich bereits kurz davorstanden, Deutschland den Krieg zu erklären. Der britische Premierminister Neville Chamberlain hatte es im Radio bereits angekündigt. Die Briten evakuierten ihre Kinder vor dem „Blitzkrieg“ aus den Städten, wir erlebten ihn unmittelbar. Für uns war er nicht länger eine abstrakte Bedrohung.
Von unseren Fenstern, die auf den Hof hinausgingen und von denen aus wir Vaters Werkstatt sehen konnten, nahmen wir die Rauchsäulen wahr, die an diesem Abend den Sonnenuntergang verdunkelten. Wir rochen den Brandgeruch in der warmen Luft – nicht den süßen Duft von brennendem Holz, den wir aus dem Garten Eden kannten, sondern einen scharfen, stechenden Geruch, den wir nicht kannten. Wir versammelten uns wie immer um den Tisch, als meine Mutter die Kerzen anzündete, aber es lag keine Freude in unseren Augen. Die Gespräche wirkten gestelzt und angespannt. Nach dem Essen saßen wir da und hörten Vater zu, der aus der Bibel vorlas, diese vertrauten Worte, die ich mein ganzes Leben lang kannte. Aber an diesem Abend war es anders. Es gab keine Verheißung eines neuen Morgens, das weiß ich heute.
Samstag, der 2. September, war Sabbat. Ein warmer, sonniger Tag. Normalerweise hätten wir uns auf den Weg zur Synagoge gemacht, gemeinsam mit Freunden und Nachbarn, um Gott zu danken. Aber an diesem Tag gingen wir nicht. Und es würde noch zwölf Jahre dauern, bis ich wieder einen Fuß in eine Synagoge setzen sollte. Es gab auch keine Feste mehr. Alle Rituale des jüdischen Jahreskreises wurden abgeschafft oder unmöglich gemacht. Nathans Bar-Mizwa zwei Jahre zuvor war eine große Zeremonie gewesen. Meine wurde ein paar Wochen nach dem Einmarsch der Deutschen bei uns in der Küche begangen, ohne die Thora aus der Synagoge, ohne Rabbi oder Kaffee und Kuchen. An diesem Tag im September wurde ich sozusagen zum Mann. Am Tag zuvor hatte ich noch Fußball gespielt und Soldaten zugewinkt. Jetzt sah ich die Flüchtlinge, die vorbeizogen, traurige, obdachlose, gesichtslose Menschen, wie sie die nächsten sechs Jahre die Straßen Europas verstopfen würden. Es war wie der Exodus, von dem der Rabbi und mein Vater erzählt hatten, aber unter den Flüchtlingen waren auch Nicht-Juden, die gemeinsam mit den Juden ostwärts hasteten und versuchten, dem Vormarsch der Wehrmacht zu entkommen. Jede nur vorstellbare Art von Transportmitteln wurde benutzt. Die Wohlhabenden hatten Autos, die Geschäftsleute ihre Lastwagen. Andere schlugen auf ihre Pferde vor den Karren ein, Karren, auf denen sich ein ganzes Leben befand. Koffer, Taschen, Bettzeug und Matratzen, hier und da ein Vogelkäfig, ein Waschzuber. Noch herrschte keine Panik. Die Menschheit neigt ja zum Optimismus. Irgendetwas würde geschehen. Gott würde Hilfe senden. Aber sie blieben nicht lange in Będzin, die Stadt befand sich zu nahe an der Front, und es konnte gut sein, dass sie morgen schon mitten im Kampfgebiet lag.
Und dann die Gerüchte. Die nächsten sechs Jahre drehte sich mein Leben nur um Gerüchte. Die Deutschen bombardierten jede Stadt auf ihrem Weg und mähten die noch lebenden Zivilisten mit Maschinengewehren nieder. Ihre Stukas bombardierten die Flüchtlingsströme, die sich nach Osten bewegten. Aber keine Sorge, die polnische Armee drängte sie über die Grenze zurück. Alles würde gut.
Die Wahrheit, die an jenem 2. September niemand in Będzin kannte, sah so aus: General Reichenaus 10. Armee und General Lists 14. Armee bewegten sich auf Krakau zu und schlugen jeden Widerstand nieder. General von Rundstedts Truppen hatten bereits die Warthe überquert. Mit erheblichen Verlusten – vielleicht kam deshalb das Gerücht auf, die polnische Armee würde die Deutschen zurückdrängen –, aber unaufhörlich. Immer weiter Richtung Osten. Der Angriff vollzog sich so schnell, dass unsere Armee sich gar nicht versammeln konnte, und die Reservisten um Tarnów (Tarnow) konnten nicht schnell genug zum Einsatz gebracht werden.
Ich erinnere mich nicht, was ich an jenem Samstag oder am darauffolgenden Sonntag tat. Vermutlich spielte ich mit meinen Freunden und wir tauschten die Gerüchte aus, die wir an den Straßenecken und zu Hause gehört hatten. Nur bei uns zu Hause wurde kein Wort über den Krieg gesprochen. Einige Erwachsene klammerten sich an den Strohhalm der Unterstützung durch die Alliierten. Die Briten und Franzosen, so erklärte das polnische Radio, hatten Deutschland ein Ultimatum gestellt, sich entweder sofort aus Polen zurückzuziehen oder auf einen Zwei-Fronten-Krieg einzulassen. Das klang doch gut, sagten die Erwachsenen, nicht einmal ein Verrückter wie Adolf Hitler würde einen solchen Krieg riskieren.
Ich erinnere mich nicht, dass detaillierter über Politik gesprochen wurde, jedenfalls sprach mein Vater vor uns Kindern nicht darüber. Vielleicht wusste Hendla mehr, aber sie war ein Mädchen und verstand wohl auch nicht wirklich, was vor sich ging. So dachte ich zumindest.
Bis heute können Historiker nicht sagen, wie verrückt Adolf Hitler eigentlich war. Einige sprechen von seinem Narzissmus, seiner Arroganz, seinem obsessiven Rassismus und seinem zunehmenden Größenwahn. Der Zweite Weltkrieg, so sagen sie, war Hitlers Krieg, man muss sich nur diesen komischen kleinen bayerischen Gefreiten ansehen (der eigentlich aus Österreich kam), um die entsetzlichen Ereignisse der Vierzigerjahre zu erklären. Andere, zumeist aus einer anderen Generation, betrachten die äußeren Einflüsse genauer, sprechen von den Auswirkungen des verlorenen Ersten Weltkriegs, von der Weltwirtschaftskrise, die Deutschland besonders hart traf. Und sie sprechen von der Ungerechtigkeit des Versailler Friedensvertrags, der eine einst stolze Nation demütigte und ausplünderte.
Będzin und seine Umgebung.
Ich hatte keine Ahnung, was „Großdeutschland“ sein sollte, ich verstand auch nicht, was Hitlers Idee vom „Lebensraum“ für sein Volk bedeutete. Er war ein Vertreter einer Geopolitik, die darauf hinauslief, dass alle Regionen, in denen Deutsche lebten, auch Teil des Deutschen Reiches sein sollten. Und jetzt muss man sich nur eine Karte meines Landes ansehen, wie es sich darstellte, als ich dreizehn Jahre alt war. Der Versailler Vertrag von 1919 hatte den Polnischen Korridor geschaffen, einen Streifen, der zum Danziger Freihafen an der Ostsee führte und unser einziger Zugang zum Seehandel war. Hitler hatte zu Oberst Józef Beck, dem polnischen Außenminister, gesagt, Danzig sei deutsch, werde immer deutsch bleiben und früher oder später Teil des Deutschen Reichs sein. Östlich von Danzig lag Ostpreußen, Teil des Deutschen Reichs seit 1871. Hitler erklärte, es sei ein Unrecht, dass Ostpreußen durch eine fremde Macht vom Mutterland abgetrennt sei. Die Lösung des Problems? Ganz einfach: den Korridor schließen und Ostpreußen ins Reich integrieren. Würden die Polen dem widersprechen? Natürlich. Also musste man ihr Land besetzen. Und fertig.
All das wusste ich nicht, und ich hatte auch keine Ahnung von dem Hass, den Hitler gegen das jüdische Volk hegte. Ich wusste nur, dass an diesem Sonntag und Montag die Flüchtlinge durch unsere Stadt zogen, mit Wagen, Hunden, Kindern – das reinste Chaos.
Und natürlich fiel die Schule aus. Ob ich jubelte und herumhüpfte? Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich darüber nachgedacht hätte, wäre ich wohl zu dem Schluss gekommen, dass die erste Konstante in meinem Leben bereits weggebrochen war. Die Schule ist eine Säule, eine sichere Institution der Kindheit, mindestens so übermächtig wie Familie und Glaube. Sie ist nicht nur ein Ort, an dem wir uns Wissen aneignen, sie ist ein Ort, an dem wir den Umgang mit der Außenwelt lernen. Die Schule des Herrn Rapaport machte nicht wieder auf, solange ich in Będzin blieb. So endete meine Schulausbildung abrupt.
Am Montag, dem 4. September, waren sie da. Das verrückteste, aber hartnäckigste Gerücht hatte gelautet, die Briten und Franzosen würden ihre Armeen schicken, um uns zu retten. Niemand, schon gar nicht ein Kind von dreizehn Jahren, fragte nach, ob das denn möglich sei. Wie sollten sie hierherkommen, und dann auch noch so schnell? Tatsächlich hatte in Großbritannien Neville Chamberlain seine berühmte Verlautbarung am Sonntagvormittag um elf Uhr an sein Volk herausgegeben. Erst um fünf Uhr am Nachmittag folgten die Franzosen. Es würde nie britische oder französische Truppen in Polen geben, aber das konnten wir damals nicht wissen.
Nördlich von uns war die Lodzer Armee mehrmals geschlagen worden. Reichenau hatte die Warthe erreicht, List marschierte auf Krakau zu. Bis Montag war er 80 Kilometer weit vorgedrungen. Aber in diesen Septembertagen waren Gerüchte, nicht Fakten die gängige Währung in Będzin. Die Briten und Franzosen waren auf dem Weg zu uns, hieß es. Wir waren begeistert. Die Leute lachten und plapperten vor sich hin. Frauen und Mädchen sammelten in diesem heißen, trockenen Sommer Blumen, um sie unseren Rettern zuzuwerfen und die mutigen Männer zu begrüßen. Wir warteten an der Hauptstraße, zitternd vor Aufregung, und lauschten kurz nach Mittag auf das Grollen schwerer Fahrzeuge, die sich von Westen her näherten. Jubel wurde laut, die Leute weiter unten an der Straße mussten sie schon sehen können, die rot-weiß-blauen Flaggen.
Das Erste, was ich sah, waren dunkle Motorräder mit Beiwagen. Die Fahrer trugen tief heruntergezogene Stahlhelme und graugrüne Uniformen, die Waffen hatten sie um die Schulter gehängt. Sie waren schmutzig nach all den Stunden auf der Straße, der Staub des Sommers lag wie eine dichte Schicht auf ihren Handschuhen und Schutzbrillen. Sie bewegten sich langsam und schauten sich wachsam um. Harte Männer mit harten Gesichtern. Hinter ihnen folgten grau lackierte Lastwagen mit krachenden Getrieben und ratternden Ladeflächen. Alle diese Wagen waren bis an den Rand mit Soldaten besetzt, die bis an die Zähne bewaffnet waren und uns grimmig ansahen. Zwischen den Lastwagen fuhren Geschützwagen mit Maschinengewehren und Kanonen. Das Gesicht des totalen Krieges.
Die Stimmung änderte sich. Die Blumen ließen ihre Köpfe hängen, der Jubel verstummte. Auch die Gespräche hörten auf, das Lächeln gefror auf furchtsamen Gesichtern. Ich stand bei ein paar jüdischen Flüchtlingen aus Düsseldorf, die zwei Jahre zuvor in unser Haus eingezogen waren. Sie waren vor der Verfolgung durch die Nazis geflohen, als Hitlers rassistisches Netz sich immer dichter um die Menschen zog. Ich erinnere mich nicht an die Namen, aber die Mutter sprach schließlich aus, was wir alle dachten: „Das sind keine Franzosen oder Briten. Das sind deutsche Soldaten.“
Ihre Worte waren wie ein Startsignal für die Menge. Die Leute verteilten sich, nahmen die Blumen mit oder warfen sie verächtlich auf die Straße. Die meisten wollten einfach nur schnell nach Hause. Nach Hause, die Türen verriegeln, die Fenster zuhängen. Und überlegen, was zu tun war. Ich ging nicht nach Hause. Die Wehrmacht faszinierte mich ebenso wie die Bomber zwei Tage zuvor. Ich verstand es damals nicht und kann es bis heute nicht richtig erklären. In der riesigen Menge von Soldaten, die in unsere Stadt einzogen, befand sich ein offener Lastwagen. Die Fahrer waren Deutsche, aber auf der Ladefläche waren Männer in polnischen Uniformen. Sie lachten und machten Witze, als wäre es ganz normal und natürlich, in einem Fahrzeug des Feindes mitzufahren. Ich hätte sie mir genauer ansehen sollen, um festzustellen, ob sie Waffen trugen. Wenn nicht, waren es vielleicht Kriegsgefangene. Wenn ja, warum waren sie dann so guter Stimmung? Wenn es Deutsche waren, weshalb trugen sie polnische Uniformen? Tagelang wurde darüber geredet, aber wir fanden keine Antwort. Vermutlich handelte es sich um sogenannte Volksdeutsche, also Polen deutscher Abstammung, die die Invasoren mit offenen Armen begrüßten. Einer von ihnen war ein kleiner, dicker Mann, den ich kannte, der Kapellmeister unseres Ortsregiments. Er trug die Schulterklappen eines Hauptmanns und hatte in unserer Schule gelegentlich Musikunterricht gegeben. Er nahm nie an Kämpfen teil und verließ Będzin auch nicht, soweit ich mich erinnere. Aber ich weiß bis heute nicht, was eigentlich mit ihm geschah, und so geht es mir mit vielen Begebenheiten aus den nächsten sechs Jahren.
Als ich irgendwann doch nach Hause kam, herrschte dort eine Art Belagerungszustand. Wir waren jetzt in der gleichen misslichen Lage wie die Flüchtlinge, die wir in der Stadt gesehen hatten. Jetzt war unser Zuhause von den Deutschen umzingelt. Aber wenn wir wegliefen, selbst wenn wir all unsere Habe auf einen Wagen packten – Vaters Nähmaschine, Nathans tolles Fahrrad, meine Schlittschuhe, all unseren Besitz –, wohin sollten wir uns wenden? An diesem Montagabend blieben wir im Haus, wagten uns höchstens einmal auf den Hof, aber nicht auf die Straße. Überall fuhren Lastwagen durch die Dunkelheit, Megafon-Stimmen bellten verzerrte Befehle, immer wieder kam die Aufforderung, dass alle in ihren Häusern bleiben sollten – sonst würde geschossen. Wir taten, wie man uns befahl, hörten das Grollen der Lastwagen und gelegentlich auch Gewehr- oder Pistolenschüsse.
Ich kann nach so langer Zeit und allem, was noch geschah, gar nicht mehr in Worte fassen, wie ich mich fühlte. Natürlich hatte ich Angst, wer hätte keine gehabt? Ich war wie alle in meiner Umgebung als treuer Pole erzogen worden, wir hatten in der Schule jeden Morgen für den Präsidenten gebetet, ebenso wie mein Großvater wohl für den russischen Zaren gebetet hatte. Damals war mir nicht klar, dass die polnische Regierung nicht viel für die Juden übrig hatte. Zwei Jahre vor dem Einmarsch der Deutschen hatte es in einigen polnischen Städten antisemitische Ausschreitungen gegeben, die fast schon an Pogrome grenzten. Die Erwachsenen hatten wohl Déja-vu-Erlebnisse. Immer wieder waren Juden Opfer von Verfolgung gewesen. Wir waren aus unzähligen europäischen Ländern ausgewiesen worden, mussten weiterziehen, uns eine neue Heimat suchen. „Ihr habt kein Recht, unter uns zu leben.“
Wenn ich bisher so etwas wie Antisemitismus wahrgenommen hatte, dann höchstens in den Tagen nach Ostern. Ansonsten spielte ich das ganze Jahr mit Nicht-Juden wie mit Juden, darunter Jurek und die Gutsek-Brüder. Aber um Ostern herum gab es immer Schlägereien, weil uns dann die Christen beschuldigten, wir hätten Jesus Christus ermordet. Andererseits gab es auch sonst gelegentlich Schlägereien: wegen eines Fouls beim Fußball, einer gehässigen Bemerkung … Wenn der Krieg nicht gekommen wäre, hätten wir uns vermutlich in den nächsten Jahren irgendwann um die Mädchen geprügelt. Am nächsten Tag war alles vorbei und vergessen. Man trug die Platzwunden und Blutergüsse mit Stolz und vergaß das Ganze. Die einzigen Schwierigkeiten, die ich mitbekam – Nathan erzählte manchmal davon –, gab es, wenn die Nicht-Juden ein Fußballspiel verloren. Die Streitereien wurden allerdings immer von Auswärtigen vom Zaun gebrochen. Bis zu diesem September hatte es in Będzin nie ein Pogrom gegeben.
Würde es so bleiben? Und wenn nicht, konnten wir Juden einfach weiterziehen, wie wir es immer getan hatten, und eine neue Zuflucht finden? Wo würden wir schließlich einen neuen Garten Eden finden?
An die nächsten Tage erinnere ich mich nur noch wie durch einen Nebelschleier. Im übrigen Polen, so erfuhr ich später, wurde die Armee noch weiter zurückgedrängt, sodass wir isoliert und ohne Verteidigung waren. Am 6. September nahm Lists 14. Armee Krakau ein, die polnische Regierung verließ Warschau. Die polnische Armee war erschöpft, hoffnungslos in der Unterzahl und fast überall besiegt. Sie wurde auf eine Linie entlang den Flüssen Weichsel, Narew und San zurückbeordert. Einen Tag später musste sie sich sogar bis zum Fluss Bug zurückziehen.
Inzwischen galt unsere erste Sorge den Lebensmitteln. Es gab wohl irgendwie die Möglichkeit, Lebensmittel einzukaufen, aber die Ausgangssperre war nach wie vor in Kraft, und ab einer bestimmten Uhrzeit bewegten sich nur Deutsche auf den Straßen. Von neunzehn Uhr bis acht Uhr am nächsten Morgen mussten wir im Haus bleiben. In Będzin hatte es keine Kämpfe gegeben, es gab keine Ruinen und keine Mauerreste wie in so vielen anderen europäischen Städten in diesen Monaten. Aber überall waren Soldaten, die meisten in den graugrünen Wehrmachtsuniformen. Einige trugen Ketten um den Hals, das Zeichen der Militärpolizei. An Samstag nach dem Einmarsch – immer noch sprach niemand davon, zur Synagoge zu gehen – veränderten sich die Uniformen. Jetzt sah man häufiger die blaugrünen Jacken der Zivilpolizei, und bald kamen auch Männer in hellbraunen Jacken mit rot-schwarz-weißen Armbinden mit dem Hakenkreuz dazu: Parteibürokraten der Nazis, die ins Rathaus und andere offizielle Gebäude einzogen und ihre Aktenschränke, Schreibmaschinen und Papiere mitbrachten. Eine der vielen Eigenheiten, die ich in den folgenden Jahren über die Nazis erfahren sollte, war ihre Detailversessenheit. Alles wurde mit dreifachem Durchschlag geschrieben, weitergeleitet und abgeheftet. Sie waren stolz auf ihre Leistungen. Aber was mich am meisten alarmierte, war die Tatsache, dass auch die Stadtpolizei von Będzin wieder zu sehen war. Entweder waren viele Volksdeutsche unter den Beamten, oder sie machten mit, um zu überleben.
Fast unmittelbar nach den ersten Tagen begannen auch die Razzien. Männer wurden von den Soldaten „eingesammelt“, vor allem die orthodoxen Juden mit ihrer schwarzen Kleidung, den Schläfenlocken und langen Bärten. Sie wurden auf Plätzen und an Straßenecken zusammengetrieben und aus der Stadt gebracht, hinaus zu den Fabriken, die bei den Luftangriffen der vergangenen Woche zerbombt worden waren. Dort bekamen sie den Befehl, Blindgänger zu suchen, die noch einmal eingesetzt werden konnten. Die Männer waren für diese gefährliche Arbeit nicht ausgebildet und hatten auch keine Schutzausrüstung. Im Grunde waren sie nur menschliche Minensuchgeräte – sie waren ja entbehrlich. Wenn ein Blindgänger hochging und ein paar Juden in Stücke zerrissen oder schwer verletzt wurden, kein Problem.
Sehr genau erinnere ich mich an Freitag, den 8. September. An diesem Tag kamen die Einsatztruppen, wie man sie nannte. Wir kannten den Namen nicht und hatten auch keine Vorstellung, mit welchem Auftrag sie kamen. Die meisten sahen aus wie Polizisten in einer Art Kampfanzug. Andere trugen Wehrmachtsuniformen, allerdings mit schwarzen Schulterklappen und Blitzen an den Kragenspiegeln. Auf dem Ärmel trugen sie einen Adler. Sie kamen mit der üblichen bunten Mischung aus Motorrädern, Lastwagen und Geländewagen. Es handelte sich um Exekutionskommandos, vom Oberkommando der Nazis dazu ausgesucht, mein Volk systematisch anzugreifen. Heute weiß ich, dass die Einheit, mit der wir es zu tun bekamen, von SS-Obergruppenführer Udo von Woyrsch befehligt wurde, einem schlesischen Adligen, der schon seit Jahren Mitglied der NSDAP war. Seine Einsatzgruppe umfasste etwa zweitausend Männer in einer besonderen Zusammensetzung, die typisch für diese Einheiten war. Sie waren alle Mitglieder des Sicherheitsdienstes, bestehend aus verschiedenen Polizeiabteilungen wie Gestapo, Kripo und Ordo. Unter dem Oberbefehl von Heinrich Himmler, dem Reichsführer der SS, verbreiteten sie Angst und Schrecken in der Gegend um Kattowitz. Ihr Einsatz war der Beginn dessen, was die Welt später als den Holocaust kennenlernen sollte.
An diesem Nachmittag blieb ich im Haus, weil man sonst nirgendwo in Sicherheit war. Von Zeit zu Zeit hörten wir Schüsse in den Straßen der Stadt. Und dann, am Spätnachmittag, kam der Brandgeruch. Er unterschied sich von dem der brennenden Fabriken in der Woche zuvor. Ich wollte herausfinden, was da los war, aber meine Eltern ließen mich natürlich nicht gehen. Die Tage, an denen ich in vollkommener Sicherheit einen Ball durch die Straßen kicken konnte, waren vorbei. Meine Mutter hielt ihre Kinder bei sich. Als es dämmerte, schlich ich mich trotzdem aus der Wohnung und kletterte auf das Dach eines Schuppens, der sich an eine hohe Mauer lehnte. Der Himmel glühte rot, der schwarze Rauch stieg in den lilafarbenen Abend. Die große Synagoge brannte, das Symbol meines Volkes stand in Flammen. Die Balken krachten schon und brachen in sich zusammen. Und das am Sabbat, dem Tag des Herrn.
Ich weiß nicht, wie lange ich dort blieb, auf Zehenspitzen stehend und wie gebannt von dem Anblick. Keine Feuerwehr eilte herbei, das Feuer breitete sich auf die Häuser rund um die Synagoge aus, lauter jüdische Geschäfte, jüdische Wohnhäuser. Erst als Hendla nach mir rief, riss ich mich los. Die Pivniks waren an diesem Wochenende alle zu Hause und drängten sich zusammen, während die Welt um sie herum in Stücke brach.
Am Montagmorgen fassten wir Mut hinauszugehen. Wir hatten wohl auch nicht mehr viel zu essen im Haus, also musste es sein. Der Anblick, der sich uns bot, war unvorstellbar. Das ganze Wochenende über hatten die Einsatztruppen ihren Auftrag ausgeführt, und die Ergebnisse waren überall zu sehen. Leichen lagen in den Straßen, verkrampft im Todeskampf, ihr Blut als bräunliches Rinnsal am Straßenrand. Ich hatte noch nie einen Toten gesehen, und dies waren ja Menschen, die ich kannte: Nachbarn und Freunde unserer Familie, die noch vor ein paar Tagen ihrer Arbeit nachgegangen waren, ohne sich – glaube ich jedenfalls – irgendwelche Sorgen zu machen. Die meisten waren ältere Juden, die man leicht an ihrer frommen traditionellen Kleidung und ihren Hüten erkennen konnte – leichte Opfer für die Gewehrkolben und -kugeln der Einsatztruppen. Es wäre ein tröstlicher Gedanke, wenn man sich einbilden könnte, dass diese Männer einen schnellen Tod starben, aber so ist es wohl nicht gewesen. Man hat sie gequält, gedemütigt und geschlagen, zu Boden getreten und erschossen, als sie schon auf dem Boden lagen. Die Verletzungen in ihren blauschwarzen Gesichtern legten deutlich Zeugnis davon ab. Und es waren nicht nur Alte und Orthodoxe, die dort lagen. Es waren auch jüngere Leute beiderlei Geschlechts, sogar Kinder in meinem Alter, die an diesem Wochenende willkürlich von den Nazis erschossen worden waren. Wir hatten die Schüsse ja gehört.
Der schlimmste Anblick jedoch waren die Juden, die auf dem Hauptplatz von den Bäumen hingen. Männer in schwarzen Mänteln, die aussahen wie entsetzliche Parodien von Weihnachtsschmuck. Ich erinnere mich noch an den Anblick der baumelnden Hände und Füße, die Körper dem Wetter ausgesetzt. Ich habe sie nicht gezählt, und niemand von uns schaute zu genau hin. Wir wollten die Einsatztruppen ja nicht reizen. Gott weiß, wie viele Menschen an jenem Wochenende in Będzin starben. Und es waren nicht nur Juden.
Zum Teil fanden wohl einfach willkürliche Erschießungen statt. Jemand suchte zwischen den Häusern Deckung, jemand schaute nach seiner Familie. Nach Freunden. Andere Morde waren offenbar geplant. In Będzin wie in jeder anderen polnischen Stadt lebten Intellektuelle, es gab nationalistische Gruppierungen, rechte und linke. Lauter Menschen, die vor dem September 1939 eine klare Meinung dazu gehabt hatten, in welche Richtung sich die polnische Politik bewegen sollte. Wir wissen heute, warum man es auf diese Leute abgesehen hatte. Sie waren potenzielle Unruhestifter, und irgendjemand in der Stadt muss mit dem Finger auf sie gezeigt haben, sonst hätten die Einsatztruppen ja nicht gewusst, an welche Türen sie klopfen mussten. Die Leute wurden aus ihren Häusern gezerrt, in langen Reihen an den Stadtrand geführt und erschossen. So lauteten jedenfalls die Gerüchte, und nach dem, was ich am Montag in den Straßen rund um die Modrzejowska sah, zweifelte ich nicht daran.
Innerhalb von sieben Tagen war die Welt, die wir kannten, verstanden und liebten, verschwunden. Ich sah die Verwirrung in den Augen meines Vaters. Wenn es in der Vergangenheit Schwierigkeiten gegeben hatte, war er immer in die Synagoge gegangen, zum Rabbi, um mit den anderen Ältesten zu sprechen und Gott um seine Führung zu bitten. Jetzt war die Synagoge nur noch eine schwelende Ruine, und viele der Ältesten lagen tot in den Straßen.
Die Historiker streiten sich bis heute darüber, wie viele Menschen an diesem Wochenende starben. Abgesehen von denen, die in ihren Häusern verbrannten, schätzt man die Zahl auf etwa hundert Männer, Frauen und Kinder, davon vielleicht achtzig Juden. Mir schienen es damals viel mehr zu sein. Aber war nicht jeder einzelne Mensch schon einer zu viel?
Die Pivniks hielten stoisch zusammen. Viel schlimmer konnte es ja wohl nicht mehr kommen, dachten wir.