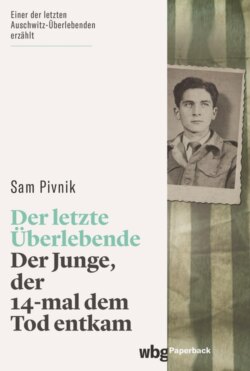Читать книгу Der letzte Überlebende - Sam Pivnik - Страница 11
3
Besatzung
ОглавлениеUnsere Schule war geschlossen, die Synagoge bis auf die Grundmauern heruntergebrannt. Mein Vater war kein kleiner Geschäftsmann mehr, der stolz auf seine Fähigkeiten als Schneider und seinen Status in der Gemeinde sein konnte. Er war arbeitslos wie alle anderen und gab ein potenzielles Ziel für die uniformierten Schurken ab, die durch unsere Straßen zogen.
Wir alle mussten uns an eine neue Lebensweise anpassen, irgendwie damit zurechtkommen. Wir konnten ja nicht wissen, dass unser altes Leben auf immer verloren war. Gerüchte aus dem Osten erreichten uns, und die Geschichtsbücher bestätigen es heute: Am 17. September marschierte die Rote Armee in Polen ein. Wir hatten nur achtzehn Bataillone am Fluss Bug stehen, unsere gesamten Streitkräfte befanden sich im Westen und versuchten verzweifelt, die Wehrmacht aufzuhalten. Polen war wie eine Nuss zwischen den Kiefern eines Nussknackers eingeklemmt. Am nächsten Tag wurden der Präsident und der Oberbefehlshaber unserer Streitkräfte in Haft genommen. Beide forderten die Truppen zur Fortsetzung des Kampfes auf.
Die 23. Leichte Artillerie war längst verschwunden; wir sahen sie nie wieder. Wir Juden wussten, wie man sich bei kleinen Scharmützeln wegen eines Fußballspiels oder um Ostern herum wehrte, aber diese Situation war ganz anders. Wir waren Zivilisten, und so schwer es uns immer gefallen war, uns daran zu halten, hatte unser Rabbi uns doch stets gelehrt, die andere Wange hinzuhalten. Adolf Hitler und Josef Stalin jedoch hatten die Lehren des Rabbis außer Kraft gesetzt. Sie hatten Millionen von Menschen zum Tode verurteilt.
Offiziell – auch wenn wir den Namen nie benutzten – wurde Będzin zu Bendsburg im deutschen Gau Oberschlesien. Unsere christlichen Nachbarn in der Stadt standen vor einer schwierigen Entscheidung. Diejenigen mit deutschen Vorfahren konnten ihre Anerkennung als Volksdeutsche beantragen. Das bedeutete, sie waren mindestens schon mal zur Hälfte arisch. Alle anderen wurden vertrieben und bekamen den Befehl, ihr Hab und Gut auf dem Rücken oder auf Karren und Wagen mitzunehmen und sich in dem Gebiet anzusiedeln, das die Deutschen als Generalgouvernement bezeichneten. Hans Frank, Hitlers Anwalt, wurde zum Verantwortlichen für dieses Gebiet ernannt. Er erklärte im Radio, Polen würde wie eine Kolonie behandelt und die Polen würden zu Sklaven des Großdeutschen Reiches. Zu dieser Zeit besaßen die Menschen in Będzin immerhin noch Radios. Sein Hauptquartier befand sich in Krakau, aber seine Fangarme erreichten uns alle. Juden konnten natürlich keine deutschen Staatsbürger werden, sondern unterlagen jetzt den Nürnberger Rassegesetzen, die schon seit vier Jahren auf die deutschen Juden angewandt wurden.
Juden durften keine freien Berufe mehr ausüben. Rapaport und andere jüdische Lehrer verloren ihre Stellen. Wir konnten nicht in die Armee eintreten, selbst wenn wir es gewollt hätten – allerdings stand unsere Armee irgendwo am Bug ohnehin kurz vor dem Zusammenbruch, und niemand kam ja auf die Idee, sich der Wehrmacht anzuschließen. Universitäten konnte man vergessen. Kluge Jungen in meiner Schule bekamen keine Ausbildung mehr – genau wie ich. Von diesem September an und noch lange Zeit litt Polen unter dem Verlust einer ganzen Generation von Intellektuellen.
Zusammen mit zahllosen weiteren Kleingewerbetreibenden wurde mein Vater zum Lohnsklaven – und die Löhne waren erbärmlich. Deutsche Zivilisten kauften die jüdischen Geschäfte zu lächerlichen Preisen. Sie brachten ihre eigenen arischen Angestellten mit, und wenn sie überhaupt jüdische Angestellte weiter beschäftigten, dann mit einem niedrigeren Status als zuvor. Es gab keine Gratifikationen mehr und die Löhne waren sehr niedrig. Ich erinnere mich, dass ich wohl im Oktober in der Werkstatt meines Vaters stand und allmählich begriff, was vor sich ging. Uniformierte Beamte waren in unseren Hof marschiert, wo Nathan und ich ein bisschen Fußball spielten. Sie hatten meinem Vater die Scheren, das Garn, die Nähmaschine und die Stoffballen abgenommen. Und natürlich gab es keine Aufträge mehr. Die meisten polnischen Beamten waren fort, und obwohl ich nie genau darüber nachgedacht habe, muss es wohl so gewesen sein, dass auch einige von Onkel Moyshes Armeekunden im nahe gelegenen Szopienice tot waren.
Es dauerte noch ein halbes Jahr, bis Alfred Rossner nach Będzin kam. Bis dahin ging es uns einigermaßen gut. Rossner sah seltsam aus; ihm fehlten einige Zähne, und er hatte einen Hüftschaden. Was wir nicht wussten, war, dass er Bluter war und Glück gehabt hatte, überhaupt noch am Leben zu sein. Er wurde zum sogenannten Treuhänder ernannt und betrieb zwei Kleiderfabriken im Auftrag der SS. Einer seiner leitenden Angestellten war Arje Ferleizer, ein Jude, der einmal Rossners Chef gewesen war und 1938 aus Deutschland geflohen war, um der Verfolgung zu entgehen. Ironie des Schicksals, dass sie sich in Będzin wieder trafen.
Hendla und mein Vater arbeiteten für Rossner, genau wie fast zehntausend Juden, die er bis 1943 beschäftigte. Damals wussten wir gar nicht zu schätzen, was für ein gefährliches Spiel Rossner in unserem Interesse spielte. Anders als der berühmtere Oskar Schindler war Rossner kein unabhängiger Geschäftsmann, sondern Angestellter der SS, und entsprechend beschränkt waren seine Möglichkeiten, Juden zu helfen. Immerhin wurden mein Vater und Hendla als Facharbeiter eingestellt und als „kriegswichtig“ eingestuft. Sie bekamen Sonderausweise, spezielle blaue Kennkarten, die sie zumindest theoretisch vor der Willkür der SS schützten. Wir wussten damals nichts davon, aber dank dieser Pässe konnten wir zumindest für kurze Zeit als Familie zusammenbleiben. Alfred Rossner, der Nazibeamte schmierte, hohe SS-Leute mit ganz besonderen Uniformen versorgte und ihre Frauen in die neueste Mode der Vierzigerjahre kleidete, hielt mit all seinem Tun auch die Pivniks am Leben.
Für mich war es nicht so leicht, Arbeit zu finden. Vater war Schneidermeister, und Hendla mit ihren achtzehn Jahren war eine geschickte Näherin, aber ich war letztlich ein kleiner Junge ohne Ausbildung. Das bisschen Nähen, was ich hinbekam, war nichts im Vergleich zu Rossners Leuten. Aber dann hatte ich doch Glück. Ich hatte Pferde immer schon gern gehabt, und ein Tier, das ich immer wieder streichelte und tätschelte, gehörte einem jüdischen Lieferanten namens Dombek. Jetzt pflegte und fütterte ich also dieses Pferd und half Dombek beim Möbeltransport, machte Botengänge für ihn, half beim Heben und Schleppen. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich dafür bekam – wahrscheinlich nur ein Taschengeld aber es war mein erster Lohn, und ich war stolz, etwas zum Haushaltseinkommen beizutragen.
Das alles änderte sich allerdings Anfang der Vierzigerjahre. Inzwischen hatte ich Arbeit in einer Möbelfabrik gefunden, die einem Mann namens Killov gehörte und von Herrn Häuber verwaltet wurde. Beide Männer gehörten zu den freundlicheren Deutschen, aber nicht annähernd so wie Rossner. In der Fabrik wurden Möbel und hölzerne Transportkisten hergestellt, und die Arbeiter waren nach Juden und Nicht-Juden aufgeteilt. Ich war mit der Fertigung schwerer Kisten aus Buchenholz beschäftigt. Sie wurden für den Transport der 500-Kilo-Bomben benutzt, die die Dornier- und Heinkel-Flugzeuge über Europas Städten abwarfen. Ende 1940 hatten wir keine Ahnung, was im Rest der Welt vor sich ging. Inzwischen hatte man uns die Radios abgenommen, und so weit es uns betraf, war Post ein Ding der Vergangenheit. Mein Vater bat mich zu erwähnen, dass ich noch einen älteren Bruder hatte, der ebenfalls Arbeit suchte. Da Dombek jetzt niemanden mehr hatte, der ihm mit den Pferden half, arbeitete Nathan für ihn.
Wenn das überhaupt möglich war, dann liebte Nathan Dombeks Pferde noch mehr als ich. Er kümmerte sich um zwei der Tiere, bis irgendwann ein Wagen an der Steigung zum Bahnhof wegrutschte und ihm über den Fuß fuhr. Außerdem hob er sich wenig später einen Bruch, und damit war es ihm nicht mehr möglich, für Dombek zu arbeiten.
Meine Zeit in der Fabrik war surreal. Es fühlte sich an, als wären wir alle Teile einer Maschine. Wir Juden bekamen natürlich weniger Lohn als die Nicht-Juden, und mit ihrer typischen teutonischen Besessenheit zogen die Deutschen uns auch noch Steuern und Sozialabgaben von unserem Wochenlohn ab. Diese Abzüge stiegen noch, als „Beiträge“ zur sogenannten Winterhilfe eingezogen wurden, eine Sondersteuer, mit der warme Kleidung für die Truppen an der bitterkalten Ostfront finanziert wurde.
Ein wichtiger Faktor meiner Arbeit in der Killov-Fabrik war das Essen – eine Konstante, die immer wichtiger wurde, während sich alles andere um uns herum auflöste. Mittags gab es Suppe oder Eintopf und vor allem eine Dreiviertelstunde Pause. Da ich noch jung war, möglicherweise sogar der jüngste Arbeiter dort, war ich Herrn Häuber aufgefallen, und er entwickelte ein väterliches Interesse an mir. Er ließ mich Besorgungen erledigen, und am Anfang, bevor die Bestimmungen aus Berlin strenger wurden, durfte ich sogar seine kleine Tochter morgens zur Schule bringen. Nathan ging es ähnlich. Die Tochter ging auf die Fürstenbergschule für Nicht-Juden, die auch nach dem Einmarsch der Deutschen noch in Betrieb war. Wenn ich zu Herrn Häuber nach Hause kam – manchmal fuhr ich ihn in der Mittagspause mit seiner zweispännigen Kutsche dorthin –, schenkte mir Frau Häuber etwas Essen für meine Familie. Ich würde jetzt gern behaupten, dass es sich um Marmelade, einen Laib Brot, Wurst, Tee, Zucker oder Butter handelte … aber all das hatte es nur im Garten Eden gegeben, und der gehörte der Vergangenheit an. Trotzdem waren auch Gemüse und Kartoffeln in unserer Situation sehr willkommen. Chana war erst sieben, und Wolf und Josek sogar noch kleiner. Selbst Majer war erst elf Jahre alt, und in einer Stadt, in der Arbeit rar war, konnte er noch nichts dazuverdienen.
Die Fabrik hatte allerdings auch ihre Schattenseiten. Killov und Häuber waren freundlich, aber ihre Untergebenen waren es leider nicht. Der Beamte, der uns jeden Tag hinein- und wieder hinausließ, war ein überzeugter Nazi und verachtete uns zutiefst. Er war ein Widerling mit nur einem Arm, der immer einen antisemitischen Spruch auf den Lippen hatte. Und oft genug zog er uns auch am Ohr, wenn er in der entsprechenden Stimmung war. Niemand beklagte sich, niemand unternahm etwas dagegen, nicht zuletzt, weil die meisten Polen die Anerkennung als Volksdeutsche beantragt hatten. Das war vielleicht am schwersten zu ertragen: Freunde und Nachbarn starrten uns mit kaum verhohlenem Hass an und waren froh, wenn sie nicht mit uns in derselben Werkstatt arbeiten mussten. Als Himmlers üble Rassenpolitik durch Waffen, Hunde und volles Kriegsrecht verschärft wurde, wechselten entsetzlich viele Leute blitzschnell die Seiten.
Außerhalb der Fabrik wurde das Leben täglich schwerer. Läden und Firmen eröffneten in den Wochen nach dem Einmarsch bald wieder, aber jetzt wurden sie natürlich von Deutschen oder zumindest von polnischen Volksdeutschen geleitet, und Juden durften sie gar nicht mehr betreten. Wir waren also auf bestimmte Stadtviertel beschränkt und konnten nur noch in wenigen Läden einkaufen. Dort bildeten sich die unvermeidlichen Schlangen, wie sie zum Symbol des Kriegsalltags in ganz Europa werden sollten. Vor allem Frauen und Kinder standen stundenlang im strömenden Regen oder scharfen Wind, um wenigstens ein bisschen Brot zu ergattern. Gerade deshalb war die Killov-Suppe so lebenswichtig: So bekamen Nathan und ich wenigstens einmal am Tag eine anständige Mahlzeit. Ich wusste, unsere Eltern mussten auf so etwas verzichten, damit wenigstens die Kleinen genug zu essen hatten.
Das Schlangestehen war nicht nur eine Unannehmlichkeit, die aus der kriegsbedingten Lebensmittelrationierung resultierte. Zu dieser Zeit trugen wir noch keine gelben Armbinden, dieses Stigma kam erst später. Und nicht orthodoxe Juden sahen im Prinzip nicht anders aus als alle anderen. Jetzt aber rannten die polnischen Kinder – darunter auch einige ehemalige Freunde von mir – an den Schlangen vorbei, riefen: „Jude! Jude!“, und zeigten mit dem Finger auf uns. Dafür bekamen sie Extraportionen Butter und Marmelade, wie die Silberlinge für den Verräter im christlichen Neuen Testament. Die Polizei, die inzwischen komplett in deutscher Hand war, holte die Juden aus der Schlange, schlug sie und ließ sie oft blutend im Schnee liegen.
Zu Beginn der Besatzungszeit gab es so eine Art Scherz in Będzin: Entweder arbeitete man für Killov oder für Rossner oder man war Mitglied des Judenrats. Etwas anderes gab es nicht. Wie alle anderen Institutionen des NS-Staates waren die Judenräte Marionettenorganisationen. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, die Ordnung in der jüdischen Gemeinde zu sichern, Unruhestifter zu melden und dafür zu sorgen, dass wir alle identifiziert und registriert wurden. Mein Vater war kein Mitglied des Judenrats, aber einige seiner Freunde arbeiteten dort mit, und das Büro befand sich gleich neben unserem Haus in der Modrzejowska-Straße, nur ein Stückchen näher beim Marktplatz. An der Tür gab es eine Anschlagtafel mit wichtigen Mitteilungen in jiddischer Sprache, durchweg Übersetzungen von Nazibefehlen, damit jeder Bescheid wusste. Es waren zwar Deutsche, die meinem Vater die Nähmaschine wegnahmen, aber der Judenrat hatte ihnen gesagt, wo sie suchen mussten. Die jüdische Gemeinde in Będzin wurde systematisch geplündert, und die führenden Köpfe dieser Gemeinde machten dabei mit.
Ratsvorsitzender in Ostschlesien war Meniok Meryn, der als Vermittler zwischen dem deutschen Gauleiter und Molczacki fungierte, dem Vorsitzenden des Judenrats in Będzin. Einige Leute hielten Meryn für einen Glücksritter und Kollaborateur, andere glaubten, er würde die Verfolgungen durch die Nazis zumindest hemmen. Molczacki, so lauteten die Gerüchte, durchforstete die Papierkörbe seiner Angestellten, um etwas gegen sie in der Hand zu haben. Ich war noch ein Kind, wie konnte ich wissen, was davon stimmte?
Richtig schlimm wurde es dann im Februar 1940. In diesem Monat kämpften die Russen im frostigen Norden gegen die Finnen, mit Skiern und weißen Tarnanzügen. Natürlich wussten wir nichts davon. Będzin war einer der wenigen Orte in Polen, wo die Nazis noch kein echtes Ghetto eingerichtet hatten, uns ging es also vergleichsweise gut. Trotzdem herrschte eine Art Belagerungszustand in der Stadt. Niemand durfte ohne Erlaubnis der SS die Stadt verlassen oder betreten, und für uns galten noch strengere Bestimmungen. Ich ging zu Fuß zur Fabrik und wieder nach Hause. Von Zeit zu Zeit ging ich zusammen mit Nathan und meiner Großmutter zu den Abraumhalden am Stadtrand, um nach Kohlen zu suchen. Überall waren Polizisten und Wachleute, man hatte den Eindruck, sie suchten nur nach einem Vorwand, um auf uns zu schießen.
In diesem Februar befahlen die Nazis dem Judenrat, er solle mehr als 15 Kilogramm Gold und 60 Kilogramm Silber abliefern, für die die jüdische Gemeinde zu sorgen hätte. Angeblich als Buße für irgendein Verbrechen, das wir begangen hatten. Auf Nachfrage hätten sie zweifellos wieder behauptet, wir hätten Christus ermordet oder das Blut christlicher Kinder für irgendein Ritual benutzt. Aber das war, bevor sie gar keinen Grund mehr brauchten, um uns zu bestrafen. Die Ratsmitglieder liefen durch die Stadt, klopften an Türen und vernagelte Fenster, drangen in unsere Wohnungen ein – obwohl doch unsere Privatsphäre das Einzige war, was uns noch geblieben war. Ich weiß nicht, ob es ihnen gelang, die geforderte Menge aufzubringen und wie viel noch unter Bodendielen und auf Dachböden versteckt wurde. Schließlich würde irgendwann der Tag kommen, an dem die Deutschen wieder gingen.
Skiausrüstungen mussten abgegeben werden, wenn man welche hatte (die Pivniks hatten so etwas nicht), vermutlich für den Krieg gegen die Finnen. Unsere Radios waren schon größtenteils konfisziert; wer noch eins hatte, verlor es jetzt. Dann verboten sie uns das Betreten bestimmter Straßen und öffentlicher Plätze, sodass ein Ghetto ohne Namen entstand. Nathan wurde zum Opfer dieser Bestimmungen. Er wurde in einer Gegend aufgegriffen, die er nicht betreten durfte, weil er versucht hatte, dort illegal Brot zu besorgen. Und so landete er im städtischen Gefängnis. Ich erinnere mich nicht an die Formalitäten, ob er vor einem Gericht oder vor einem SS-Offizier erscheinen musste. Ich erinnere mich nur an die unerträgliche Anspannung zu Hause, als er weg war. Und an die Hilflosigkeit meines Vaters, der nichts dagegen tun konnte. Nathan blieb sechs Wochen im Gefängnis.
Und doch ging das Leben irgendwie weiter. In der Fabrik war es erträglich, tatsächlich freute ich mich, jeden Tag zur Arbeit gehen zu können. Und gelegentlich konnte ich auch noch ein bisschen Fußball spielen, selbst wenn die Zahl der Mitspieler dahinschwand. Außerdem hatte ich noch meine Tauben, die unbeeindruckt in Herrn Rojeckis Dachboden gurrten. Für sie, so dachte ich immer, gab es keinen Krieg, keine Ohrfeigen, keine engen Grenzen des Erlaubten und Unerlaubten. Hätte ich realistischer gedacht, dann wäre mir sicher eingefallen, dass es nicht mehr viel Futter für sie gab.
Nahrung war insgesamt unser Hauptproblem. Nathan und ich waren im Wachstum, Majer ebenfalls. Wir lebten zu zehnt in dem kleinen Haus Nummer 77, und nur vier von uns verdienten ein wenig Geld. Meine Großmutter war zu alt, meine Mutter hatte alle Händevoll mit den kleineren Kindern zu tun. Josek war ja erst drei Jahre alt. Es gab eine Art Schwarzmarkt, es gab Leute, die „jemanden kannten“, und gelegentlich sah man, wie in dunklen Ecken Geld und Lebensmittelpakete verstohlen den Besitzer wechselten. Einige polnische Freunde hatten wir auch noch.
Damals wussten wir nichts davon, aber die Befehle aus dem Reich, die in Berlin entwickelt wurden, würden Polen in den kommenden Monaten am härtesten treffen. Wenn ein Pole einem Juden half und ihm beispielsweise während der Aktionen – der Deportationen in die Lager – Obdach gewährte, dann wurde dieser Pole mitsamt seiner Familie zum Tode verurteilt. So weit war es 1940 noch nicht, aber die Christen gingen ein Risiko ein. Sie steckten uns Essen zu, wann immer sie konnten, und manchmal brachte das die älteren Mitglieder unserer Familie in unangenehme Situationen. Eines Tages kam ich mit einem Lebensmittelpaket unter der Jacke nach Hause. Es war ein Geschenk der Mutter meines Freundes Dudek und enthielt Würste aus Schweinefleisch. Für mich war das kein großes Problem, ich hatte in den Jahren vor dem Krieg schon oft bei Dudek Schweinefleisch gegessen. Aber für meinen Vater war so etwas undenkbar. Nach allem, was den Juden in Będzin bereits widerfahren war – der Brand der Synagoge, die Schließung der Schulen, die Erhängungen, Verbrennungen und Erschießungen, der Verrat des Judenrats –, musste es doch noch ein paar Prinzipien geben, und mein Vater konnte und wollte nicht von den Lehren abweichen, die zu seinem Leben gehörten. Seine erste Reaktion war, die Wurst wegzuwerfen. Ich erinnere mich nicht, dass meine Eltern darüber gestritten hätten, nicht einmal an eine Diskussion zwischen ihnen. Vielleicht sah mein Vater meiner Mutter nur in die Augen, und was er dort sah, genügte ihm. Sie war eine gute Jüdin, aber ihre Kinder hatten Hunger, und für eine Mutter hatte dieser Gedanke absolute Priorität. Am Ende verließ er das Haus, während wir die Wurst aßen, und so hielten wir es von da an, ohne darüber zu sprechen. Wir aßen in seiner Gegenwart kein Schweinefleisch, und wir sagten ihm auch nicht, wenn wir es hinter seinem Rücken verzehrten. Diesen Preis mussten wir zahlen, nachdem wir nun einmal in die Hände von Wahnsinnigen geraten waren.
Auf die eine oder andere Weise traf die Besatzung meinen Vater am härtesten. Er war ein stolzer Mann, hielt auf Tradition und war es gewohnt, respektiert zu werden. Jetzt war das alles verloren gegangen. Und es wurde noch schlimmer. Eines Tages kam er nach Hause, zitternd und blutverschmiert. Er war ausgegangen, um Brot zu kaufen, und ein paar Stunden unterwegs gewesen. Zunächst machten wir uns keine Sorgen, wir wussten ja, dass man überall Schlange stehen musste. Man wartete eben, so lange es nötig war. Diesmal jedoch brachte ihn ein Nachbar nach Hause. Er war in der Schlange denunziert worden; einer der gefürchteten Zeigefinger hatte sich auf ihn gerichtet, die von nun an mein Leben bestimmen sollten. Daraufhin hatten ihn mehrere Polizisten herausgezogen. Er war sehr erschüttert – die Verletzungen in seiner Seele müssen größer gewesen sein als das, was wir sehen konnten. Von diesem Tag an ging er nur noch in Rossners Fabrik; Hendla, Nathan und ich übernahmen das Schlangestehen. Und meine Mutter wurde zum Fels in der Brandung und hielt uns alle zusammen. Bei jedem Blick ins Gesicht meines Vaters konnte ich sehen, dass seine Kampfkraft – ja, seine Lebenskraft –, ihn verlassen hatte.
Die jüngere Generation war entschlossener zurückzuschlagen. Wir Jüngeren waren kräftiger und dümmer, würde ich sagen. So entstand in Będzin im Frühjahr 1940 eine Art Widerstandsgruppe aus Mitgliedern der Jugendorganisationen. Vor dem Einmarsch war ich für diese Organisationen noch zu jung gewesen, und jetzt konnte ich mich ihnen nicht anschließen, weil sie ja illegal waren. Poale Zion, Habonim Dror, Gordonia, Hashomer Hatzair, Hanoar Hatzioni, Hashomer Hadati – ich erinnere mich noch an die Namen, so wie viele junge Deutsche sich vielleicht an die antifaschistischen Edelweißpiraten erinnern. Hendla hatte viel mit Gordonia zu tun, obwohl ihre Träume, nach Palästina auszuwandern, in weite Ferne gerückt waren. Einer meiner Cousins, Hirsh Wandasman, war noch stärker engagiert; Leute wie ihn behielten die Nazis ganz besonders im Auge.
Das geschah durch Informanten, und an zwei von ihnen erinnere ich mich aus gutem Grund ganz besonders. Einer war ein Gastwirt namens Kornfeld. Er war um die dreißig, denke ich, und bevor der Zwischenfall in der Warteschlange meinen Vater dazu verurteilte, sich nur noch zwischen unserem Haus und der Rossner-Fabrik zu bewegen, besuchte Nathan gelegentlich am Samstagabend diese Gaststätte. Er trank allerdings immer nur Limonade. Kornfelds Schwager war etwas jünger als er und arbeitete als Schuster. Sein Name war Machtinger.
Eines Abends kam ich von der Arbeit nach Hause und sah Machtinger vor mir, wie er die Modrzejowska hinunterging, gemeinsam mit einem deutschen Polizisten, einem üblen Kerl namens Mitschker, mit dem ich schon einmal aneinandergeraten war. Die beiden benahmen sich, würde man heute wohl sagen, verdächtig und achteten sehr darauf, dass sie nicht beobachtet wurden, wie sie sich durch eine Seitentür in das Haus des Pferdehändlers Piekowski schlichen. Piekowski war einer der reichsten Männer der Stadt. Er war vom Judenrat wegen der Goldsammlung angesprochen worden, hatte sich aber rundweg geweigert. Ein anderer Pferdehändler, Wechselmann, hatte so viel gegeben, wie er konnte.
Mich interessierte natürlich, was Machtinger und Mitschker in der Erdgeschosswohnung von Piekowskis großem Haus machten. Piekowski selbst bewohnte mit seiner Familie den ersten und zweiten Stock; im Erdgeschoss wohnten die hübschen blonden Töchter in einer eigenen Wohnung. Ich wartete ein oder zwei Minuten – von den Eltern keine Spur. Dann duckte ich mich zwischen ein paar Büsche und schlich ums Haus, wo ich auf Zehenspitzen durch eine Lücke im Vorhang eines Fensters, das zum Garten hinausging, hineinspähen konnte.
Ich war vierzehn, und was ich sah, war zwar nicht absolut neu für mich, aber erstaunt war ich doch. Auf dem Tisch standen ein paar Bierflaschen, die Lampen brannten. Die jüngere Tochter war etwa achtzehn, also nicht sehr viel älter als ich, aber doch schon in jeder Hinsicht eine Frau. Sie lag splitternackt in lasziver Pose auf dem Sofa. Die ältere rekelte sich auf dem Bett. Sie war ein paar Jahre älter und hatte eine üppigere Figur. Ich stand wie gebannt da. Natürlich hatte ich die Mädchen schon oft gesehen, aber nie ohne Kleider! Mitschker und Machtinger hatten es furchtbar eilig. Sie kämpften beide mit ihren Hemden, traten sich die Stiefel von den Füßen und zerrten an ihren Hosen.
Ich vermute, dass mir die Zunge aus dem Hals heraushing, auch wenn das hier keine Peepshow war. Die Mädchen hatten keinen Spaß an dem, was hier passierte, so viel war mir klar. Sie machten einfach mit, ihre Gesichter waren wie versteinert. Vermutlich wurden sie erpresst, bezahlten mit ihren Körpern für ein leichteres Leben und dafür, dass die Behörden ein Auge zudrückten. Ich bekam Angst und lief weg.
Was wäre wenn? Wenn kein Krieg gewesen wäre, wenn Polen nicht besetzt gewesen wäre, wenn ich nichts von dem Verrat gewusst hätte, den Mitschker und Machtinger begingen – vermutlich wäre ich zu Dudek und den anderen gerannt und hätte es genossen, endlich mal im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit zu stehen. Wenn ich ihnen alles erzählt hätte, wären sie mit offenen Mündern und weit aufgerissenen Augen um mich herumgestanden, und irgendwann hätten wir sehr viel gekichert. Aber diese Geschichte konnte ich nicht erzählen, die Folgen wären zu schrecklich gewesen. Ein SS-Mann, der mit einer Jüdin schlief, wurde standrechtlich erschossen. Und diese Schurken kannten ja keine Ehre.
Mitschker bekam einige Zeit später kalte Füße – die Details kenne ich nicht – und ließ seine beiden Informanten fallen wie heiße Kartoffeln. Machtinger und Kornfeld waren unter den ersten, die deportiert wurden. Piekowski, seine Frau und seine Töchter folgten einige Zeit später.
Ich begriff damals gar nicht wirklich, was passierte. Ich lebte in einer Welt, in der Polizisten Sex mit Mädchen hatten, die sie eigentlich beschützen sollten, und in der der Judenrat, unsere eigenen Leute, auf eine Chance wartete, sich Fleißkärtchen der Nazis zu verdienen und auf eine andere Art mit der SS ins Bett zu steigen.
Es muss wohl im April 1941 gewesen sein, als die Flüchtlinge in unsere Stadt strömten. Andere, so berichtete man uns, zogen ins nahe Sosnowiec (Sosnowitz). Sie waren keine Flüchtlinge in dem Sinne wie die Obdachlosen, die im Herbst 1939 vor der Wehrmacht davongelaufen waren, aber auch ihre Häuser waren verloren. Sie kamen mit Karren und Wagen, Schlitten und Kinderwägelchen und hatten so viel von ihrer Habe dabei, wie sie tragen konnten. Die meisten kamen aus Oświęcim (Auschwitz), das gerade vierzig Kilometer von uns entfernt lag. Ich war nie dort gewesen, aber im Grunde genommen war es eine kleine Ausgabe von Będzin mit einer zur Hälfte jüdischen Bevölkerung. Das Foto, das damals jemand von den Neuankömmlingen aufnahm, bestätigt meine Erinnerung: Damals trugen wir bereits alle gelbe Armbinden mit einem schwarzen Davidstern. Die Leute waren aus ihren Häusern vertrieben worden, weil die Deutschen in der Artilleriekaserne nahe der Stadt ein neues Lager bauten und es keinen Platz mehr für sie gab. Wir wussten damals nicht, wie viele von ihnen bald wieder dorthin zurückgehen würden.
Es muss etwa um diese Zeit gewesen sein und hatte vielleicht mit dem Zustrom von Menschen zu tun, dass auf der Anschlagtafel vor dem Büro des Judenrats zu lesen war, alle Juden müssten sich fotografieren lassen. Zu allen Zeiten haben die Menschen Angst vor dieser Art der Registrierung und Klassifizierung gehabt. Die Menschen in den Kolonien des 19. Jahrhunderts fürchteten sich vor der Kamera, weil sie glaubten, sie würde ihnen die Seele rauben. Auch ausführliche Listen, oft ein Vorläufer steigender Steuern und Abgaben, wurden mit Schrecken betrachtet. Als Wilhelm der Eroberer im Jahr 1086 abfragte, wie viele Pflüge und wie viele Stück Vieh die Menschen besaßen, hielten sie das für einen Vorläufer des Jüngsten Gerichts – daher der Name „Domesday Book“. Die Optimisten unter uns dachten, wir würden vielleicht nach Palästina deportiert und Hendla würde doch noch ihren Willen bekommen. Die Pessimisten sagten jedes denkbare Höllenloch voraus, vielleicht irgendwo in Fernost. Heute weiß ich, dass es einen Plan gab, alle Juden nach Madagaskar zu deportieren – das war eine der „Endlösungen“, die die Nazis für uns erdacht hatten.
Der Plan war im Jahr zuvor entwickelt worden, und tatsächlich hatte das Oberkommando der Nazis auch über Palästina nachgedacht, die Idee dann aber wieder verworfen. Madagaskar gehörte zu Frankreich, aber Frankreich war ja inzwischen ebenfalls von der Wehrmacht überrannt worden, mit Ausnahme des südfranzösischen Vichy-Gebiets, dessen Verwaltung mit den Deutschen kollaborierte. Das Geld dafür, uns alle auf diese Insel vor der Küste Afrikas zu schicken, sollte aus konfisziertem jüdischem Besitz kommen. Aber selbst die 587.000 Quadratkilometer große Insel, weltweit die viertgrößte Insel überhaupt, war nicht groß genug für alle europäischen Juden, so wenig die Nazis auch an unser Wohlbefinden dachten. Außerdem spielten die Briten nicht mit, und Großbritannien herrschte nun einmal – das mussten selbst die Nazis zugeben – über die Weltmeere. Trotzdem stellten wir uns brav alle an und ließen uns fotografieren. Das Foto meiner Großmutter existiert noch, es ist eins von zwei Bildern, die ich von ihr besitze. Sie wurde zu dieser Zeit allmählich blind.
Wir machten irgendwie weiter, so gut wir konnten, aber die Ankunft der Juden aus Oświęcim ließ die Vorräte noch knapper werden und der Schwarzmarkt blühte wie wild. Mein Vater, eigentlich ein gebrochener Mann, besaß immerhin die Energie, ab und zu Stoffreste aus Rossners Uniformfabrik zu schmuggeln. Wenn ihm das gelang, saß er zu Hause im Schneidersitz auf dem Boden, Nadel und Faden in der Hand, und nähte Kleider für Nicht-Juden, die ihn mit Mehl oder Wurst bezahlten.
Gefährlich war unser Leben allemal. Männer und Frauen in der Fabrik verloren bei der ungeschützten Arbeit ihre Finger; für jüdische Arbeiter gab es keine Sicherheitsvorkehrungen. Aber eines Tages wurde es richtig schlimm. Zu unseren nächsten Nachbarn gehörten die Schwartzbergs, die drei Türen weiter wohnten. Im Frühjahr 1941 wurden Herr Schwartzberg und sein Sohn von der Nazi-Polizei verhaftet. Ich habe es nicht selbst gesehen, aber in unserer Straße wurde tagelang darüber geredet. Ihr Verbrechen? Herr Schwartzberg hatte eine Kuh von einem nicht jüdischen Bauern gekauft, schwarzgeschlachtet und das Fleisch verkauft. Eine Riesendummheit, dachten wohl auch die Nazis. Offenbar hatte Schwartzberg genug Geld, um das Tier erst einmal zu kaufen. Und das, obwohl er doch seine gesamten Ersparnisse dem Judenrat hätte geben sollen. Außerdem unterlief er mit dieser Aktion die Lebensmittelrationierung, die für uns gerade das Lebensnotwendige vorsah. Und dann trotzte er auch noch der Autorität der SS. Nach ein paar Tagen hörten wir, dass beide Schwartzbergs erschossen worden waren.
Dann kamen die Wechselmanns dran, eine andere Familie, die wir gut kannten. Einer aus der Familie hatte einen Sack Mehl von einem Nicht-Juden gekauft, und sie hatten alle von dem Brot gegessen, das daraus gebacken worden war. Die Wechselmanns wurden erhängt; ich sah ihre Leichen von den Bäumen am Hauptfriedhof baumeln. Wie seinerzeit beim Einmarsch ging es um Abschreckung. Hört auf mit dem Schwarzmarkt, sonst seid ihr als Nächste dran! Die gefrorenen grauen Leichen mit den verrenkten Hälsen waren eine deutliche Warnung.
In den ersten achtzehn Monaten der Nazibesatzung sah ich, wie meine Eltern von der ständigen Anstrengung zermürbt wurden. Sie versuchten ja, irgendwie die Familie am Leben zu erhalten. In den Straßen und in Killovs Fabrik war es dasselbe: Junge Männer wurden alt und grau vor Angst, Mangelernährung und Erschöpfung. Ich arbeitete mit meinen vierzehn Jahren Zwölf-Stunden-Schichten und hatte Mühe, irgendwo einen Kanten Brot zu finden. Dass wir als Familie immer noch zusammen waren, reichte mir nicht. Wie konnten wir hoffen, dass sich die offizielle Politik irgendwann änderte, dass irgendwann alle Deutschen so sein würden wie Rossner und Killov? Und überhaupt, was hatten wir ihnen eigentlich getan? Die Schwartzbergs und Wechselmanns hatten gegen Gesetze verstoßen, aber eben gegen unvernünftige, ungerechte Gesetze. Und wir anderen? Wir waren Juden, das genügte ihnen.