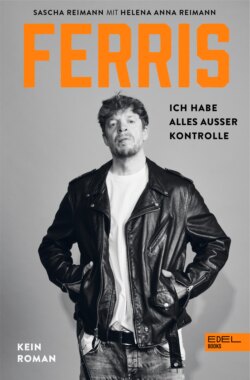Читать книгу FERRIS - Sascha Reimann - Страница 4
Ferris macht Bau
ОглавлениеZugegeben, mein Leben ist eine Aneinanderreihung komplett absurder Ereignisse – immer schon. Nicht immer schön, aber zumindest rückblickend überwiegend unterhaltsam.
Eine der beklopptesten Geschichten ist mit Sicherheit die meines Verschwindens.
Die Geschichte, die Mitte Dezember auf Tobis Mofa in Altona beginnt und einen Tag vor Heiligabend 1999 mit der Entlassung aus der Untersuchungshaftanstalt Hamburg endet.
Von Anfang an geht sie so:
Ich war allein zu Hause in meiner Wohnung in der Palmaille in Altona. Zwar hatte ich, realistisch betrachtet, noch ausreichend Weed für den Abend und den nächsten Tag, aber die Vorräte waren nach Bela B.s völlig aus dem Ruder gelaufenen Geburtstagsparty vor ein paar Tagen doch erheblich geschrumpft.
Nichts war damals für mich unerträglicher als das Gefühl, zu wenig Gras im Haus zu haben, um mich in die Besinnungslosigkeit zu kiffen.
Da Tobis Mofa als Dauerleihgabe bei mir vor der Haustür stand, war ich theoretisch einsatzfähig und nur ein paar knatternde Meter vom Dealer meines Vertrauens entfernt. Also raffte ich mich auf und tuckerte in Richtung Eimsbush Basement – nach etwa 200 Metern mitten rein in eine allgemeine Verkehrskontrolle und den diensthabenden Beamten direkt zwischen die reflektierenden Kellen.
Dass ich weder einen Helm trug noch im Besitz eines gültigen Führerscheins war, dass es zum Tobi-Mobil keine passenden Papiere gab sowie die Tatsache, dass ich offensichtlich total breit war und dann doch noch – hoppla – drei Packen Weed à fünf Gramm, in Jackentaschen verteilt, vergessen hatte, interessierte die Polizisten alarmierend wenig.
Aufgeregt flatterten sie um meinen Perso herum, reichten ihn hin und her, nuschelten in Funkgeräte und warfen mir böse Blicke zu. Richtiggehend unfreundlich waren sie.
Natürlich war ich mir keiner Schuld bewusst. Okay, ich hatte eine kleine Menge Gras dabei und eben in der Wohnung noch einen Joint geraucht, aber immerhin nicht während der Fahrt, so wie sonst.
Unvermittelt grapschten mich zwei uniformierte Kerle, warfen mich bäuchlings auf die Kühlerhaube ihres Peterwagens und legten mir zu zweit Handschellen an, als hätte ich mich gewehrt. Dazu wäre ich allerdings viel zu perplex und bekifft gewesen.
Eine Piepsstimme, die einer kleinen Polizistin mit blondem Pinselzopf entwich, japste irgendwas von Haftbefehl und Holstenglacis. Bitte was?
Ich bekam einen Lachflash – diese Situation war zu bekloppt. Prustend schlug ich vor, am besten direkt die Presse zu informieren. Was für eine abgefahrene Story war das denn? Diese Anregung wurde aber leider ebenso ignoriert wie meine Nachfragen zum angeblichen Haftbefehl gegen mich.
Nur ein Polizist gab mir den womöglich gut gemeinten Rat: „Hör auf zu sabbeln, Junge, du bist doch völlig drupp“, als ich im Streifenwagen auf das Revier gekarrt wurde.
Dort angekommen versuchte ich mittlerweile recht ratlos irgendjemanden dazu zu bringen, mich telefonieren zu lassen oder wenigstens für mich meinen Manager, meine Plattenfirma oder zumindest Tobi anzurufen – wobei eh nur Letzterer ans Telefon gegangen wäre, mittlerweile war es 20 Uhr und kein Büro mehr besetzt.
Freitagabend, ab ins Wochenende.
Auf der Wache wurde ich nach spitzen Gegenständen abgetastet, bis auf meinen Schlüssel, der als ungefährlich eingestuft wurde, hatte ich aber nichts dabei, und so kassierten sie bloß mein Handy ein. Portemonnaie, Schlüssel und, am wichtigsten, mein Weed blieben bei mir. Das hatten die Schwachköpfe, unglaublich, aber wahr, in ihrer überbordenden Aufregung übersehen.
Ein Teil der Belegschaft erkannte mich und feierte sich so richtig darauf ab, das „Reimemonster“ eingefangen zu haben – was für ein Haufen Idioten.
Das Monster wurde dann artgerecht in einem Gefangenentransporter eingepfercht. Ein riesiger Bus mit separaten Minizellen für Schwerverbrecher, Mörder, Kinderfresser – und mich.
Ich wusste nicht, was da gerade passiert. Es gab in der etwa Dixi-Klo-großen Buszelle natürlich kein Fenster, mit der Destination „Holstenglacis“ konnte ich nichts anfangen.
Zu allem Übel kam erschwerend hinzu, dass ich nach Belas Party immer noch Chemie abbaute. Jeder, der schon mal Pillen in Kombination mit einer größeren Menge Kokain konsumiert hat, weiß, wovon ich rede.
Für alle anderen: Der Körper fährt ganz ekelhaft runter, versucht diese chemische Bombe mit allen Mitteln zu entschärfen und abzutragen.
Ich war extrem emotional, körperlich wie seelisch äußerst sensibel und über alle Maßen geräuschempfindlich. Ich fror und schwitzte gleichermaßen, hatte brutale Kopfschmerzen und Ohrensausen.
Eigentlich wollte ich in dieser Verfassung nur liegen, kiffen und TV glotzen. Alles in allem also keine sonderlich erquickende Konstitution, um in den Knast einzufahren.
Dass ich tatsächlich gerade in den Bau wanderte, wurde mir erst klar, als ich übertrieben ruppig aus dem Gangstergroßraumtaxi gezerrt wurde und mich in einem gefliesten Raum mit Metalltisch wiederfand.
Die Handschellen wurden mir hier endlich abgenommen – leider bloß, um mich von Kopf bis Fuß zu filzen. Alles wurde durchsucht, alles, was ich noch bei mir trug, wurde konfisziert: Portemonnaie, Schlüssel und, am schlimmsten, mein Weed. Das Geld würde ich demnächst ausgehändigt bekommen, sagten die Beamten. Den Rest nicht.
Dabei hatte ich schon überlegt, wo ich hier am besten, bevorzugt liegend, gemütlich einen durchziehen könnte.
Wortlos wurde ich ein Zimmer weitergeschoben, hinter mir fiel eine Tür schwer ins Schloss.
„So, der Herr – Leibesvisitation. Entkleiden, komplett“, sagte einer der umstehenden Männer, die sich mittlerweile zu einer bunten Truppe aus dunkelgrüner und dunkelblauer Dienstkleidung in dem kleinen Raum zusammengefunden hatten. JVA-Beamte, Polizisten, einer von ihnen sah aus wie der Hausmeister.
Dass ein weiterer „Gefangener“ die ganze Zeit über eine Armlänge entfernt neben mir stand, bemerkte ich erschreckend spät. Hatte auch er im Hannibal-Lecter-Reisebus gesessen?
Er verstand offenbar kein Deutsch, so auch nichts von dem, was die Beamten ihm entgegenblafften – auch nicht, als sie anfingen, ihn anzuschreien.
Also orientierte er sich an mir. Ich zog meine Jacke aus, er hatte keine. Ich zog meinen Pulli und mein Shirt aus, er tat es mir gleich. Ich zog die Schuhe aus, er auch. Ich öffnete meinen Gürtel und sein ratloser Blick wurde ängstlich. Ich zog die Hose runter, er guckte panisch.
Ich stand vor ihm und allen anderen in Boxershorts da, guckte ihn an und zuckte mit den Schultern.
Unendliche, sehr unangenehme Minuten später, akustisch untermalt von mehrstimmigen Pöbeltiraden seitens des Uniformpotpourris, hatte er sich ebenfalls dazu durchringen können und präsentierte unfreiwillig seine Unterhose.
So standen wir da, ich fluoreszierend weiß mit abstehenden, blonden Locken bis zu den Schultern, er tiefschwarz mit superkurz geschorenem, dunklem Haar. Was für ein Paar.
„Komplett entkleiden!“, forderte mich eine Stimme auf, die ihre Schadenfreude nicht mal zu verstecken versuchte. Eine andere fiel mit ein: „Komplett entkleiden bedeutet nackt!“
Ich war zu fertig, um mich zu wehren, hätte sowieso nichts gebracht. Also zog ich erst die Socken aus, legte selbige auf den stetig wachsenden Haufen Klamotten vor mir auf den Tisch und zog die Boxershorts runter.
Mein neuer Kumpel guckte mich jetzt nicht mehr an, sondern zu Boden.
Mit schwächelndem Kreislauf und mittlerweile ebenso schwacher Stimme verlangte ich wieder danach, telefonieren zu dürfen. Aus diversen Filmen hatte ich schließlich gelernt, dass jedem Knastimport ein Anruf zusteht – dieser eine berühmte Anruf.
Was in Hollywood Gesetz ist, galt, jedenfalls in Hamburg, nicht. „Wen willste denn jetzt anrufen, zu später Stunde?“, fragte mich röchelnd ein Kaventsmann in Dunkelblau. „Plattenfirma, Manager, egal! Digga, ich bin Rap-Star!“, entgegnete ich, so laut ich konnte, mit dem kläglichen Rest Lungenvolumen, das mir in meinem erbärmlichen Zustand noch zur Verfügung stand.
Er lachte. Seine Kollegen lachten, lachten mich aus. Als sie sich einigermaßen beruhigt hatten, antwortete einer von ihnen: „Das ist ja schön für dich, bringt dir aber nix. Da hatten wir hier schon ganz andere Promis sitzen“, und ein anderer ergänzte: „Hier sind alle gleich, wirste schon sehn.“ Na toll.
„Ich bin unschuldig, ihr Wichser!“, brüllte ich und die Beamten lachten wieder, noch lauter und noch länger. „Scheiß Spackos!“, krakeelte ich in die Runde, die auch daraufhin nicht verstummte.
Mein Leben hatte doch gerade erst angefangen, endlich Spaß zu machen – sollte es das schon gewesen sein? Warum zur Hölle war ich eigentlich hier? Durften die mich einfach einschließen, ohne mir zu sagen, wofür? Es musste einfach eine Verwechslung vorliegen, anders konnte ich es mir nicht erklären.
Eine Woche zuvor hatte ich, zusammen mit DJ Stylewarz, einen Gig in Santa Fu, Hamburgs Justizvollzugsanstalt, gespielt. Bevor wir auf die Baubühne durften, mussten wir diverse Schleusen passieren: Personalausweise vorzeigen, zugegeben ein etwas salopper Sicherheitscheck, aber immerhin, Auflistung unseres Equipments, das volle Programm.
Warum, wenn ich mir denn etwas zuschulden hatte kommen lassen, war ich da nicht schon festgenommen worden?
Nach unserem Auftritt, bei dem der komplette Saal nach meiner Ansage „Mittelfinger hoch für Fuhlsbüttel“ selbigen beidseitig in die Luft gereckt hatte, ließen mich die Heerscharen von Polizisten und Justizvollzugsbeamten einfach wieder nach Hause gehen.
Was war in der Zwischenzeit passiert?
So langsam schwante mir, wie gnadenlos ausgeliefert ich war. Machtlosigkeit ist ein widerliches Gefühl. Um wenigstens meinem Körper Kontrolle vorzugaukeln, verlangte ich nach einer Schlaftablette – wenn ich dann schon bleiben musste.
„Ich fahr hier voll Entzug! Entweder ihr gebt mir jetzt was zu kiffen oder ne Tablette, dass ich schlafen kann, sonst dreh ich durch!“, pöbelte ich in meiner verzweifelten Not. „Durchdrehen“ ist übrigens kein Wort, welches ein Insasse, der gerade auf seine Zelle geführt wird, brüllen sollte. Dann folgt nämlich unweigerlich das, was mir blühte. „Der Junge muss zu Frau Doktor“, stellte eine Uniform fest.
Erneut packten mich zwei Männer links und rechts an den Armen und führten mich in ein weiteres eiterbeige gekacheltes Zimmer, diesmal mit Schreibtisch, ein paar Stühlen und einer Liege. Die weiß bekittelte Frau Doktor mit dem nahezu identischen „frechen“ Kurzhaarschnitt meiner Mutter fragte nach meinem Befinden.
„Beschissen“, entgegnete ich wahrheitsgemäß. Ich klagte ihr mein Leid, versuchte ihr klarzumachen, dass ich gerade auf Entzug kam, und bettelte sie in meiner grenzenlosen Naivität um Gras an. Aus medizinischer Sicht war mein Anliegen vollkommen berechtigt, sinnierte ich.
Ein paar Joints sowie auch nur einen einzigen verwehrte sie mir, nickte aber die von mir geforderte Alternative in Form einer Schlaftablette ab.
Leider war ich so dumm, ihr zu glauben.
„Sie werden die heutige Nacht im B-Flügel verbringen. Morgen schaue ich wieder nach Ihnen. Sollte es Ihnen besser gehen, lasse ich Sie in die Gemeinschaftszelle verlegen“, schrieb und sprach sie synchron. Okay, cool – der B-Flügel kann ja nur die Krankenstation sein, oder?
Meine Laune besserte sich schlagartig. Euphorie befiel mich, schließlich lockte ein womöglich halbwegs anständiges Bett, die Zuführung diverser Tabletten sowie die Beobachtung und Rehabilitation meines katastrophalen körperlichen Zustandes. So wie damals, während meines kurzen Bundeswehrintermezzos. Aber dazu später mehr.
Falsch gedacht, mal wieder. Statt in die Schwarzwaldklinik wurde ich in eine Einzelzelle geleitet, die der Kulisse von The Rock – Entscheidung auf Alcatraz beängstigend ähnelte.
Da haben die Requisiteure ganze Arbeit geleistet: Stahlbett inklusive als Bettdecke getarntem Kartoffelsack, Stahltoilette ohne Brille und ohne Deckel, vergittertes Minifenster, Stahltür mit Gitterstäben und ein in die Wand eingelassenes vergittertes Radio. Dieses verdammte Radio, das mich in den bevorstehenden Stunden in den Wahnsinn treiben sollte. Ich bekam einen weiteren Kartoffelsack als Hausanzug in die Hand gedrückt, da ich meine eigenen Klamotten zum zweiten Mal an diesem Abend komplett ablegen und abgeben musste.
Kein Gürtel und kein Schnürsenkel sollte die „akute Suizidgefahr“ unterstützen, die mir im Vorbeigehen noch schnell von Frau Doktor diagnostiziert wurde.
Rumpelnd fielen die Gitterstäbe zu, ein Wärter drehte den Schlüssel um. Das Radio dudelte zwar leise, aber laut genug, um mir bereits nach drei Minuten den allerletzten Nerv zu rauben. Die Deckenbeleuchtung blieb an. In undefinierbarer Entfernung hörte ich Insassen in ihren Käfigen schniefen, schnauben und schnarchen.
Alle paar Minuten luscherte ein Aufseher durch die Stäbe.
Ja, ich war noch in der Zelle, ja, ich lebte noch. Mehr interessierte nicht.
Sowohl die Hoffnung auf „den Anruf“ als auch auf eine schlaffördernde oder zumindest beruhigende Pille zerschlugen sich auf meine Nachfrage hin erneut.
Der Wachdienst teilte mir lapidar mit, dass über das Wochenende nichts gehe, am Montag nehme sich der Haftrichter meiner an und entscheide über ein Telefonat. Nein, Frau Doktor habe keine Medikation verordnet und sei jetzt auch im Feierabend.
Scheiße. Das Hochgefühl wich einer dunklen Leere. Die sperrten mich wirklich einfach ein, niemand wusste, wo ich war. Keiner konnte mir helfen. Ich wusste immer noch nicht, warum oder weswegen ich weggeschlossen wurde.
Das war mit Abstand der mieseste Trip, den ich jemals erlebt habe – und das auch noch nüchtern.
Die Entzugserscheinungen gewannen endgültig die Kontrolle über mich, mein Körper und mein Geist befanden sich in einer Abwärtsspirale. Noch nicht einmal Kippen wurden mir gegönnt, als Kettenraucher die Höchststrafe. Kalter Entzug im wahrsten Sinne des Wortes. Ich schlotterte im Jute-Ensemble, es war eiskalt, eine Heizung gab es nicht, draußen schneite es.
Nie wieder wünschte ich mich sehnsüchtiger in mein eigenes warmes Bett. Gleichzeitig bemühte sich mein Organismus, sämtliche Giftstoffe der vergangenen Jahre ex abrupto und mit aller Kraft Tropfen für Tropfen herauszupressen, mit meiner Haut als Filtertüte.
Ich war unermesslich müde, wollte nur noch schlafen. Die wellenartig auf und ab schwappende Panik wusste dies aber zuverlässig zu verhindern. Dauernde Dudelei aus dem Radio. Ich hielt mir die Ohren zu, mein Blut rauschte zu schnell und überzogen geräuschvoll durch meinen Kopf.
Ich hörte mein Handy klingeln. Was? Die haben mir mein Handy zurückgegeben? Wer rief mich an? Wurde ich vermisst? Suchten die mich längst? Ich tigerte durch den Raum, meinem Klingelton hinterher, sah alles nur noch verschwommen und griff bei jedem Versuch, es vom Boden aufzuheben, neben mein Mobiltelefon. Ich bekam es einfach nicht zu fassen. Es hörte auf zu läuten, dann machte es in der gegenüberliegenden Ecke wieder auf sich aufmerksam. So ging es eine Weile, bis ich mir selbst eingestehen musste, dass ich entweder endgültig durchgeknallt war oder schlicht halluzinierte.
Dass die schlimmste Nacht meines Lebens endlich vorbei war, bemerkte ich daran, dass Frau Doktor mit einem Pulk weiterer Weißkittel im Schlepptau auf einmal in der Zelle stand. Draußen war es stockdunkel, drinnen neonröhrenhell, ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Keine Ahnung, ob ich geschlafen hatte, die Pritsche samt Kartoffelsackbettdecke schien unberührt.
„Guten Morgen – wie fühlen Sie sich?“, fragte Frau Doktor. Wenn ich nur halb so desaströs aussah, wie ich mich fühlte, hätte ihr eigentlich ein Blick in meine Augen als Info reichen müssen. Ich antwortete nicht. Sie sagte: „Wenn Sie mir jetzt sagen, dass es Ihnen besser geht, dürfen Sie raus in den Hof und dann in die Gemeinschaftszelle. Ansonsten bleiben Sie bis auf Weiteres hier“, und deutete mit dem Zeigefinger auf den Boden, wo ich wahrscheinlich wirklich den Großteil der Nacht verbracht hatte. Ich hätte alles gesagt, gestanden und getan, um aus diesem Loch herausgelassen zu werden.
Also log ich, es gehe mir viel besser, einfach wunderbar. Die Nacht alleine habe so gutgetan und ich würde dann jetzt gerne raus in den Hof, frische Luft schnappen. Ihr Anhang schrieb auf Klemmbretter, ein Wärter kam und drückte mir meine eigenen, mittlerweile reichlich verlebten Klamotten in die Hand.
Draußen im Hof atmete ich die kalte Luft ein, die so ganz ohne Nikotin oder Gras gemischt überraschend wohltuend war. Häftlinge zogen ihre Bahnen durch den frischen Schnee, standen in Gruppen zusammen oder an Wände gelehnt.
„Hello, my friend“, sagte eine Stimme, die ich nicht kannte. Ich guckte zur Seite und sah in das lächelnde Gesicht meines Leidensgenossen des gestrigen Abends.
Obwohl wir nur ein paar Augenblicke zusammen verbracht und kein Wort miteinander gesprochen hatten, war ich unsagbar froh ihn zu sehen. Ein halbwegs bekanntes Gesicht zwischen den ganzen Fratzen dieses sehr schlecht produzierten Knastdramas.
Er fragte: „How are you?“, anscheinend sah ich mitleiderregend aus. „Not good“, antwortete ich und klaubte innerlich mein nicht vorhandenes Schul- und etwas besser vorhandenes Rap-Englisch zusammen. So unterhielten wir uns mehr schlecht als recht, bis er mir mit der Frage „You smoke?“ Tabak und Blättchen unter die Nase hielt. Mein Held! Ich fiel ihm vor Glück um den Hals, er lachte und freute sich, dass ich mich freute. Den Rest der uns zugestandenen Stunde Hofgang verbrachten wir rauchend und spazierend gemeinsam. Mittlerweile hatte er eine Jacke bekommen, die nicht nur nach Rote-Kreuz-Container aussah, sondern auch so roch.
Nachdem wir wieder durch die Schleuse ins Innere des Baus zitiert wurden, sah ich ihn nie wieder.
Die Einlösung des zweiten Versprechens des Tages stand an: der Einzug in die Gemeinschaftszelle. Nach dem nächtlichen Horror bereitete ich mich innerlich auf das Schlimmste vor, wurde aber positiv überrascht.
Der kleine Raum mit den zwei Stockbetten glich eher einer abgeranzten Jugendherberge als einer in meiner Vorstellung bereits aufs Übelste ausgemalten Gefängniszelle. Nur dass anstatt ockergelber Vorhänge hier Gitterstäbe das Fenster verzierten. Drei Häftlinge begrüßten mich zwar nicht gerade überschwänglich, aber dennoch freundlich.
Zumindest war ich hier nicht allein mit meinem Kopf. Es gab einen kleinen flimmernden Fernseher mit Antenne anstelle des Dudelradios, die Männer rauchten Kette und hatten sich inklusive Chipstüten, Groschenromanen und überquellenden Aschenbechern häuslich eingerichtet.
Mir wurde das freie obere Bett auf der rechten Seite zugeteilt. Unter mir hatte der besorgniserregend dürre kleine Mann, Alter unschätzbar irgendwo zwischen 30 und 50 Jahren, mit unverkennbar massivem Alkoholproblem sowie zwei Raucherbeinen, seine Schlafstätte eingerichtet. Eines seiner blauschwarzen Beine war „offen“, es war verkrustet und er pulte ständig daran herum, war aber überraschend gut drauf. Fröhlich erzählte er mir, dass er wegen nicht bezahlter Schwarzfahrtickets saß. Für ihn anscheinend im Gegensatz zur finanziellen Buße dieses Vergehens die attraktivere Option.
Das gegenüberliegende obere Bett beherbergte einen Horst-Lichter-Verschnitt mit Glatze und Zwirbelbart. Er war um die 50 Jahre alt und hatte offenbar kein Problem mit seiner Sexualität. Er musterte mich, das Frischfleischnervenbündel, und schien etwas enttäuscht darüber zu sein, dass er mir so gar keine homoerotische Ausstrahlung attestieren konnte. Warum er saß, sagte er nicht. Ich fragte nicht nach.
Das vierte Blatt unseres unglücklichen Klees verkörperte ein über alle Maßen fetter Rocker mit zugehackten Armen und jeder Menge Blech in Ohren und Fresse – Alter ebenfalls unschätzbar, älter als ich auf jeden Fall. Freigebig posaunte er zur Begrüßung den Grund seiner Anwesenheit heraus: „Ich hab den neuen Ficker meiner Alten abgestochen“, und rundete dieses Statement mit einem rasselnden Lachen ab. Na dann.
Ich dachte an meinen neuen Kumpel in der schäbigen Winterjacke. Eine Straftat konnte ich ihm nicht zuweisen, wahrscheinlich wurde auch er gekidnappt, so wie ich.
Natürlich wollten meine Mitbewohner wissen, warum ich hier war. „Keine Ahnung“, sagte ich veritabel. Ich gab ihnen eine kleine Einsicht in mein Gedankenkarussell: „Kann nur was mit Drogen zu tun haben, schätze ich mal. Montag werde ich dem Haftrichter vorgeführt, dann weiß ich mehr.“ Mitleidiges Kopfnicken, Welpenbonus.
Sie erklärten mir die Abläufe innerhalb des Baus: Mittwoch war Kiosktag, dem fieberten alle entgegen. Zwei Tage in der Woche durfte in der Sammeldusche Körperhygiene betrieben werden. Die Dusche auf der Zelle, die sich samt der Toilette hinter einer abschließbaren Tür verbarg, durfte nicht genutzt werden. Warum, konnte mir keiner erklären. Sie wiesen mir einen Spind zu, allerdings hatte ich nichts, was ich hätte hineinlegen können. Noch immer wusste niemand aus meinem echten Leben, wo ich war, also hätte mich auch niemand besuchen und mir Wechselklamotten mitbringen können.
Da ich meiner WG glaubhaft versicherte, immerhin 100 Mark bald wieder mein Eigen nennen zu können, gewährten sie mir bis zum nächsten Kiosktag hemmungsloses Durchschnorren.
Wir rauchten, guckten eines von drei Programmen auf dem Minifernseher, spielten Karten, Zwirbel-Horst kochte abends auf einem Campinggaskocher Dosenravioli für alle, da sich das kredenzte Knastessen als jenseits von genießbar erwies.
Endlich war Montag, Haftrichtertag. In einer als Büro maskierten Zelle erfuhr ich endlich den Grund meiner Festnahme: europaweiter Drogenhandel. Ha! Da hatten wir es – Verwechslung, ich habe es doch die ganze Zeit geahnt.
Ja, ich vertickte hier und da Gras, vornehmlich um meinen Eigenbedarf zu decken, aber als Drogenhändler hätte ich mich nicht betitelt. Schon gar nicht europaweit. Siegessicher verlangte ich nun nach „dem Anruf“, der mir seit nunmehr drei Tagen verwehrt blieb.
Der Haftrichter bestand darauf, dass nicht ich, sondern er diesen Anruf tätigen würde, und fragte mich nach der Nummer, die er wählen sollte. Ich verwies auf mein Handy, da waren alle relevanten Namen gespeichert. Interessierte den Richter aber leider nicht.
Entweder sollte ich ihm an Ort und Stelle eine Telefonnummer nennen oder es gäbe keinen Anruf in meinem Sinne.
Ich ratterte mein Gehirn durch, war mir keiner Durchwahl sicher – bis auf einer.
Ausgerechnet die Festnetznummer meiner Plattenfirma Yo Mama Records hatte sich in mein Gedächtnis gebrannt, also ratterte ich sie runter. Der Richter tippte auf seinem Apparat herum, wartete, nuschelte „Anrufbeantworter“ und sprach seine Nachricht auf das Band.
Dass diese Nachricht niemals abgehört werden sollte, ahnte ich nicht.
Es folgten weitere Knasttage, und ich wunderte mich, warum ich noch ein Teil ebendieser war. Resigniert wusch ich meine mittlerweile jämmerlich verdreckten Klamotten, die ich gezwungenermaßen Tag und Nacht trug, unter der Dusche. In den Sammelduschen behielten alle ihre Unterhose beim Waschen an, nur ich stand nackt da und versuchte mittels geliehenem duschdas den Gestank aus Boxershorts und Socken zu rubbeln. Ich stieg nass und nackt in Jeans, T-Shirt und Schuhe, hing meine Unterwäsche über das Bettgestell in der Zelle zum Trocknen auf und begab mich auf den Weg zum einzigen Highlight der U-Haft, zum Kittchen-Kiosk.
Auf dem eskortierten Weg dorthin wurde mir endlich mein Geld ausgehändigt. Der Einkauf fand einzeln in einem Raum statt, der aussah wie ein überdimensionierter Industriefahrstuhl. An der Stirnseite lockten bunte Verpackungen hinter Sicherheitsglas.
Da ich nicht wusste, wie lange ich mit meinen 100 Mark auskommen musste, zügelte ich mein Verlangen, den Laden leer zu kaufen. Ich rief dem Kioskmann meine Bestellung durch die Sprechlöcher entgegen – zuerst musste ich die Schnorrschulden tilgen, sonst hätte es Ärger gegeben.
Nachdem ich Unmengen Tabak, Blättchen, Filter, Softdrinks und eine Batterie Dosenravioli gekauft hatte, gönnte ich mir noch ein paar John-Sinclair-Groschenromane und eine Packung Kinderschokolade.
Auf dem ebenfalls von einem Beamten begleiteten Rückweg zur Zelle kam mir auf dem langen Flur ein von Wärtern flankierter, schmutzig und grenzdebil erscheinender, außergewöhnlich großer Hooligantyp ohne Haare und ohne Zähne entgegen. Er kratzte sich unentwegt mit beiden schlecht tätowierten Händen am Hals und freute sich offenbar auch schon auf sein Shoppingerlebnis. Dagegen waren meine Zellengenossen totale Sympathieträger.
Die drei hatten mich darüber aufgeklärt, dass ich, mit dem Straftatbestand des europaweiten Drogenhandels, mindestens drei Monate auf meine Gerichtsverhandlung würde warten müssen, und waren sich einig, dass ich dann mit einer Haftstrafe von zwei bis drei Jahren zu rechnen hätte.
Ich war am Ende. Warum holte mich niemand raus? Würde ich tatsächlich nicht nur Heiligabend, sondern auch Silvester 2000 mit meinen Mitbewohnern wider Willen auf 12 Quadratmetern Wohnklo verbringen müssen? Nüchtern? Zwischen Weihnachten und Neujahr war ich für die X-MAS Jam gebucht, die konnte und wollte ich nicht verpassen.
Deprimiert und ausgelaugt fügte ich mich meinem Schicksal des Ausharrens. Allein die Zuversicht, dass dieser Albtraum einer Verwechslung geschuldet sein musste, ließ mich nicht vollends verrückt werden.
Nachdem Zwirbel-Horst das Finale seines allabendlichen Rituals des „Kochens“ mit den Worten „So, Kinder, Essen ist fertig!“ eingeläutet und wir die Spielkarten zur Seite gelegt hatten, um uns auf die lauwarmen Ravioli zu stürzen, betrat ein Wärter unsere heimelige Zelle und schnauzte: „Reimann – morgen früh Verlegung nach Bremen. Sachen packen.“
Digga, welche Sachen? Und wieso Bremen? Da bin ich nicht grundlos abgehauen.
Wie gewohnt keine Antwort.
Nach einer unruhigen Nacht und verhaltenen, leicht wehmütig klingenden Trostzusprüchen vom Alki, dem Mörder und Zwirbel-Horst durfte ich vor meiner geplanten Verlegung nach Bremen noch mal auf den Hof.
Ich lief allein durch den Schnee und verfluchte Bremen, diesen Knast hier, die Wärter, Frau Doktor mit ihrem bescheuerten Haarschnitt und den Kackhaftrichter, der bestimmt nur so getan hatte, als hätte er auf Yo Mamas Anrufbeantworter gesprochen.
Meine Zuversicht, alles würde doch noch gut werden, schwand. Ich würde die nächsten Tage, Wochen und Monate also in Bremen verbringen – eingesperrt. Vielleicht sogar Jahre?
Ich schlurfte mit angezähltem Kreislauf zurück in die Zelle, wo meine WG Spalier stand, um mich zu verabschieden. Als der Wärter zurückkam, um mich abzuholen, sagte er: „Reimann – Sie können gehen.“ „Ja, ich komm ja schon“, murmelte ich resigniert. „Nein, Sie können gehen – ohne mich, also uns“, sagte der Wärter ungehalten und zeigte auf einen unsichtbaren Kollegen neben sich. „Wohin?“, fragte ich. „Mir egal, Sie sind frei“, antwortete er.
Ich brach zusammen, ich schrie, nein, ich grölte einen Urschrei der Erleichterung heraus.
Das Wunder der Weihnacht hatte einen Tag vor Heiligabend zugeschlagen – BÄM!
Zwirbel-Horst ermahnte mich, ich solle mich aus Rücksicht auf die anderen Insassen gefälligst leiser freuen, denn schließlich müssten sie tatsächlich die Feiertage hier verbringen. Mir war alles egal – nur noch raus. Die volle Kiosktüte vom Vortag überließ ich komplett den drei Kapeiken und rannte los. „Nicht rennen!“, rief mich eine Stimme zur Ordnung und ich verlangsamte meinen Gang auf dem Weg zur Schleuse auf Nordic-Walking-WM-Tempo. Hier bekam ich mein Hab und Gut wieder, Handyakku war leer, sonst alles noch da. Das Weed haben sie natürlich behalten, egal – zu Weihnachten muss man auch mal gönnen können.
Ich stand vor den Toren des gigantischen Backsteinbaus, war voller Adrenalin und wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Erst mal was zu kiffen besorgen, klar.
Durch verschneite Straßen ging ich in Richtung Eimsbush Basement.