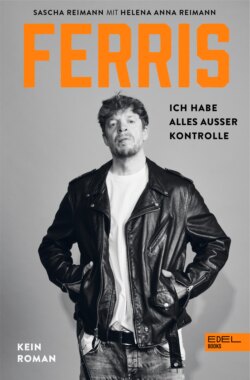Читать книгу FERRIS - Sascha Reimann - Страница 7
Ferris und der Überfall
ОглавлениеDie Floskel „Früher war alles besser“ trifft auf vieles zu – auf Tenever allerdings sicher nicht.
Heute ist das Hochhausghetto an der Bremer Peripherie mit 2650 Wohneinheiten, das den Stadtteil einst zum sozialen Brennpunkt und zum Ort der sozialen Ausgrenzung mit schlechtem Ruf machte, ein Vorzeigeprojekt der Stadtentwicklung – inklusive diverser Sozialkonzepte der zuständigen Ämter und Bezirksverwaltungen. Angeblich wurden auch die schäbigen Wohnungen baulich angemessenen Standards angepasst.
Ob die jetzigen Bewohner Tenevers von Lebensqualität und Wohlfühlfaktoren in ihrer Nachbarschaft sprechen würden, kann ich nicht beurteilen.
Für uns waren diese Attribute eines heimeligen Wohnumfeldes damals so weit weg wie der Mond. Es war einfach nur scheiße.
Absolut perspektivlos, vor allem für Kinder und Jugendliche. Obwohl sich unsere Lehrerinnen und Lehrer grundsätzlich durch ihre besonders phlegmatischen Veranlagungen auszeichneten, wurde uns in der Schule eindringlich davon abgeraten, in einem potenziellen Bewerbungsschreiben im Zuge der Bemühung um eine Lehrstelle unseren Wohnort beziehungsweise unsere Straße zu nennen. Auch nicht im Bewerbungsgespräch und am besten überhaupt niemals.
Alle, die ich kannte, wollten da weg – denjenigen, die dieses Ziel nicht verfolgten, war nicht zu trauen oder eh nicht mehr zu helfen.
Es war normal, zu dealen, zu klauen und von der Stütze zu leben und nebenbei noch den Staat abzuzocken, wo immer es ging – ich war mittendrin und leider keine Ausnahme.
Ebenfalls normal war, dass Menschen abrupt verschwanden, weil sie entweder im Knast saßen, umgebracht wurden oder aus dem Fenster sprangen.
Teilnahmsloses Schulterzucken, Empathielosigkeit, Gleichgültigkeit, Abgestumpftheit. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass jeder Mensch das Produkt seines Umfeldes sei, und ich glaube, das stimmt. Zumindest war es bei mir der Fall.
Oft habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, nicht hier, im Gammelghetto, sondern in einem netten Vorort aufzuwachsen. Mit Haus, mit Garten, mit allem Drum und Dran.
Während ich mich in eine heile Welt träumte, musste ich meine Realität akzeptieren, solange ich ihr ausgeliefert war.
Zu dieser Lebenswirklichkeit gehörte, dass ich im Alter von 14 Jahren einen festen Dealer hatte. Zwar hatte er nur Hasch und das auch nur in der denkbar miesesten Qualität, aber es gab nichts anderes. Er war nicht nett, noch nicht mal sympathisch, aber derzeit alternativlos.
Einige Jahre zählte ich zu seinen Stammkunden.
Mehrmals die Woche, je nach zur Verfügung stehendem Budget, besuchte ich ihn in seiner Wohnung im dritten Stock.
Eines Tages, mittlerweile war ich 19 Jahre alt, trug man mir zu, dass er gerade abgestochen worden sei. Ich hielt dies für ein Gerücht oder bestenfalls einen schlechten Scherz und machte mich auf den kurzen Weg zu seinem Wohnhaus.
Der Eingang ließ nichts Böses vermuten und so klingelte ich bei ihm. Stille. Ich bimmelte mich bei einem seiner Nachbarn rein und stieg die Treppen zu seiner Wohnung hinauf.
Die Tür war polizeilich versiegelt.
Am nächsten Tag konnten ich und der Rest der Nation den Tathergang in verschiedenen Zeitungen rekonstruieren. Unbekannte und bis dato nicht gefasste Täter hatten sich Zugang zu seiner kargen Behausung verschafft und mehrmals auf ihn eingestochen – mit wie vielen Stichen oder Tatwaffen, weiß ich nicht mehr. Ob sie es auf sein Geld und seine Ware abgesehen hatten oder sich für irgendetwas rächen wollten, blieb unklar.
Einen seiner beiden Hunde, einen Kampfhund, töteten die Mörder ebenfalls im schmalen Flur seiner Wohnung. Warum sie seinen Schäferhund am Leben ließen, wusste niemand.
Noch am Tag seiner Ermordung übernahm meine Nachbarin Biene den Hund sowie sämtliche Geschäfte des größten Dealers Tenevers.
Die völlig verlebte, vom Alkohol gezeichnete, alleinerziehende, knapp 30-jährige Mutter eines kleinen Jungen wohnte unter mir in der zweiten Etage. Der Kleine war im Sommer eingeschult worden und tat mir unendlich leid.
Nachdem sie nun also die zahlreichen Kiffer ihres Umfelds mit noch schlechterem Hasch versorgte als ihr Amtsvorgänger, spielte sich das soziale Leben in ihrer vom Staat finanzierten verdreckten Dreizimmerwohnung ab. Es wurde zu jeder Tages- und Nachtzeit Bong geraucht, gesoffen und gegrölt. Obwohl ich damals noch nicht zuverlässig richtig und falsch differenzieren konnte, spürte ich jedes Mal, wenn ich sie oder ihren traurigen Sohn sah, dass es einfach verkehrt war. Alles an ihr und ihrem Leben war verkehrt.
Durch meine Band F.A.B. hatte ich einen Grund, die allgegenwärtige Tristesse unserer Siedlung regelmäßig zu verlassen.
Mein Bandkollege Immo hatte das von mir ersehnte Glück, in einem Einfamilienhaus in einer feineren Gegend aufzuwachsen. Die Garage seiner Eltern war unser Proberaum.
Wir hatten seit der Erscheinung des Samplers Nordseite, auf dem wir vertreten waren, Auftritte in verschiedenen Clubs, unter anderem im angesagten Steintorviertel.
Ende 1994 erschien unser erstes Album Freaks und wir wurden zum festen Bestandteil der Bremer Szene, die sich in Kaschemmen wie der Lila Eule und der Capri Bar traf.
Mittlerweile waren wir bekannt wie bunte Hunde.
Durch diese Erweiterung meines Wirkungskreises ergab sich der Kontakt zu einer neuen Bezugsquelle. Ein entspannter, zurückhaltender und freundlicher Typ Ende 20, der sogar Gras und nicht nur Hasch feilbot. Er sprach mich an einem der Capri-Bar-Abende an und gab vor mir mit seinem ultraguten Weed an. Um mich, den allseits bekannten, bekennenden Marihuanaliebhaber, als Kunden zu gewinnen, baute er mir den leckersten Joint, den ich bislang geraucht hatte. Ich biss an.
Froh über diese Bekanntschaft konsultierte ich ihn regelmäßig und jammerte ihm bei jeder Gelegenheit vor, dass es in Tenever nur minderwertiges Hasch und schon gar kein Gras gebe. Er fragte mich, ob ich mir vorstellen könne, diese Lücke zu schließen.
Als ich dies bejahte, beschloss er, mir testweise 100 Gramm seines vorzüglichen Weeds auf Kris – auf Kredit – mitzugeben.
So wurde mein neuer Dealer zu meinem Pusher und ich zum Ticker.
Mein Freundeskreis, der zu 100 Prozent aus Kiffern bestand, wurde nun zu meinem Kundenkreis. Alle waren verrückt nach dem Weed aus dem Steintorviertel.
Wöchentlich besorgte ich mit dem Fahrrad Nachschub, wofür ich jeweils über drei Stunden unterwegs war.
Dass nun endlich Gras in der Nachbarschaft käuflich zu erwerben war, sprach sich schnell rum, und ich erhielt zahllose Kaufanfragen.
Da ich nach der Testphase beschloss, meinen Kundenstamm zu erweitern, um nicht bloß meinen Eigenbedarf decken, sondern tatsächlich etwas Geld verdienen zu können, kam mir dies gut zupass.
Ich gewährte mir Unbekannten nur auf Empfehlung Einlass in meine Wohnung im vierten Stock, die nun meine Geschäftsstelle war. So blieb mir wenigstens eine Illusion von Sicherheit, denn die meisten in Tenever lebenden Menschen waren schlicht nicht vertrauenswürdig.
Wie es so ist, kam irgendwann der Kumpel von einem Kumpel eines Kumpels – Boris.
Boris war mir von Anfang an nicht geheuer. Ein merkwürdig verschlagener Typ, an den ich nur sehr ungern verkaufte. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen.
Er war ein denkbar nerviger Kunde – zwar kam er relativ unregelmäßig, aber immer spät am Abend und nahm jeweils nur winzige Mengen ab.
Mehr als 20 Mark hat er nie dagelassen. So einen Kunden will kein Ticker.
Glücklicherweise war er seit geraumer Zeit hinter Gittern verschwunden und ich musste mich nicht weiter mit ihm auseinandersetzen.
Der Shop in meiner Wohnung war 24/7 geöffnet. Rund um die Uhr bot ich meine Dienste an, sofern ich zu Hause war. Das war mein unique selling point, und der zog.
Unter der Woche beendete ich in den letzten Zügen meine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, samstags schob ich Schichten an der Tankstelle und sonntags schuftete ich tagsüber in einer Lkw-Werkstatt.
Zum Leben reichten die Einnahmen nicht, das Amt bezuschusste meine Existenz.
Obwohl angehender Kfzler, war ich weder an Kraftfahrzeugen interessiert noch im Besitz eines Führerscheins. Alles war Mittel zum Zweck. Ich kloppte einfach mein Pensum durch und war heilfroh über jede Mark, die ihren Weg zu mir fand.
Der gesamte Stadtteil wusste mittlerweile, dass ich nicht nur die beste Qualität anbot, sondern auch den besten Preis. Die Marge war nicht hoch, der Gewinn kam über die abgesetzte Masse. Da ich – in der Hoffnung, zumindest in der Lkw-Werkstatt kündigen zu können – weiter expandieren wollte, kam ich auf die Idee, Biene zu beliefern.
Mehr Geld, weniger Arbeitseinsatz.
Was ich bei meiner Planung nicht bedachte: Sie wurde bereits von ihrem Macker versorgt. Naiv wie ich war, war mir nicht bewusst, dass ich ihm dadurch sein Geschäft versauen würde.
Da auch Biene eher unüberlegt handelte, nahm sie mir meine Haschplatten bereitwillig haufenweise ab. Nach ein paar Tagen rief sie mich an und sagte, ohne sich mit Begrüßungsphrasen aufzuhalten: „Du musst mal eben runterkommen. Jetzt.“
Als ich wenige Minuten später bei ihr klingelte und von ihr ins Wohnzimmer geleitet wurde, sah ich ihren Typen auf der speckig-weißen Ledercouch sitzen – ein Riese mit Oberarmen dicker als meine Oberschenkel, Glatze und aparten, selbst gestochenen Handtattoos, die damals verlässlich Ex-Knackis auswiesen.
Er sah aus wie eine Mischung aus Schwerstalkoholiker und Hells-Angels-Mitglied.
Wortlos zeigte er auf den ihm gegenüberstehenden noch speckigeren Sitzpouf und deutete mir so, dass ich mich zu setzen hatte.
Als dünner, blasser, bekiffter Freak, der ich nun einmal war, gehorchte ich abermals.
Bienes Macker beugte sich über den vollgerumpelten und fleckigen schwarzen Fliesentisch zu mir rüber und sagte fast flüsternd: „Hör mal zu, Kleiner – was du da machst, das macht man nicht. Das darfst du nicht.“
Ich verstand sofort, worum es ging. Natürlich, die Haschplatten.
„Glaub mir, ich will dir nicht ans Bein pissen“, fing ich an zu beschwichtigen und schwafelte sinnfrei: „Ich dachte, für euch hätte das auch Vorteile.“
Welche das sein sollten, ließ ich offen.
Für mich eine Topargumentation, er sah das anders.
„Quatsch mal keine Opern – dafür könnte ich dich wegmachen. Das verstehst du doch, oder? Ich sag es dir jetzt noch mal im Guten, weil Biene dich mag. Ich mache hier die Geschäfte und das wird auch so bleiben. Haben wir uns verstanden?“
Das taten wir, und ich entschuldigte mich sicherheitshalber betont kleinlaut und taperte in meine Wohnung zurück.
Von da an habe ich an Biene vorbeiverkauft, mehr denn je – schließlich musste die Einbuße, die ich durch das verlorene Geschäft mit meiner Nachbarin zu verzeichnen hatte, wieder eingespielt werden. Nicht meine beste Idee.
Parallel kam eine neue Mode auf – das systematische, bezirksübergreifende Abziehen von Dealern, umgangssprachlich „rippen“ genannt. Es waren verschiedene Gangs in Bremen, die diese Art der Beschäftigung zu ihrer Haupteinnahmequelle machten.
Sie alle konzentrierten sich vornehmlich auf Kleindealer, ließen sich aber auch von größeren Kalibern nicht abschrecken.
Ein Kleindealer hatte immer zwischen 500 und 1000 Mark im Haus. Sei es in bar oder in Form von Cannabisprodukten. Größere Dealer entsprechend mehr, viel mehr.
Je nach Häufigkeit der Überfälle also ein sich lohnendes Geschäft.
Ich baute darauf, dass mir das nicht passieren würde, da ich einen überwiegend vertrauenswürdigen Kundenkreis hatte – bis auf Boris, aber der war ja erst mal weg.
Mein Pusher hatte mich bei der letzten Abholung der Ware gewarnt, dass eine dieser Gangs auch schon bei ihm gewesen sei. Er hatte ein, für damalige Verhältnisse, ausgeklügeltes Sicherheitssystem an den Zugängen seines Wohnhauses angebracht und einen Überfall so vereiteln können.
Ich hatte so etwas nicht – bloß eine Tür aus Pressholz, bei der man beim Anklopfen befürchten musste, ein Loch hineinzuschlagen.
Die Wohnung, die vor ein paar Wochen noch meine eigene gewesen war, wurde nun auch durch meine damalige Freundin bewohnt. Mehr oder weniger ungefragt hatte sie sich bei mir eingenistet. Warum sie hier leben wollte, konnte ich nicht nachvollziehen.
Die Couch samt kniehohem Tischchen hatte ich genauso wie den stark nach DDR-Chic aussehenden Kleiderschrank vom Vormieter übernommen. Über dem Sofa hatte ich, als einziges Dekoelement meiner Bleibe, ein F.A.B.-Poster an die Wand geklebt.
Mein TV stand auf einer umgedrehten Holzkiste, die ich irgendwo gefunden hatte.
Ein Bett hatte ich nicht, meine Matratze lag in der als halbes Zimmer deklarierten Kammer neben der Küche auf dem Boden. Besonders wohnlich war es also nicht.
Meiner Ex-Freundin konnte man auch mit viel gutem Willen keine dieser berühmten weiblichen Fähigkeiten attestieren, die aus einem kläglichen Loch ein gemütliches Zuhause zaubern können. Da sie derzeit eine Ausbildung zum Maler und Lackierer machte – gendern war 1995 noch nicht angesagt –, hoffte ich, dass sie sich gestalterisch einbringen und wenigstens für ein bisschen mehr Behaglichkeit sorgen würde. Vergebens.
So hockten wir unter einer nackten Glühbirne auf der muffigen Couch, guckten Fernsehen und kifften, als mein schnoddergrünes Telefon gegen 23 Uhr klingelte.
Es war Boris, offenbar wieder auf freiem Fuß.
Das meiste meiner Ware hatte ich verkauft und nur noch einen kleinen Rest da, den ich eigentlich selbst rauchen wollte. Außerdem hatte ich keinen Bock auf Boris – aber 10 Mark waren 10 Mark, also sagte ich ihm, er könne vorbeikommen.
Am nächsten Tag wollte ich mich auf die Strampelreise zu meinem Pusher machen, um Nachschub zu besorgen.
Er gab mir immer genau 100 Gramm mit – erst wenn die umgesetzt waren, gab es mehr.
1100 Mark war die reguläre Ausbeute dieser herausgegebenen Menge, davon reinvestierte ich den Großteil in neues Weed, der Rest war meine Bezahlung.
Das eingenommene Geld sortierte ich sorgfältig in Bündel, stopfte sie in Gefrierbeutel und verwahrte diese in der Schublade meines DDR-Schranks.
Es klingelte und ich ging zur Gegensprechanlage. „Ja?“, fragte ich, meinen Finger auf den oberen der beiden Knöpfe pressend.
„Boris“, knarrte es als Antwort aus den Rillen hervor, ich drückte den Summer und machte schon mal die Wohnungstür auf.
Ich stand gebückt über der auf dem Couchtisch thronenden Schale voller Gras, um die Ration meines lästigsten Kunden zu entnehmen, als ich schwere Schritte im Flur vernahm – entweder hatte Boris im Knast ordentlich zugelegt oder er war nicht allein.
Als ich mich umdrehte, sah ich drei Männer im Rahmen meiner Wohnzimmertür stehen.
Keiner von ihnen war Boris.
Einer der drei sah ihm auf den ersten Blick verblüffend ähnlich – lange dunkle Haare, schwarzer Mantel, Reinschlagfresse. Dass ich mir Boris einmal herbeiwünschen würde, hätte ich nie gedacht.
„Was wollt ihr?“, fragte ich und ging auf sie zu. Als Antwort bekam ich eine Faust ins Gesicht. Von wem genau, konnte ich nicht sagen. Vor Schmerzen gekrümmt fiel mein Blick auf die Knarre, die der Nicht-Boris nicht besonders gut unter seinem Mantel verbarg.
Okay, es war ernst.
Als er bemerkte, dass ich seine Waffe registrierte hatte, gab er seinen Kumpanen ein Zeichen, woraufhin auch sie ihre Jacken so lupften, dass ich deutlich die in ihren Hosenbünden steckenden Schusswaffen erkennen konnte. Scheiße.
„Was ist hier los?“, fragte ich perplex. „Wo ist dein Gras, wo ist dein Geld?“, riefen sie durcheinander. „Sag schnell, dann sind wir weg.“
Aus einem mir im Nachhinein nicht mehr schlüssigen Grund versuchte ich zu pokern und sagte: „Ich habe nichts, hier ist nichts.“ Auf das Poster mit meinem Konterfei deutend rief ich: „Ich bin Musiker, kein Dealer! Da! Seht ihr? Das ist meine Band!“
Sie waren wenig beeindruckt. Der Nicht-Boris zog seine Waffe und schlug damit auf mein Gesicht ein. Ich ging zu Boden. Er traf mehrmals zielgenau Kiefer und Schläfe, ich spürte, wie Blut meine Wange herunterlief.
Meine damalige Freundin war aus ihrer Handlungsunfähigkeit erwacht, vom Sofa aufgesprungen und schrie: „Was soll das? Haut ab!“
Mutig, aber denkbar aussichtslos. Sie kassierte einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht und sagte von da an kein Wort mehr, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. Zum Glück.
Ich rappelte mich vom Fußboden auf und bat darum, die Frau in Ruhe zu lassen.
Gerade setzte ich dazu an, ihnen den Weg zu meinem Geld zu weisen, da kam einer der Männer mit meinem stramm mit Geldscheinen gefüllten Gefrierbeutel in der Hand aus dem Schlafzimmer. Eineinhalb Zimmer sind schnell durchsucht.
„Ich hab alles“, sagte er atemlos. Erneut traf mich die Waffe gekonnt auf die bereits aufgeplatzte Haut. „Das ist fürs Lügen!“, kommentierte der Nicht-Boris trocken seinen Schwinger.
Als ich wieder auf dem Boden meines Flurs kauerte, musste ich an meinen Dealer denken, dessen Mörder nie gefasst wurden. Nicht-Boris, augenscheinlich der Kopf der Bande, hockte sich lässig neben mich und ich hielt mir instinktiv die Hände vors Gesicht. Er griff nach ihnen, hielt mich am rechten Handgelenk fest und blickte mir fest in die Augen, als er bedrohlich leise sagte:
„Tja – wer illegal spielt, wird auch illegal gefickt.“
Ein cooler Actionthriller-Spruch, den er sich wahrscheinlich lange überlegt hatte, um ihn bei jedem seiner Raubzüge den Opfern mit auf den Weg zu geben. Zugegeben – er saß.
Mein Weed aus der Schale auf dem Couchtisch nahmen sie ebenfalls mit, obwohl ich bettelte: „Lasst mir doch wenigstens was zu kiffen da!“, aber sie lachten nur und rissen mein schönes Telefon aus der Wand, auf das ich so stolz war, weil es statt mit der üblichen Wählscheibe schon mit einer modernen Zahlentastatur versehen war.
Eine unnötige Aktion, da ich ja sowieso nicht die Polizei hätte rufen können.
Was hätte ich denn sagen sollen? „’n Abend, Reimann – ich verkaufe Gras, und drei Gangster haben mir gerade meine Wocheneinnahmen geklaut und mich gehauen. Zu Hilfe!“
Nein. Ich war völlig aufgelöst und versuchte, Erklärungen und Lösungen zu finden.
Boris, mein ungeliebter Teilzeitkunde, der Scheiß-Boris, der mir von Anfang an unangenehm gewesen war, hatte mich verraten. Aus dem Nichts, obwohl ich ihm nie etwas getan hatte. Wahrscheinlich hatte er ein bisschen Provision bekommen oder schuldete den drei Typen noch einen Gefallen. Oder war es doch jemand anderes?
Um einen halbwegs klaren Kopf zu bekommen und die abstrakten Szenen der letzten Minuten zu verdauen, wollte ich unbedingt kiffen. Meine Wohnung war bis auf den allerletzten Krümel geplündert – also musste ich wohl oder übel zu Biene.
Auf dem lächerlich kleinen Sitzpouf hockend erzählte ich ihr, was eben vorgefallen war.
So wie jeder andere der von mir im Nachgang Befragten hatte auch sie in dem endlos hohen Hochhaus, in dem wir alle dicht an dicht zwischen viel zu dünnen Wänden eingepfercht dahinlebten, nichts von alldem mitbekommen.
Nirgendwo lebt man anonymer als in einem Plattenbau.
Nirgends interessieren sich die Menschen weniger füreinander.
Niemand kennt jeden in einem 21 Stockwerke umfassenden Wohnhaus.
Keiner hat jemals etwas gesehen oder gehört.
Ich hasste diesen Ort mehr denn je.
Ihr Macker saß auf seinem ihm angestammten Platz auf dem Sofa und grinste in sich hinein. Sie gab mir ein bisschen von ihrem schlechten Hasch, und ich rauchte ein paar Köpfe, bis ich mich einigermaßen beruhigt hatte.
Nun hatte ich nicht nur kein Geld mehr, sondern auch Schulden bei meinem Pusher.
Wie sollte ich die abbezahlen? Wie sollte ich jetzt noch dealen können, wenn die Gang mich auf dem Kieker hatte?
Biene hatte keine Lösung, aber noch ein bisschen schlechtes Hasch.
Am nächsten Tag fuhr ich mit noch immer pochendem Schädel zu meinem Pusher ins Steintorviertel und erzählte ihm von dem Zwischenfall.
Er zeigte sich verständnisvoll und sagte, dass ich ihm ehrlich leidtäte und wir gemeinsam eine Lösung finden würden.
Ich setzte mich auf seinen zur kleinen Seitenstraße ausgerichteten Balkon und er drückte mir einen heißen Kaffee und einen Grasjoint in die Hand. Nachdem er mir meine Wunden mit einer wie die Hölle brennenden Tinktur desinfiziert hatte, beobachteten wir das müde Treiben des herbstlich verregneten Steintorviertels eine Weile und schwiegen.
Als ich wieder bei Kräften war und er den ersten Schock dieser für beide Seiten ungünstigen Nachricht verarbeitet hatte, beschlossen wir, dass ich fortan nur noch an meinen engsten Freundeskreis verkaufen würde, um peu à peu den Verlust abzutragen – auch wenn es so natürlich deutlich länger dauern würde.
Kurz nach dem Überfall trennte ich mich von meiner Freundin. Sie ging mir schon länger auf die Nerven. Mir ging alles auf die Nerven und sie somit mehr als je zuvor.
Ich wollte jetzt nur noch nach vorne blicken und nichts mehr mit meinem alten Leben zu tun haben. Alles kotzte mich an – die Wohnung, die Möbel, der Dreck, die Diskussionen.
Dass sie immer da war, wenn ich da war.
Wenn ich schon vom Leben dazu gezwungen wurde, noch weiter und auf unbestimmte Zeit mein Dasein in Tenever fristen zu müssen, dann wollte ich mir diese Zeit so angenehm wie möglich gestalten. Abends wollte ich Musik machen, feiern gehen, mit den Jungs abhängen und nicht streiten, was sie sehr gerne tat.
Ich wollte keine Beziehungskiste und Pärchen spielen. Für eine Freundin war kein Platz, schon gar nicht für eine, in die ich noch nicht mal verliebt war.
Andere und größere Ziele im Leben vor Augen habend schob ich als Grund für die Trennung die Musik vor. Letztendlich stimmte das ja auch irgendwie. Ich wollte sie nicht unnötig verletzen und vor allem keine dramatischen Szenen provozieren.
Glücklicherweise zeigte sie Verständnis. Auch ich war wohl nicht ihre große Liebe, und sie zog mit ihren wenigen Sachen direkt ohne weiteres Aufsehen aus, zurück zu ihren Eltern.
Sie kam nicht aus Tenever, also sahen wir uns nicht wieder.
Ich dealte meine Schulden ab und hangelte mich trockenes Toastbrot essend durch den Monat. Als ich den obligatorischen Gang zum Kontoauszugsautomaten ging, um zu checken, ob das Amt schon überwiesen hatte, sah ich auf der Habenseite eine drei mit vier Nullen dahinter und glaubte zu halluzinieren. Ich war mit 30 000 Mark im Plus.
Ich war reich! Endlich reich!