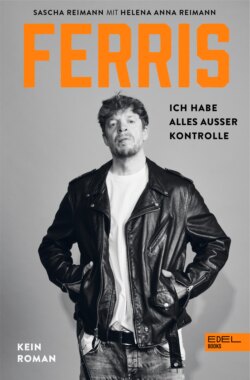Читать книгу FERRIS - Sascha Reimann - Страница 5
Ferris II Society
ОглавлениеWeihnachtsmarktgeruch waberte mir von der Alster aus entgegen. Warum bin ich da eigentlich noch nie gewesen? Am Heiligengeistfeld angekommen, entschied ich mich, querfeldein und nicht durch die vorweihnachtlich überfüllte Schanze zu laufen.
Grauweiße Weite, der schneebedeckte Bunker vor mir wie ein Berg.
Der Winterdom soll ja auch toll sein – da müsste ich eigentlich mal hin, dieses Jahr hatte ich ihn, wie jedes Jahr, verpasst. So unternehmungslustig kannte ich mich gar nicht. Schon komisch, was acht Tage nüchterne Freiheitsberaubung mit einer Existenz anstellen.
Mein Zeitgefühl wurde mir samt meiner Würde und meinem Gras bei der Einfuhr in den Knast abgenommen – keine Ahnung, wie spät es war, keine Ahnung, wie lange ich nach Eimsbüttel lief. Ich war so aufgekratzt, angespannt und gestresst, als hätte ich ein Gramm Koks auf ex gezogen. Gleichzeitig war ich komplett abgekämpft, ausgelaugt und entkräftet. Komische Mischung. Endlich bog ich in den Hinterhof ein, der mein Ziel beherbergte, hörte Beats von Tropf und Samys Stimme, als ich die Treppe zur Kellerwohnung hinabstieg.
Wie immer kam mir ein Odeur aus Weed, vollen Aschenbechern, vergammelten Pizzakartons und Mensch entgegen, als ich die Tür öffnete.
Meine versifften Klamotten und meine Angstschweißpatina ergänzten den typischen Basementgeruch sicherlich um eine ganz neue Note.
Ein paar Leute hingen auf Sofas ab – wer genau, kann ich nicht mehr rekonstruieren. Irgendjemand kam auf mich zu und stellte fest, dass ich noch fertiger aussehen würde als üblich. Danke.
Zumindest drückte mir dieser Jemand ein paar Tüten Gras in die Hand und ich ging.
Von vielen Köpfen in engen Räumen hatte ich vorerst genug. Ich schleppte mich zum nächsten Taxistand.
Meine Füße waren schneenass und taten weh, auf einmal hatte ich es eilig, zu Tobi und Jäki zu kommen. Vertraute Gesichter, endlich diesen abstrusen Film nacherzählen.
In Ruhe einen Joint rauchen, sitzen und ein bisschen die Augen zumachen, Handy aufladen.
Am Rathausmarkt waren alle für mich wichtigen Anlaufstellen unter einem Dach vereint.
Jäki hatte im ersten Stock sein Managementbüro, im zweiten Stock war der Sitz meines Plattenlabels Yo Mama Records samt dem sagenumwobenen Anrufbeantworter.
In der dritten Etage, unter dem Dach, hatte Tobi seine Ein-Zimmer-Studio-Wohnung.
Schwunglos hievte ich mich aus dem Taxi und quälte mich die Treppen zu Tobis Refugium hoch.
Tobi erwartete mich bereits – er hatte Joints vorgedreht und fein säuberlich auf dem Tisch aufgereiht. Cola und Eistee waren kalt gestellt. Woher wusste er, dass ich jetzt zu ihm kommen würde?
Wir umarmten uns, er überreichte mir ein Feuerzeug und präsentierte lächelnd wie die Glücksradfee die aufgereihte Spliffparade auf dem Couchtisch.
Zurücklehnen, rauchen – endlich.
Der Joint ballerte so krass wie zuletzt meine erste Zigarette, als ich neun Jahre alt war.
Ich kam nicht dazu, Tobi die ganze Geschichte zu erzählen, denn Jäki stürmte meinen Namen brüllend die Stufen zum Dachgeschoss hoch, riss die Tür auf und mich an sich wie einen verlorenen Sohn. Prankenklatscher auf Rücken, Schulter und Gesicht.
„Ferris! Gott sei Dank. Schnell, komm mit – wir müssen sofort zum Anwalt!“, rief er aufgeregt und bugsierte mich in ein wartendes Taxi vor der Haustür.
Auf der Fahrt zum Rothenbaum feuerte Jäki Informationsmunition ab – ich war nicht aufnahmefähig. Zu erschöpft, zu matt und zu breit. Was zur Hölle hatte Tobi in den Joint gemischt? LSD?
Mein Manager kam nicht viel fitter rüber, er schien sich wirklich Sorgen gemacht zu haben. Immer wieder patschte er väterlich mit seiner Tatze auf mein Bein. Er erzählte mir, wie seine vergangenen Tage ausgesehen hatten.
Nachdem ich mich zwei Tage nicht bei ihm gemeldet hatte und er mich nicht auf meinem Handy erreichen konnte, hatte er angefangen mich zu suchen.
Überall fragte er nach mir. Zwischenzeitlich dachte er, ich wäre nach Belas Party und dem einhergehenden Konsum durchgedreht und durchgebrannt oder würde wegen einer Überdosis tot auf irgendeinem schmutzigen Fußboden einer öffentlichen Toilette liegen.
Er ging zur Polizei, meldete mich als vermisst. Die Bullen haben ihm nicht gesagt, dass ich festgenommen wurde und in U-Haft saß. Warum nicht, bleibt bis heute das Geheimnis der Hamburger Ordnungsmacht.
Er klapperte Krankenhäuser ab.
Als ich verschwunden blieb, kontaktierte er meinen Vermieter, schilderte die Brisanz der Situation und verschaffte sich Zugang zu meiner Wohnung – als er sah, dass der Fernseher noch lief und überall Licht brannte, gab es für ihn nur zwei Optionen: Tod oder Knast.
Da er selbst nicht weiterkam, rief er den Anwalt Jens Schippmann zu Hilfe.
Dieser erhielt dann endlich die Information, dass ich in U-Haft säße.
Mein mir bis dato unbekannter Anwalt, einer der nettesten Menschen, denen ich je begegnet bin, hat es daraufhin geschafft, mich innerhalb von 24 Stunden aus dem Bau zu boxen.
Er forderte Akteneinsicht, stellte Unzulänglichkeiten bei der Begründung der Inhaftierung fest und drohte allen, die an meiner Inhaftierung beteiligt waren, sie in meinem Namen zu verklagen und das in der Presse öffentlich zu machen.
Er war mir auf Anhieb sympathisch.
Als wir in seiner schicken und sehr sauberen Kanzlei saßen, fiel mir auf, dass ich immer noch meine zum Himmel stinkenden Klamotten anhatte, was mir etwas unangenehm war.
Ihm die Hand zu reichen und mich bei ihm zu bedanken, bekam ich noch hin, dann sollten wir Platz nehmen, und ich spürte die gepolsterte Rückenlehne des Stuhls, auf dem ich zusammenklappte.
Mir wurde schwarz vor Augen. In meinem Kopf rauschte und pfiff es in allen erdenklichen Tonlagen.
Die volle Wirkung von Tobis Höllenjoint entfaltete sich und gab meiner ramponierten körperlichen Verfassung den absoluten Rest. Ein Glas Orangensaft und Stereozuspruch seitens Jäkis und Schippmanns später war das Ohrensausen weg und ich nahm die beiden wieder akustisch wahr, wenn auch dumpf.
Schippmann erklärte mir, dass ich nur verhaftet worden sei, weil ich mich seit meiner Flucht aus Bremen nach Hamburg nicht umgemeldet hatte.
Dass ich mich überhaupt mit einem Wohnsitz offiziell anmelden musste, war mir in dem Moment neu.
Mein Wohnsitz war nach den Akten immer noch die Wohnung meiner Mutter in Bremen, wo ich mit 16 Jahren ausgezogen war und somit seit zehn Jahren nicht mehr lebte.
Daher auch die angedrohte Verlegung in die Bremer Untersuchungshaftanstalt, über die ich mich so gewundert hatte.
Als ich 1996 über Nacht nach Hamburg gekommen war, habe ich zunächst bei Tobi am Rathausmarkt gewohnt.
Dieses eine Zimmer war auf Dauer für uns beide und die unzähligen Mäusefamilien, die wir jeden Tag mehrfach mit Schaufel und Besen nach ihrem stetigen Rattengiftgenuss entsorgen mussten, zu klein. Also zog ich in die WG eines Bekannten in die Spaldingstraße.
Die beiden Mitbewohner gingen mir relativ schnell auf den Keks, und ich bezog, nachdem ich mein WG-Zimmer binnen kürzester Zeit während unablässiger Kokainsessions augenscheinlich in eine Art Obdachlosentreff umgestaltet und somit letztlich völlig zerstört hatte, allein meine Wohnung in der Palmaille.
Nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, diese Umzüge zu melden.
Casus knacksus war, dass mir die Aufforderung zur Anhörung in einem Gerichtsverfahren gegen mich nicht postalisch zugestellt werden konnte. Da ich für die zuständigen Behörden nicht auffindbar war, wurde bereits 1997 ein Haftbefehl gegen mich ausgestellt.
Ende 1999 dann die Festnahme im Zuge der für mich folgenschwersten Verkehrskontrolle meines Lebens.
Keine Ahnung, was die Polizei, der Haftrichter und ihr Gefolge sich gedacht haben. Wahrscheinlich, dass Fluchtgefahr bestünde, weil ich in ihren Unterlagen als europaweiter Drogenhändler vermerkt war. Dass ich einfach jung, dumm und verplant war, zogen sie wohl nicht in Erwägung.
„Warte mal – was denn für ein Gerichtsverfahren?“, fragte ich meinen Anwalt.
Er erwiderte, ob ich mich noch daran erinnern könne, was 1995 in Landau passiert sei. Vage, ja. „Da hast du dich ganz schön in die Scheiße geritten“, sagte er kopfschüttelnd.
Beschissenes Bayern, aber dazu später mehr.
Ich wollte wissen, warum mich die Beamten in Santa Fu wieder rausgelassen hatten, wo doch seit mehreren Jahren ein Haftbefehl gegen mich in Umlauf war. Schließlich hatten die unsere Personalausweise für die Dauer des Gigs eingezogen und sie erst beim Verlassen des Geländes wieder ausgehändigt.
Schippmann lieferte die denkbar simpelste Antwort, auf die ich in den Knasttagen einfach nicht gekommen war: „Die haben die Ausweise nicht durchs System gejagt, sondern nur einbehalten. Wer betritt denn schon mit einem Haftbefehl im Nacken freiwillig einen Knast?“
Klar, schließlich wurde mir ja Vorsatz unterstellt.
Machte alles Sinn und irgendwie auch überhaupt nicht.
Meine Kapazität der Informationsaufnahme war längst überschritten. Ich wollte liegen, ich wollte kiffen, ich wollte essen. Mein Anwalt merkte, dass ich nur noch körperlich anwesend war, und bemühte sich, schnell zum Punkt zu kommen.
Ich musste ein paar Unterschriften leisten, er sagte mir, dass er in meinem Interesse Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung gegen mehrere Hamburger Justizbeamte erstatten wolle. Außerdem wollte er gegen den Haftrichter und weitere Justizbeamte Dienstaufsichtsbeschwerden erheben.
Alles, Diggi, alles. Noch nie bin ich so mies behandelt worden, das sollte nicht ungesühnt bleiben.
Funfact: Etwa 20 Jahre später orientierte sich meine Schwiegermutter beruflich neu und arbeitete zwischenzeitlich als Anwaltsgehilfin zufällig und ausgerechnet bei Jens Schippmann. Dass man sich im Leben immer zweimal sieht, scheint wohl zu stimmen. Außerdem ist die Welt klein und Hamburg ein Dorf.
Die von uns angestrebten Verfahren gegen die Justiz wurden jedenfalls schlussendlich fallen gelassen. Überrascht war ich nicht. Auch dieser Mob hält offenbar zusammen.
Die ganze Nummer hat mich dann 18 000 Mark Strafe an die Stadt Hamburg gekostet, plus ein hohes Anwaltshonorar an Schippmann, das Yo Mama vorerst bezahlte. Dafür ging ich aber sauber aus der Sache raus und galt als nicht vorbestraft.
Endlich waren wir wieder am Rathausmarkt. Jäki drückte mich noch mal an sich und sagte: „Aber macht nicht so doll heute“, bevor er mich zu Tobi in den dritten Stock entließ.
Wir wussten beide, dass es heute Abend komplett eskalieren würde.
Erst mal zu mir in die Wohnung zu fahren, um zu duschen, mich umzuziehen oder mich auszuruhen, kam mir nicht in den Sinn. Ich konnte und wollte nach dieser ganzen Nummer nicht allein sein und brauchte meinen besten Freund.
Nachdem wir ein paar Joints geraucht hatten, gingen wir, wie jeden Tag, zu unserem Lieblingsitaliener, der nur wenige Schritte von unserem persönlichen Basement entfernt lag. Die Joints knallten extrem rein und ich hatte noch immer heftige Erschöpfungserscheinungen.
Ich war schreckhaft, überreizt und verkrampft, gleichzeitig komplett zerschlagen, schlapp und unendlich müde. Schlicht und einfach durch mit der Welt.
Als ich über meinem Teller Nudeln saß, legte sich plötzlich eine Hand mit den Worten „Polizei, Sie sind festgenommen!“ auf meine rechte Schulter.
Ich dachte allen Ernstes, dass ich einen Herzinfarkt erleiden würde, so sehr habe ich mich erschrocken.
Dass es ein Kollege von Tobi war, der einen wahnsinnig lustigen Gag auf Kosten meiner körperlichen sowie mentalen Gesundheit machte, habe ich erst Minuten später richtig gecheckt. Ich hasse den Typen bis heute dafür.
Zum Glück haute er so schnell ab, wie er aufgetaucht war.
Tobi und ich gingen wieder in die Wohnung. Ich wollte mich schleunigst wieder ans Kiffen gewöhnen. Als mein Körper das THC nach dem unfreiwilligen Entzug aufs Neue als natürlichen Bestandteil des Blutkreislaufs begrüßte, bestellten wir Pizza und fingen an, Pillen zu schmeißen.
Nach der ersten Ecstasypille kam ich nach einer guten halben Stunde total drauf, der Flash setzte ein. Genau wie mein Brechreiz.
Mein geschallerter Körper kam nicht schnell genug in die Nähe eines Klos, eines Waschbeckens oder wenigstens gefliesten Terrains, und so hielt ich mir wenig sinnvoll die Hand vor den Mund.
Die Kotze schoss zwischen meinen Fingern in einem Schwall noch nie da gewesenen Ausmaßes literweise aus mir heraus. Eine Fontäne Unverdautes ergoss sich über die auf dem Couchtisch in Kartons servierten Pizzen, auf den Fußboden und das Sofa.
Ich drehte mich schnell zur Seite, was dazu führte, dass die Wand und die Tür ebenfalls ihre Portionen abbekamen.
Alles war voll, jedes Feuerzeug, jede Dose Cola, die zum Glück geschlossenen Kippenschachteln.
Ich selbst sah aus wie ein Kleinkind, das zum ersten Mal allein einen Fruchtzwerg gegessen hat.
Tobi konnte glücklicherweise schnell genug aufspringen, die Weedschale an sich reißen und ans andere Ende des Raumes fliehen.
Er lachte und holte routiniert eine Küchenrolle, um das Gröbste zu entfernen.
Das Schöne am Erbrechen auf Pille ist, dass der eingeschmissene Glücklichmacher danach erst seine volle Wirkung entfaltet. Ein herrliches Gefühl.
Darauf erst mal einen Joint.
Im Laufe der Nacht habe ich zehn Ecstasys eingeworfen und damit meine persönliche toxische Grenze mal wieder ein gutes Stück überschritten.
Irgendwann waren wir so breit, dass wir nicht mehr mitschnitten, welche Getränkedosen geöffnet und leer getrunken, also als Aschenbecher zu benutzen, und welche geöffnet und verzehrbereit waren.
Immer wieder aschten wir unsere Zigaretten und Joints wahllos in jenen Dosen ab und tranken Sekunden später aus ebendiesen. Unzählige Male spie einer von uns unter schwersten Flüchen ein wahlweise Eistee-Kippen- oder Cola-Jointrest-Gemisch durch den Raum, ohne Rücksicht auf möglicherweise tangierte Objekte oder Personen.
Nicht selten schluckten wir aus Versehen eine aufgeweichte Kippe oder einen gequollenen Filter. Selbst in diesem ekelhaftesten aller Fälle hatte keiner von uns den Impuls, die Dosen wegzuräumen oder wenigstens nach Bestimmung zu ordnen. Ein Teufelskreis.
Ich erzählte Tobi endlich von den letzten Tagen und Nächten.
Ich fragte ihn, was ich zuvor bei Jäki vergessen hatte: „Ist der Anrufbeantworter von Yo Mama kaputt?“ „Keine Ahnung“, antwortete Tobi, „die sind seit fast zwei Wochen im Weihnachtsurlaub.“
Ich verfiel in hysterisches Lachen, wie abwegig können Umstände bitte sein?
So etwas kann sich niemand ausdenken, diese abstrusen Anekdoten schreibt ausschließlich das Leben selbst.
Jäki hatte Tobi natürlich auf dem Laufenden gehalten, was Schippmanns Bemühungen anging, mich aus dem Bau zu holen – deswegen hatte er auch gewusst, dass ich auf jeden Fall irgendwann heute bei ihm aufschlagen würde, sodass er diese kleine Willkommensparty hatte vorbereiten können.
Wir redeten und konsumierten die Nacht durch, bis wir aussahen wie zwei Zombies, die sich als Tobi und Ferris verkleidet hatten.
Die Sonne ging über der Alster auf, es war der Morgen des 24. Dezembers.
Da war es also, Weihnachten.
Ich bin sowieso ein heller, nordischer Typ – aber in diesem Moment war ich kalkweiß.
Nein, vielmehr leichenblass mit Augenringen bis nach Mexiko und körperlichen wie textilen Ausdünstungen jenseits gesellschaftlich tolerierbarer Ausmaße.
Völlig verstrahlt latschte ich am späten Vormittag vom Rathausmarkt in Richtung Hauptbahnhof, um nun doch nach Bremen zu fahren. Nicht in den Knast, sondern zum Feiertagspflichtbesuch bei meiner Mutter.
Im Nachhinein kann ich kaum glauben, dass ich noch immer die vor Dreck starren Klamotten anhatte und keinerlei Anstalten machte, diesen Zustand zu ändern.
Im Bau selbst – nüchtern – hat es mich total belastet, diese gammeligen Sachen jeden Tag tragen zu müssen.
Jetzt, endlich wieder zu breit für die Teilnahme an der Lebenswirklichkeit, war es mir scheißegal. Auch dass sich andere Fahrgäste im ICE umsetzten, als ich das Großraumabteil betrat, ging mir komplett am Arsch vorbei.
Meiner Mutter fiel nicht auf, dass mein allgemeiner Zustand bedenklicher war als sonst.
Ich hatte keinen Bock, ihr von den Ereignissen zu erzählen, dazu war ich zu drauf und zu übernächtigt. Ich hing wie ein Schluck Wasser in der Kurve bei ihr im Wohnzimmer und wartete, bis wir Weihnachten zu Ende gefeiert hatten und ich mich um 16 Uhr mit dem Zug zurück nach Hamburg begeben konnte.
Als ich schließlich zu Hause war, duschte ich zum ersten Mal seit dem Waschtag im Knastspaßbad. Die verkommenen Klamotten schmiss ich direkt in den Müll, zog einen Jogginganzug an und haute mich auf die Couch.
Mit einiger Verspätung konnte ich nun meinen ursprünglichen Plan des Abends der Festnahme umsetzen – liegen, kiffen, TV glotzen.
Auch jetzt baute ich wieder Chemie ab, mein System fuhr runter. Für einen Moment war mir, als hätte ich meine Wohnung nie verlassen, als wäre das alles nicht passiert, und wenn, dann nur in meinem Kopf.
Ich schlief kurz ein, träumte wirr, wachte auf und kiffte weiter. So ging es bis zum nächsten Morgen, dem 25. Dezember 1999. Gänzlich lädiert machte ich mich am frühen Abend auf den Weg zur lang angekündigten X-MAS Jam.
Teilen der Mongo Clikke war ich schon immer suspekt. Mein Alter Ego, der Freak Ferris, und der fertige Sascha aus Bremen waren ein und dieselbe Person.
Es gab keine Grenze, nirgends. Ich kannte keine Grenzen.
Rückblickend muss ich eingestehen, dass ich eine wahnsinnig nervige Person gewesen sein muss. Immer drauf, immer breit, immer auf Anschlag, absolut unzurechnungsfähig.
Ich habe wahnsinnig übertrieben, die Übertreibung war mein Lifestyle.
Als ich im Venue der X-MAS Jam aufschlug, wussten natürlich alle von meinem Knastaufenthalt. Auch wenn ich freundlich begrüßt wurde, merkte ich, dass es einigen endgültig gegen den Strich ging, wie kaputt ich war.
Jemanden wie mich kannten sie nicht. Ich war für sie schon immer der Sonderling, der „Trainspotting-Typ“. Ich war mein eigenes Klischee.
Sie wussten schlicht und einfach nicht mit mir umzugehen. Nun erst recht nicht mehr.
Ich war sozial nicht kompatibel, sondern im wahrsten Sinne asozial.
Ich hatte keine Eltern, denen ich es recht machen wollte, keine Verantwortung für niemanden außer mich selbst, und ich selbst war mir auch ziemlich egal.
Während meines Auftritts habe ich wohl irgendeinen Spruch abgelassen, in dem ich dem Publikum die Vorzüge des Kokainkonsums näherbrachte und den Rat erteilte, im Falle des Falles einfach mal ne Nase zu ziehen.
Ein Musiker aus dem Umfeld der Mongo Clikke ist daraufhin backstage komplett ausgeflippt und meinte, mich hierfür zur Rechenschaft ziehen zu müssen.
Immer wieder schrie er: „Das sind Kinder da draußen! Kinder!“, und ich lachte ihn aus.
Mit Moral durfte man mir nicht kommen. Ich fragte ihn, was denn bitte schön „Kinder“ um 22 Uhr auf einem Konzert zu suchen hätten? Und das auch noch an Weihnachten?
Ohne eine Antwort abzuwarten, sagte ich ihm, dass er die Fresse halten soll, und ging.
Die folgenden zwei Tage verschanzte ich mich zu Hause. Das Runterkommen vom weihnachtlichen Flash dauerte länger als erwartet.
Ich wollte einfach nur Ruhe, niemanden sehen. Das Dreieck meines Daseins in unendlichen Bahnen nachzeichnen – liegen, kiffen, TV glotzen.
Mein Körper spulte sämtliche Programme zur Liquidierung der ihm zugeführten Synthetik durch. Herzrasen, kalter Schweiß und Schüttelfrost auf der einen, extreme Sensibilität, Irrationalität und blank liegende Nerven auf der anderen Seite.
Meine Verfassung nagte an meinem Ich. Zur Beruhigung versuchte ich, möglichst viel Gras zu rauchen, härtere Drogen konnte ich in diesem Zustand nicht zu mir nehmen.
Der Zehnpillentrip reichte meinem Körper vorerst, er war offenbar noch beschäftigt.
Leider wurde mir vom Kiffen übel, was mich sehr beunruhigte.
Mein Magen zog sich bereit zur Entleerung immer wieder zusammen, aber es kam nichts heraus.
Emotional am Ende hatte ich ständig einen Kloß im Hals.
Als ich zufällig in den Film Ein Hund namens Beethoven auf RTL zappte, bekam ich einen Weinkrampf. Ich konnte mich nicht mehr einkriegen. Die Schleusen waren auf.
Als die Tierfänger es doch noch schafften, diesen riesigen sabbernden Bernhardiner zu schnappen, brach meine Welt ganz und gar zusammen. Ich heulte, ich schluchzte, ich war vollkommen aufgelöst.
Tränenüberströmt zwang ich mich – gegen den Willen meiner Magenschleimhaut, zugunsten meines schwachen Nervenkostüms –, den gebauten Joint in meiner Hand aufzurauchen, und schlief auf dem Sofa ein.
Gegen drei Uhr morgens weckte mich meine erste Panikattacke. Die erste von vielen.
Ich schreckte keuchend auf, das Licht war aus, der Fernseher lief und mir flirrte irgendein 80er-Jahre-Kung-Fu-Film entgegen.
Nach Luft ringend stolperte ich zum Fenster und öffnete es. Da ich im siebten Stock des 23 Etagen emporragenden Hochhauses in Altona lebte, ließen die Fenster sich nicht vollständig aufreißen, sondern maximal auf Kipp frischen Sauerstoff hinein.
Ich dachte an Frau Doktor und den Kartoffelsack.
Um möglichst großen Nutzen aus dem zur Verfügung stehenden Minispalt zu ziehen, klebte ich mit einer Wange an der Glasscheibe und schnappte nach Atemluft wie ein kränkelnder Fisch. Ich sah die Lichter des Hafens, die als liebevoll gestaltete Weihnachtsdekoration direkt in meine schmutzige Bude leuchteten. Wieder kamen mir die Tränen.
Was da mit mir passierte, konnte ich nicht einordnen. Noch nie hatte ich etwas von dieser Form der körperlichen Reaktion auf die seelische Verfassung gehört.
Da ich sowieso davon ausging, irgendwann einfach durchzuknallen, dachte ich, nun sei es so weit.
Ich hyperventilierte, mein Kreislauf kackte ab, ich glaubte, sterben zu müssen.
Wie beim vorherigen Heulfluss war auch hier keine Beruhigung der Situation in Sicht.
Die Attacke zog sich gefühlte Stunden hin.
Wider Erwarten überlebte ich. Die Panik war weg, die Angst aber blieb.
Ich entwickelte eine handfeste Angststörung. Nicht die Art Angst, ob ich den Herd ausgeschaltet oder die Haustür abgeschlossen habe – einfach Angst, pure Angst, körperlich spürbare, nicht einzuordnende Angst.
Später gesellten sich noch Stimmen im Kopf dazu. Vor allem meine eigene, die mir eine Frikadelle ans Ohr quatschte, was ich als besonders skurril empfand.
Es war offiziell, ich hatte so richtig einen an der Klatsche.
Allein sein konnte ich nicht mehr. Ich hing nur noch mit Tobi und der Clique ab, schlief auf seiner Couch, zog quasi wieder bei ihm ein.
Ich war ein Wrack und habe andere Menschen nur noch am Rande und verschwommen wahrgenommen. Eigentlich hätte ich mir in dem Moment professionelle Hilfe suchen müssen.
Eine Freundin hatte ich nicht, ich wollte keine. Für Frauen war kein Platz in meinem Leben, das sich nur um mich selbst, meine Karriere und meinen Drogenkonsum drehte.
Natürlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Beziehungen hinter mir – sie alle haben mich nur angestrengt. Und ich war selbst gerade anstrengend genug.
Aus dieser diffusen und allgegenwärtigen Angst heraus beschloss ich, von heute auf morgen mit dem Kiffen aufzuhören.
Ein kläglicher Versuch, der nach wenigen Stunden scheiterte.
Ich wurde komisch, ich wurde zu einer merkwürdigen Person. Ich blieb auf dem Trip hängen.
Wie ich das von allen heiß ersehnte Millennium, das Silvester überhaupt, erlebte – ich weiß es nicht mehr. Die Erinnerung daran ist einfach weg.
Wahrscheinlich hockte ich zusammengekauert auf Tobis Sofa, froh, Stimmen zu hören, die nicht in meinem Kopf, sondern tatsächlich real waren.
Vielleicht war ich aber auch allein zu Hause und bin mit einer Panikattacke ins frisch angebrochene Jahrtausend gestartet.
Frohes Neues!
Ach so, die Belegschaft von Yo Mama Records tauchte irgendwann nach den Feiertagen wieder in ihrem Büro auf und hörte auf mein Geheiß hin den verdammten Anrufbeantworter ab.
Salven der Entschuldigung ergossen sich.
Hinfällig.
Ich hatte mittlerweile ganz andere Probleme.