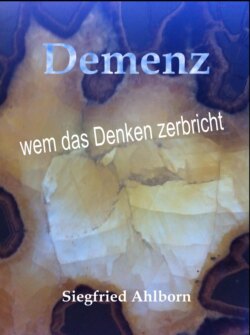Читать книгу Demenz - Siegfried Ahlborn - Страница 3
Das unheimliche Gesicht
ОглавлениеDas Chaos der Dunkelheit meines Geistes begann, als ich mich – mit meinem Bruder aus dem Theater kommend – verlief.
Ich hatte nur das Auto holen wollen und befand mich plötzlich an einem mir völlig fremden Ort. Wo war ich? Wo war mein Bruder? Was wollte ich hier?
Ich schaute auf mein Handy, um zu sehen, wo ich mich befand. Aber ich erkannte es nicht. Es zeigte mir nicht das gewohnte Bild und gab mir Worte und Zeichen in einer völlig fremden Sprache. Panik erfasste mich. – Und das war der Moment, wo ich ihm die Tür geöffnet haben muss. Ihm, dem Fremden, dem Chaos, dem Gesicht.
Unbewusst muss ich ihm Zutritt zu mir gewährt haben, denn mit Bewusstsein hätte ich es nicht getan. Er war erschreckend in seinem Ausdruck und unheimlich in seiner Präsenz. Ich sah es nur kurz – sein drohendes Gesicht – aber es hinterließ in mir eine unergründliche Angst. Ich wusste, dass es mich ab jetzt verfolgen würde. Er war gekommen, um mich zu töten.
Aber wem gehörte das Gesicht? Wer wollte meinen Tod? Was war das für ein Wesen? Ein Mensch? Ein Dämon? Oder einfach nur ein Gesicht, das mich, wie durch eine dunkle Wand hindurch, anschaute – nur kurz, aber lange genug, um mich bis ins Mark hinein zu erschrecken?
Plötzlich war mein Bruder wieder da und fragte mich, wo ich bleibe – und das Gesicht war verschwunden. Aber ich war gewarnt. Kampflos wollte ich mich nicht ergeben. Ich fragte meinen Bruder, ob er das Gesicht auch gesehen habe.
„Ein Gesicht? Was für ein Gesicht?“ fragte er.
Ich winkte ab. „Es war wohl nur eine Einbildung“, sagte ich.
„Ja, wahrscheinlich nur eine Einbildung. Komm, lass uns nach Hause fahren!“
Wir fuhren nach Hause und sprachen auch nicht mehr darüber. Aber zu Hause angekommen, fragte er mich, ob er mir noch helfen könne – und das gefiel mir nicht: Ich hatte doch nur ein Auto vergeblich gesucht… Also verabschiedete ich ihn und bat ihn, sich keine Sorgen zu machen, es sei ja nur eine Einbildung gewesen.
Auch ich wollte mir keine Sorgen mehr machen. – Und doch ging ich am nächsten Morgen dorthin zurück, wo ich das Auto gesucht hatte, denn ich glaubte nicht wirklich an eine Einbildung. Ich wollte Spuren von ihm, dem Fremden, finden.
Woher hatte er gewusst, dass ich dort sein würde? Und warum hatte er sich mir nur so kurz gezeigt? Wollte er mich quälen, bevor er mich umbrachte? Und warum überhaupt, wollte er mich umbringen? Das waren Fragen, die ich klären musste.
Jetzt war aber nichts zu sehen. Die Sonne schien und beleuchtete den Parkplatz, wo das Auto gestanden hatte – und die Mauer des Parks, hinter der mir das Gesicht erschienen war.
Hinter ihr blühten die schönsten Blumen und die Bäume standen im ersten Grün. Die Vögel sangen, und es war eine Stimmung, als wollte die Göttin Natura selbst zur Erde herniedersteigen. – War das wirklich die Mauer, die mir Angst gemacht hatte? War das der Park des unheimlichen Fremden?
Ich schaute über die Mauer in den Park und konnte doch nichts entdecken. Außer einer junge Frau, die vor einem Beet mit Frühlingsblumen kniete. Durch ein Tor der Mauer näherte ich mich ihr. Sie hörte mich kommen, erhob sich, und wandte sich mir zu. Sie hatte ein jugendlich hübsches Gesicht, dunkle Augen und dunkles, langes Haar.
Sie schaute mich erstaunt an und ich war beschämt, mich ihr genähert zu haben. Aber ich hatte das deutliche Gefühl gehabt, mich ihr nähern zu müssen. Sie lächelte und ich lächelte. Dann sagte ich:
„Entschuldigen Sie bitte, gestern Abend war ich hier und habe ein Gesicht in diesem Garten gesehen. Können Sie mir sagen, ob es hier einen Gärtner, oder einen sonst irgendwie Verantwortlichen gibt?“
Sie schüttelte den Kopf und schaute mich nachdenklich an: „Sind Sie sicher“, fragte sie, „dass es ein Mensch war und keine Einbildung?“
„Ja“, sagte ich, „Es war jemand, der mir schaden wollte.“
„Doch, doch“, bekräftigte sie. „Es muss eine Einbildung gewesen sein. Hier ist sonst niemand.“
Aber da war es plötzlich wieder, das Gesicht. Es erschien hinter ihr in der Hecke und lauerte mich an. Ich schrie auf und muss sehr verängstigt ausgesehen haben, denn sie fragte besorgt: „Kann ich Ihnen helfen.“
„Schauen Sie doch!“ sagte ich, und deutete auf die Hecke hinter ihr.
Sie schaute sich um, stutzte kurz, und schüttelte dann den Kopf.
„Haben Sie ihn gesehen?“ fragte ich.
„Nein!“
„Dann schauen Sie bitte noch einmal. – Sehen Sie ihn jetzt?“
„Nein!“
Aber ich sah ihn auch nicht mehr und musste klein beigeben. Da sagte sie plötzlich:
„Ich habe zwar von einem Entflohenen in der Zeitung gelesen, aber da war nichts. Was hat solch ein Gesicht hier auch zu suchen, wo nur die Frühlingsschönheit sprechen darf. Empfinden Sie denn diese Schönheit nicht?“
„Sie haben von einem Entflohenen gelesen?“ harkte ich nach.
„Ja, schon“, beschwichtigte sie, „ein Mörder soll entflohen sein – aber da war wirklich nichts. Ich hätte es ja auch gesehen. Also bitte, schauen Sie doch nur einmal diese schönen Beete hier, sehen Sie denn diese Schönheit nicht?“
„Schon, ja, aber nicht mit diesem Gesicht!“
„Das tut mir leid für Sie. Dann können Sie die Schönheit wirklich nicht sehen. Sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann.“
„Ich brauche keine Hilfe“, murmelte ich, denn mittlerweile fand ich diese Situation unerträglich. Ich kam mir vor, wie in einem Wald voller Vögel, die alle durcheinander zwitscherten. Irgendwie wollte mein Kopf nicht … Ich brauchte eine Antwort auf die Frage, warum ich ins Visier des Bösen geraten war, und wer den Auftrag bekommen hatte, mich zu töten, und nicht den Hinweis auf die Schönheit der Natur. Also wandte ich mich von ihr ab und lief, ohne anzuhalten und ohne zurückzuschauen, nach Hause.
Zu Hause angekommen bemühte ich mich zu rekonstruieren, wo ich mich in den letzten Tagen aufgehalten hatte, und welche Wege ich gegangen war. Vielleicht ließ sich ein Anhaltspunkt finden. Vielleicht hatte ich irgendeine Warnung übersehen. Vielleicht war ich schon lange beobachtet worden.
Ich überlegte und überlegte, aber immer wieder wurde ich von meinen wild irrlichtelierenden Gedanken abgelenkt und konnte mich nicht konzentrieren.
„Ihr müsst mal zusammenbleiben, um aufeinander zu hören“, sagte ich laut zu meinen eigenen Gedanken. Aber ich schaffte es nicht. Ich brauchte Hilfe, die Hilfe eines Sherlock Holmes, eines Menschen, der die Gedanken zusammenhalten konnte und im Ergreifen einer Idee die Wahrheit fand. Und ich wusste auch schon, wer dafür infrage kam.