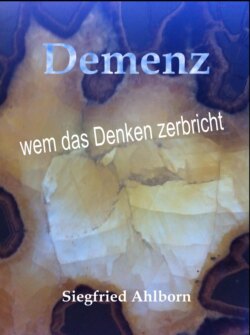Читать книгу Demenz - Siegfried Ahlborn - Страница 6
Die Begegnung mit dem Mörder
ОглавлениеAls ich das Kloster verließ, hatte ich das Gefühl, einen Sherlock Holmes gesucht, und einen Mönch gefunden zu haben. Aber dieser Mönch, so gestand ich mir, hatte mir etwas ganz Entscheidendes mit auf den Weg gegeben: Einen Hinweis auf einen Raum, in welchem ich mich selbst finden konnte. - Ich spürte wohl, wie wichtig das war.
Aber eines fragte ich mich doch: Gab es nun keinen Mörder mehr, der auf mich lauerte? War das fremde Gesicht wirklich nur mein eigenes?
Mit dem Verlassen der Klostermauern, kamen auch die Zweifel wieder. Aber nicht nur die, auch die hübsche Frau war wieder da, die ich im Garten bei dem Parkplatz getroffen hatte – und an die ich mich jetzt, Gott sei Dank, wieder erinnerte.
Sie bog gerade um die Ecke, als ich den Weg vom Kloster nach Hause einschlug.
„Hallo!“ begrüßte sie mich. „Geht es Ihnen besser? Haben Sie den Menschen, zu dem das Gesicht gehört, gefunden?“
Ich blieb stehen und überlegte, was ich ihr antworten sollte. „Ja, ich habe ihn gefunden“, sagte ich nach einigem Zögern.
„Und?“ fragte sie gespannt.
„Ich bin es selbst.“
Sie schien mit dieser Antwort gerechnet zu haben, denn sie nickte und sagte: „Dann brauchen Sie ja auch keine Angst mehr zu haben.“
Wieder zögerte ich. War das so? Brauchte ich wirklich keine Angst mehr zu haben? Nein, das war nicht so. Denn ich war ja noch gar nicht wirklich überzeugt, dass das Gesicht nicht vielleicht doch einem Fremden gehörte. Da war etwas in mir, was mich noch immer sehr beunruhigte.
„Wollen Sie darüber sprechen?“ fragte sie, als habe sie meine Gedanken gelesen.
„Sind meine Gedanken so einfach zu lesen?“ fragte ich erstaunt, und sie lachte.
„Ja, Sie sollten mal Ihr Gesicht sehen.“
„Dann werde ich es ab jetzt verstecken“, sagte ich, war ihr aber nicht böse, denn sie war mir sehr sympathisch.
„Dann kommen Sie“, sagte sie spontan. „Gehen wir etwas trinken.“
Wir gingen die Straße herunter, und da es mittlerweile Abend geworden war, waren die Kaffees an der Straße hell erleuchtet. Wir suchten uns eines aus und setzten uns an einen Tisch am Fenster einander gegenüber. Aber ich fühlte mich nicht wohl, denn ich hatte das Gefühl, dass das schreckliche Gesicht jederzeit hinter der nächsten Ecke wieder auftauchen könnte.
„Darf ich Sie fragen, wie Sie heißen?“ fragte ich. Und sie antwortete:
„Mein Name ist Margarethe Schuhmann, und wie heißen Sie?“
„Johannes Müller.“
Da kam der Kellner und wir bestellten unsere Getränke. Und als sie serviert waren, wusste ich schon nicht mehr, welchen Namen sie mir genannt hatte.
Ich kramte in meinem Gedächtnis, ging alle Buchstaben des Alphabetes durch und kam doch nicht darauf. Das wiederum schadete meiner Aufmerksamkeit ihr gegenüber, und plötzlich hatte ich sogar Angst, sie selbst aus meiner Wahrnehmung zu verlieren.
Da half sie mir scheinbar unbewusst aus der Misere, denn sie berichtete freizügig von ihrer Familie, nach der ich sie wohl gefragt hatte, und so fiel der Name Schuhmann und ich erinnerte mich wieder.
Jetzt war ich etwas gelöster und verglich ihren Namen mit dem, was ich an den Füßen trug. Sie fragte mich nach meiner Familie und dann danach, wann ich zum ersten Mal das fremde Gesicht gesehen habe. Sie mache sich Sorgen, sagte sie, weil sie tatsächlich an einen Massenmörder denke, von dem die Zeitungen berichtet hätten.
Ich hatte nichts dergleichen gelesen und blieb ruhig – zumal ich ja auch von Bruder Aurelius gelernt hatte, dass das Gesicht in meinem eigenen Denken zu suchen war. Aber durch ihre Bemerkungen wurde ich doch auch wieder unsicher. Außerdem war es so schön spannend, mit ihr darüber zu sprechen.
„Warum sollte er ausgerechnet mich umbringen wollen?“ fragte ich.
„Vielleicht ein Zufall“, meinte sie und fügte – mich aufmerksam beobachtend – hinzu. „Ein Zufall, dass Sie ausgerechnet an der Mauer des Parks auftauchten, wo er sich verstecken wollte.“
„Ja“, sagte ich und fühlte das Unheimliche.
“Und wie gehen Sie jetzt weiter vor?“ wollte sie wissen.
Ich zuckte mit den Schultern. Da lachte sie plötzlich aus vollem Halse.
„Wissen Sie, was ich glaube“, sagte sie dann, nachdem sie sich etwas beruhigt hatte. „Ich glaube, dass...“
Da blieben ihr die Worte im Halse stecken. Sie schaute zur Tür und wurde leichenblass. Denn eben kam ein kleiner, mittelalter und untersetzter Mann herein, ging schnurstracks zur Theke und setzte sich.
„Das ist er“, flüsterte sie entgeistert. „Ich habe ein Phantombild gesehen.“
Ich schaute mich vorsichtig um und sah, dass er nicht zu uns herüber schaute. Er hatte wenig Haare und ein – von der Seite her gesehen – brutales Gesicht.
„Soll ich die Polizei rufen?“ flüsterte sie, und kramte in ihrer Tasche nach ihrem Handy. „Nicht hier“, flüsterte ich zurück. „Er könnte es hören.“
„Dann müssen wir unauffällig bezahlen“, sagte sie leise und versuchte sich bei dem Kellner bemerkbar zu machen. Doch als dieser endlich schaute, und sie ihn bat bezahlen zu dürfen, schaute auch der mutmaßliche Massenmörder zu uns herüber.
„Er ist es nicht“, flüsterte ich. „Nicht mein Gesicht. Dieses Gesicht habe ich noch nie gesehen.“
Da stand er auf, nahm sein Glas und kam an unseren Tisch. Wir saßen wie gelähmt. Ohne ein Wort zu sagen, rückte er sich einen Stuhl zurecht und setzte sich zu uns.
Dann fixierte er meine Begleiterin stumm und sagte nach einer geraumen Weile:
„Sie haben mich erkannt, nicht wahr?“
Frau Schuhmann rührte sich nicht. Er wartete und wandte kein Auge von ihr, bis sie zaghaft nickt. Dann sagte er:
„Das ist nicht wahr, was die schreiben. Ich war es nicht. Das Bild sieht mir nur ähnlich.“ „Dann ließe sich das doch bei der Polizei rasch aufklären“, mischte ich mich vorsichtig ein. Und Frau Schuhmann ergänzte ebenso behutsam: „Sie haben dann ja auch bestimmt ein Alibi.“
„Genau das ist es doch“, sagte er, fast etwas zornig. „Ich kann mich an nichts mehr erinnern.“
Wir schauten uns betroffen an.
„Ja“, sagte er, „eine gewisse Zeit meiner Vergangenheit ist wie ausgelöscht.“
„Aber dann könnten Sie es ja doch auch gewesen sein und wissen es nur nicht mehr“, sagte ich nachdenklich und bekam einen furchtbaren Schreck. Ich spürte plötzlich Ähnlichkeiten zu mir. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, etwas getan oder erlebt zu haben, an das ich mich nicht mehr erinnerte.
Frau Schuhmann aber war rationaler und sagte mit ruhiger Stimme: „Dann haben Sie vielleicht so etwas wie eine Amnesie – oder Demenz. Ich bin in der Sozialhilfe tätig und habe viel mit dementen Menschen zu tun. Ich glaube auch, dass das immer häufiger wird.“
Wir schauten sie beide erstaunt an und der Fremde sagte:
„Dement bin ich bestimmt nicht, aber eine Art Amnesie liegt bei mir vor.“
„Und was war der Auslöser Ihrer Amnesie?“ fragte Frau Schuhmann.
Der Fremde schüttelte den Kopf. „Das weiß ich nicht“, sagte er leise und fügte nachdenklich hinzu: „Vielleicht meine Frau.“
„Die eigene Ehefrau soll der Mörder zuerst getötet haben“, sagte Frau Schuhmann jetzt wieder sehr leise und mit belegter Stimme. „Was war denn mit Ihrer Frau?“
Der Fremde wurde unruhig. Er versuchte sich an etwas zu erinnern, was ihm aber scheinbar nicht gelang. Er schaute uns mit großen Augen an und sagte:
„Ich weiß es nicht.“
So saßen wir eine Weile still und angespannt beisammen, als plötzlich die Tür aufflog, zwei Männer hinzu sprangen, den Fremden an unserem Tisch packten, ihm Handschellen anlegten und hinausführten. Das ging so schnell, dass man kaum folgen konnte. Dann setzte sich ein Mann zu uns an den Tisch – es war der Kommissar – und fragte:
„Was haben Sie mit ihm zu tun?“
„Nichts“, antworteten wir wie aus einem Munde, und Frau Schuhmann erklärte:
„Ich hatte ihn nach dem Phantombild erkannt und wollte die Polizei rufen. Doch da kam er zu uns an den Tisch und behauptete er sei unschuldig. Er könne sich aber an nichts mehr erinnern, denn er habe eine Amnesie.“
„Das wird sich aufklären“, sagte der Kommissar. „Würden Sie mir bitte Ihre Personalien geben?“
Wir zeigten unsere Ausweise und er machte sich Notizen. Dann verließ er uns.
„Das ist ja mal ein Abenteuer“, sagte ich. „Jetzt sind wir in einen Kriminalfall verwickelt. – Dachte dann aber wieder an mich selbst und meine Not und sagte: Aber mich beunruhigt, was Sie von der Demenz sagten.“
„Das ist gut“, reagierte sie spontan und ehrlich. „Sie müssen in dieser Richtung achtsam sein.“
Ich schaute sie erstaunt an.
„Ja“, sagte sie. „Erinnern Sie sich an unsere erste Begegnung?“
„Vage“.
„Sehen Sie. Da hatte ich schon den Eindruck einer aufkommenden Demenz bei Ihnen. Ihr Verhalten sprach dafür.“
„Welches Verhalten?“ fragte ich und bekam Angst. Sie war ja, wie sie sagte, mit solchen Sachen vertraut – und auch der Mönch hatte solche Andeutungen in seinen Worten gehabt.
„Sie zeigten mir eine gewisse Verwirrtheit“, sagte sie.
„Soll ich Ihnen jetzt dankbar oder böse sein?“
„Seien Sie mir ruhig dankbar“, sagte sie lächelnd. „Wenn es nicht stimmt, werden Sie es mir hoffentlich verzeihen, und wenn es stimmt, werden Sie mir dankbar sein.“
„Und was ist, wenn es nun stimmt?“ wollte ich wissen.
„Dann müssen wir etwas tun, dann müssen Sie etwas tun. Denn noch ist es Zeit. So wie ich das beurteile, beginnt es bei Ihnen gerade erst.“
Ich schluckte und schwieg. Sie hatte recht. Es war wirklich so, dass mir in letzter Zeit vieles abhandengekommen war. Könnte es vielleicht sogar sein, dass auch ich ein Mörder war und es nur nicht mehr wusste? „Dein Denken zerbricht“, hatte Bruder Aurelius gesagt. War bei mir das Denken im Begriff zu zerbrechen?
„Ist bei mir das Denken im Begriff zu zerbrechen?“ fragte ich meine Begleiterin. Sie schaute mich erstaunt an und überlegte:
„So habe ich das noch nicht gesehen. Aber man könnte es vielleicht so nennen. Ich selbst aber würde sagen, dass sich das Denken lähmt.“
„Bruder Aurelius riet mir zu reimen.“
„Bruder Aurelius. Wer ist das?“
„Ein Mönch, von dem ich vorhin gerade kam.“
„Und er hat Ihnen geraten zu reimen?“
„Ja, er meinte, dass ich auf diese Art meine Gedanken zusammenhalten könne. Ich habe auch etwas gereimt. Aber fragen Sie mich nicht was.“
„Er meinte vielleicht, dass Sie durch das Reimen lernen könnten, ihr Denken selbst zu bestimmen. Dann verliert man es nicht mehr so schnell.“
„Ja, aber er hat das natürlich noch – wie es seiner Stellung entspricht – mit dem Göttlichen verbunden, mit einem Engel.“
Sie schaute mich eine Weile nachdenklich an und sagte dann: „Die Demenz ist ein Verlust des eigenen Selbst. – Man könnte folgendes reimen:
Was ist, wenn wir uns selbst entfliehen?
Wenn wir die Zeit, die wir gelebt,
Nicht mehr auf uns und unser Selbst beziehen.“
„Dann sind wir – laut Bruder Aurelius – nicht mehr in der Lage Außenwelt und Innenwelt zu verbinden“, sagte ich. Er gab mir die Meditation: Ich erkenne mich im Licht. Er meinte, dass ich mit dieser Meditation mich selbst im Bewusstsein erhalte.“
Sie war begeistert und strahlte: „Genau das habe ich gesucht. Die Menschen, die ich täglich betreue, haben diesen Selbstverlust und sind entweder nach außen oder nach innen wie gelähmt.“
„Das verstehe ich nicht“, sagte ich.
„Bedenken Sie doch“, erklärte sie und lehnte sich über den Tisch: „Manche meiner Patienten können lesen, verstehen aber das Gelesene nicht, weil sie das Gelesene in ihrem Selbst nicht reflektieren können. Und andere erleben sich selbst und können nicht mehr lesen. Sie haben sich selbst und verlieren die Welt. Sie sind also entweder nach außen oder nach innen wie gelähmt, und eine Verbindung wie im: Ich erkenne mich im Licht, fehlt ihnen. – Aber, entschuldigen Sie, in welchem Licht eigentlich?“
„Im Licht des Denkens.“
„Genau: im Licht des Denkens. Ja, das verstehe ich. Im Licht des Bewusstseins weiß man immer, wer man ist, und kann sich weder nach innen, noch nach außen verlieren.“
„Und ich will mich nicht verlieren“, sagte ich, und sie antwortete wie aus der Pistole geschossen: „Eben, deswegen haben Sie ja diese Meditation bekommen.“
Ich schwieg und ging in mich. Konnte ich mich wirklich mit diesen wenigen Worten retten? Langsam begann ich zu verzweifeln. So viele gute Ratschläge – von ihr, vom Mönch, und keiner konnte mir die Angst und die Unsicherheit wirklich nehmen.
„Mit der Theorie alleine ist es allerdings nicht getan“, sagte Frau Schuhmann plötzlich. Sie schien selbst unsicher geworden zu sein und sagte therapeutisch – gütig: „Vielleicht probieren Sie es einfach weiter aus. Ich auf jeden Fall finde es einen guten Ansatz.“
Dann drängte sie darauf zu gehen, denn es war schon spät geworden und sie musste früh raus, wie sie sagte. Also verabschiedeten wir uns und verabredeten uns für Ende der Woche. Dann würde sie mir sagen können, was ihr zu der Behandlung der Demenz noch eingefallen ist.
„Alles Theorie“, sagte ich auf dem Weg nach Hause vor mich hin. „Alles Theorie.“
Aber vor dem Schlafen meditierte ich doch noch einmal den Satz: Ich erkenne mich im Licht, und konzentrierte mich auf das, was ich an diesem Tage alles erlebt hatte. Ich fügte es rückwärtsgehend aneinander – und schlief darüber ein.