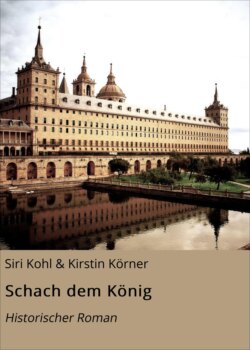Читать книгу Schach dem König - Siri Kohl & Kirstin Körner - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеWenige Wochen nach der Hochzeit war der König wiederum ausgesprochen guter Laune, doch der Grund war ein anderer. Der Krieg mit Frankreich, den Karl V. bereits einmal für sich entschieden, den die Franzosen jedoch wieder begonnen hatten, war dank des umsichtigen Vorgehens des Herzogs von Alba und des niederländischen Grafen Egmont, die das spanische Heer anführten, so gut wie gewonnen. Nach den schweren Niederlagen der Franzosen bei St. Quentin und Gravelines konnte Philipp nun in absehbarer Zeit mit erfolgreichen Friedensverhandlungen rechnen.
„Wenn Egmont und Alba weiterhin solche Erfolge erzielen, wird der Krieg in zwei Monaten beendet sein, und dann wird Frankreich es nie wieder wagen, spanischen Besitz anzutasten!“ triumphierte Philipp eines Nachmittags, während er es sich in den Gemächern seiner Schwester Juana in einem Sessel bequem machte.
Juana, eine kleine, attraktive Frau mit den blonden Haaren und blauen Augen der Habsburger, sah ihn aufmerksam an. „Vor allem wird dann dieses unnötige Gemetzel aufhören, das dir nichts bringt als ungeheure Ausgaben und das Blut zahlloser Soldaten an deinen Händen.“
Philipp murmelte seine Zustimmung. Immer wenn seine Schwester auf dieses Thema kam, sah er wieder das Schlachtfeld von St. Quentin vor sich, der einzigen Schlacht, an der er jemals teilgenommen hatte. Der Geruch nach Blut und Tod, der Anblick der grausam zugerichteten Leichen und die Schreie der vergebens um Hilfe rufenden Verwundeten hatten sich ihm unauslöschlich eingebrannt. Ja, er hasste den Krieg, und er war überzeugt, dass Krieg führen keine gottgefällige Tätigkeit war – doch handelte er nicht noch viel weniger gottgefällig, wenn er Spanien, den Hort des einen wahren Glaubens, nicht gegen seine Feinde verteidigte? Ein König musste manchmal Kriege führen, das war er seinem Reich schuldig; und sein ruhiges Gewissen war der Preis, den er für die Erfüllung seiner Pflicht zahlen musste.
„Hast du dir schon Gedanken über die Friedensverhandlungen gemacht?“ fragte Juana. „Es wird nicht reichen, einem Friedensvertrag nur dein Siegel aufzudrücken, du wirst ihn auch durch persönliche Bindungen festigen müssen.“
Philipp sah sie mit hochgezogener Augenbraue an. „Du meinst heiraten?“
Juana legte lächelnd den Kopf zur Seite. „Zum Beispiel.“
„Hmmm – dann müsste ich meine englischen Heiratspläne aufgeben...“ Philipp strich sich nachdenklich durch den Bart, eine Geste, die er sich seit seiner Rückkehr aus den Niederlanden angewöhnt hatte und die ihm ein sehr staatsmännisches Aussehen verlieh. Elizabeth I., Mary Tudors Halbschwester, war die Frau der Stunde in England. Vom Volk geliebt und von den unter Mary unbarmherzig verfolgten Protestanten zu ihrer Schutzherrin erkoren, hatte die Tochter Heinrichs VIII. und Anne Boleyns eine lebensgefährliche Kindheit verbracht. Einige Male wäre sie fast wegen Ketzerei angeklagt worden, und sogar Haft im Tower hatte sie über sich ergehen lassen müssen. Philipp hatte während seines Aufenthalts in England dafür gesorgt, dass Elizabeth an den Hof zurückkam, da er fürchtete, ihre schlechte Behandlung würde das englische Volk noch tiefer spalten, als es die Religionsfrage bereits getan hatte.
Die hoch gebildete, charismatische junge Frau, die sechs Sprachen – darunter Spanisch – fließend beherrschte und deren messerscharfer Verstand die meisten ihrer Diskussionen mit Philipp für sich entschieden hatte, hatte den König fasziniert, und er hatte im Gespräch mit seinem Beichtvater zugeben müssen, dass Begehren keine geringe Rolle bei dieser Faszination spielte. Er wusste, dass er für Elizabeth wichtig war: Philipp hatte sie es zu verdanken, dass sie nun auf dem englischen Thron saß und nicht auf einem Scheiterhaufen, und er war es auch, der ihren Thron gegen die Katholiken im eigenen Land und gegen die Ansprüche ihrer katholischen, mit dem französischen Thronfolger verheirateten Cousine Mary Stuart stützen würde. England war schließlich Spaniens wertvollster Verbündeter gegen Frankreich, und die englische Krone in französischer Hand war, das wusste Elizabeth, Philipps schlimmster Alptraum.
Diese Überlegungen hatten letztendlich dazu geführt, dass Philipp ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte – jedenfalls hatte er sich erfolgreich einreden können, dass lediglich politische Überlegungen ihn dazu bewogen hatten. Doch die englische Königin hielt ihn hin; sie nahm die Religionsfrage – Philipp hatte von ihr verlangt, zum Katholizismus überzutreten, bevor sie ihn heiratete – zum Anlass, sich monatelang zu zieren und sich mit ihrer Abhängigkeit von ihren protestantischen Anhängern herauszureden. Unsinn, dachte Philipp gereizt; wenn sie erst mit ihm verheiratet wäre, würde sie keine enttäuschten Anhänger mehr zu fürchten haben... Elizabeth schien zu glauben, er sei hoffnungslos in sie verliebt und würde wie ein gehorsamer Hund auf ihre Entscheidung warten, doch in diesem Punkt täuschte sie sich. Philipp von Spanien wartete nicht ewig, vor allem dann nicht, wenn die Gefahr eines eventuellen französischen Mitbewerbers um Elizabeths Hand durch einen Friedensvertrag mit Frankreich entschärft werden konnte.
Er unterbrach seinen Gedankengang und stellte entschieden fest: „Aber da sich Elizabeth in nächster Zeit offenbar ohnehin nicht für einen Gatten zu entscheiden gedenkt, hat sie es sich selbst zuzuschreiben, wenn ich einer anderen den Vorzug gebe!“
„Es kränkt dich, dass sie deinen Antrag nicht sofort angenommen hat, nicht wahr?“ fragte seine Schwester.
„Nun ja...“
Juana schnitt ihm ein wenig spöttisch das Wort ab. „Ich kann dich ja verstehen. Man lässt den Herrscher der halben Welt nicht einfach warten.“
„Ich fühle mich nicht als König gekränkt“, erwiderte Philipp unwillig.
„Oh. Höre ich da etwa Anzeichen von enttäuschter Liebe?“ Juana war ehrlich überrascht.
Philipp schien die Antwort nicht leicht zu fallen. „Ich liebe sie nicht, aber ich...“
„Du warst der Meinung, du würdest sie ebenso leicht erobern wie all die anderen, und musstest dann leider feststellen, dass es auch Frauen gibt, die dir widerstehen können.“
„Touché, Schwesterherz“, stellte Philipp mit schiefem Lächeln fest.
Juana legte ihre Hand auf sein Knie. „Dann gebe ich dir einen guten Rat: Vergiss Elizabeth von England und wirb um Elisabeth von Valois.“
Philipp überlegte. Die Tochter des französischen Königs war ihm von mehreren Seiten als ungewöhnlich schön beschrieben worden, und eine enge Verbindung mit Heinrich II. von Frankreich war der einzige Weg, dem bevorstehenden Friedensschluss Dauer zu verleihen. Andererseits galten die Frauen der Familie Valois aber als wenig widerstandsfähig und zu Fehlgeburten neigend. Und eine Heirat mit Elisabeth würde noch einen anderen Nachteil haben... „Ich soll mir Caterina de’ Medici als Schwiegermutter aufhalsen?“ fragte er und sah Juana zweifelnd an. „Du weißt, dass ich sowohl an meiner körperlichen wie auch an meiner geistigen Gesundheit hänge, also ist das wohl keine allzu gute Idee.“
Seine Schwester lächelte beschwichtigend. „Du müsstest ihr ja nicht einmal begegnen, Philipp. Zur Hochzeitszeremonie kannst du einen Stellvertreter nach Paris schicken, und hierher wird sie sicher nicht kommen. Sie hält Spanien sowieso für rückständig und voll von Barbaren.“
Wieder strich sich Philipp durch den Bart. „König Heinrich wäre allerdings ein so wertvoller Verbündeter, dass ich diese italienische Giftmischerin an seiner Seite wohl in Kauf nehmen muss... Nun ja, ich werde deinen Vorschlag in Erwägung ziehen, wenn die Friedensverhandlungen begonnen haben.“ Er sah auf die Uhr auf dem Kaminsims und stand auf. „Aber jetzt muss ich gehen. Der Botschafter des Kaisers hat für heute um eine Audienz gebeten.“
„Das Leben eines Königs hat eben auch seine Nachteile“, bemerkte Juana mitfühlend. „Sehe ich dich nachher beim Essen?“
„Wahrscheinlich – da Ruy Gómez es ja vorzieht, mit seiner Gattin zu speisen, werde ich mir wohl anderweitig Gesellschaft suchen müssen.“
„Ich werde dich erwarten.“
Philipp grinste. „Und ich werde versuchen, pünktlich zu sein.“
Tief in Gedanken verließ der König die Gemächer seiner Schwester. Als er den Vorsaal durchquerte, stand ihm plötzlich eine junge Frau gegenüber, die eine prunkvolle Robe in der Hand hielt und offensichtlich zu Juanas Hofdamen zählte. Sie erkannte den König sofort und versank in einem tiefen Knicks. „Majestät.“
„Erhebt Euch“, erwiderte Philipp gedehnt, während er sie unauffällig musterte. Sie mochte etwa zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig Jahre alt sein und hatte eine sehr frauliche Figur, deren Reize auch ihr hochgeschlossenes, mohnrotes Kleid nicht vollständig verbergen konnte. Ihre rotbraunen Haare erinnerten Philipp unwillkürlich an Elizabeth von England, und als die junge Frau sich wieder aufrichtete, stellte er fest, dass sie grüne Augen hatte, also der englischen Königin auch hierin glich. „Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Wie ist Euer Name?“ fragte er.
„Doña Eufrasia de Guzmán, Majestät.“ Die Guzmáns waren eine der bedeutendsten, reichsten und wohl auch sittenstrengsten Familien des Landes.
Philipp lächelte leicht und küsste der errötenden Eufrasia die Hand. „Ich bin erfreut, Euch kennenzulernen. Ihr dient meiner Schwester?“
„Ja, ich war gerade auf dem Weg zu ihr.“
„Würdet Ihr mir die Freude machen, Eure Schritte anschließend in meine Gemächer zu lenken?“ Erst während er sprach, wurde Philipp sich darüber klar, dass er soeben beschlossen hatte, diese Frau zu verführen. Er hätte nicht einmal sagen können, was ihn dazu bewogen hatte; zwar hatte er schon länger nicht mehr in den Armen einer Frau gelegen, aber er war inzwischen in der Lage, sein Verlangen zu beherrschen, also konnte der Grund nicht darin zu suchen sein. Nein, es war, wie er sich innerhalb von Sekundenbruchteilen eingestand, der einfache Wunsch, wieder einmal seine Wirkung auf Frauen zu erproben. Würde er Eufrasia dazu bringen, sich ihm hinzugeben, oder würde sie den Vorschriften der Sitte und ihres Amtes bei Hofe folgen und ihn abweisen?
Eufrasia reagierte auf seine Frage zunächst überrascht. „Wieso...“ Sein Blick wurde anzüglicher, seine Augen verfehlten ihre hypnotisierende Wirkung auch jetzt nicht, und plötzlich begriff sie. Sie errötete. „Oh, Ihr meint...“
„Durchaus!“ unterbrach er sie mit süffisantem Lächeln.
Eufrasias Wangen begannen zu glühen, und Philipp sah ihren Entschluss in ihren Augen, bevor sie sprach. „Ich werde da sein...“
Eine Viertelstunde später hörte Philipp, der den kaiserlichen Botschafter auf den nächsten Tag hatte vertrösten lassen, wie sich die Tür seines Arbeitszimmers öffnete. Aus dem dunklen Schlafzimmer, in dem er saß, konnte er sehen, wie Eufrasia zögernd eintrat, hinter sich die Tür schloss und sich suchend umsah. Sie hatte bereits zwei Knöpfe ihres Kleides geöffnet, was ihre Reize auf atemberaubende Weise zur Geltung brachte.
Philipp stand geräuschlos von seinem Stuhl auf, trat in die Schlafzimmertür und räusperte sich leise. Das Geräusch ließ die junge Frau erschreckt herumfahren. Sie sah ihn mit kaum verborgener Angst an und wartete, dass er sprechen würde; durch sein Schweigen verunsichert, fragte sie schließlich: „Seid Ihr sicher, dass...“
Philipp ließ sie nicht ausreden, sondern zog sie an sich und küsste sie. Sie erwiderte seine Zärtlichkeiten mit großer Leidenschaft, aber er spürte dennoch ihre Unsicherheit und begriff mit einem Mal, dass er ihr erster Mann sein würde. Gemeinsam sanken sie auf sein Bett, und in den nächsten Stunden tat Philipp alles, um Eufrasia ihren gewagten Entschluss nicht bereuen zu lassen.
Seit ihrer Hochzeit waren Ana und Ruy ständig unterwegs, denn Ruy hatte von Philipp nicht nur Ländereien in Italien und den Titel eines Fürsten von Eboli, sondern auch ein großes Landgut bei Pastrana und den dazugehörigen Herzogstitel als Ehrung erhalten, und der König hatte ihm auch das Geld zum Bau eines großzügigen Familiensitzes geschenkt. Doch da Ruy sich häufig in Toledo oder Valladolid am Hof einfinden musste, ging erstens der Bau meist ohne ihn voran und kam zweitens das Landleben, das er so gern genossen hätte, etwas zu kurz.
Ana fühlte sich bei Hofe durchaus wohl, doch sie verbrachte nach wie vor viel Zeit zuhause im Familienschloss der Mendozas, denn nach einigen Tagen in den Hauptstädten des Reiches oder in Pastrana vermisste sie stets ihre Fechtlektionen mit Marinelli. Sie hatte oft erwogen, ihren Vater zu bitten, den Italiener aus seinen Diensten zu entlassen und ihr damit die Möglichkeit zu geben, ihn nach Pastrana zu holen, aber sie wusste, wie sehr Diego de Mendoza nicht nur Marinellis professionelles Können, sondern auch seine Intelligenz und Bildung schätzte, die ihn zu einem angenehmeren Gesprächspartner machten als die zwar nicht ungebildete, aber doch eher profaneren Dingen als Ovid und Vergil zugewandte Dorotea.
So kam es für Ana überraschend, als Marinelli sie eher beiläufig während der Waffenkontrolle nach einer Fechtstunde fragte: „Für wie gut haltet Ihr mich, Doña Ana? Als Fechter, meine ich.“
Ana legte verwundert den Degen beiseite, den sie in der Hand hielt. „Ich glaube nicht, dass ich Euer Können fachmännisch beurteilen kann, Luigi. Für mich seid Ihr der beste Fechter der Welt!“
Marinelli runzelte die Stirn. „Meint Ihr, ich könnte einen König unterrichten?“
Auf Anas Züge trat ein verstehendes Lächeln. „Daher weht der Wind, Ihr möchtet an den Hof! Glaubt Ihr denn, dass mein Vater Euch gehen lässt?“
„Nun ja, ich habe mir neulich ein Herz gefasst und mit ihm über meinen Wunsch gesprochen, und nachdem ich meine gesamte Überredungskunst aufgeboten hatte, hat er mir erlaubt, in König Philipps Dienste zu treten. Vorausgesetzt, der König will mich einstellen.“
Er zögerte, doch Ana sah ihm an, dass er noch etwas auf dem Herzen hatte. „Und?“ fragte sie nachdrücklich. „Ihr wollt mich bitten, am Hof ein gutes Wort für Euch einzulegen, nicht wahr?“
Marinelli grinste erleichtert. „Ihr habt es erraten, Señora.“
„Warum so schüchtern, Luigi? Ihr wisst doch, dass ich das gern für Euch tun werde. Ich nutze die erste Gelegenheit, um Euch Philipp zu empfehlen, versprochen!“
Ana hielt Wort. Sobald sie nach Toledo zurückgekehrt war und ihr Reisegepäck in Ruys Stadthaus untergebracht hatte, suchte sie den Alcázar auf und betrat Philipps Gemächer. Anders als sonst an Nachmittagen war er nicht in seinem Arbeitszimmer anzutreffen, sondern spazierte in Gedanken versunken auf der Galerie des Innenhofes auf und ab, die von grazilen maurischen Bögen getragen wurde und dem wuchtigen Äußeren des Alcázar so gar nicht entsprach.
Philipp schrak aus seinem Gedanken auf, als Ana ihn ansprach. „Gar nicht bei der Arbeit, mein König?“
Der unwillige Gesichtsausdruck wurde zu einem erfreuten Lächeln, als Philipp erkannte, wer ihn gestört hatte. „Oh, ich arbeite unablässig, Doña Ana! Gerade habe ich eine Antwort auf die Protestnote des französischen Gesandten entworfen, der sich darüber beschwert, dass ich die ketzerische Königin von England so offen unterstütze.“
„Ihr habt weder Feder noch Papier noch einen Schreiber bei Euch, um die Antwort zu verfassen. Seid Ihr sicher, dass Ihr nicht eher einen kleinen Spaziergang gemacht habt?“ fragte Ana lächelnd.
„Ich pflege über meine Worte gründlich nachzudenken, bevor ich sie zu Papier bringe. Nicht umsonst genieße ich den Ruf, äußerst langsam zu sein, was das Abfassen von Depeschen und ihre Versendung angeht.“
„Es freut mich, dass Ihr auf dem Thron noch die Selbstironie besitzt, die Ihr als Infant hattet“, sagte Ana, während sie überlegte, wie sie das Gespräch ohne einen allzu abrupten Übergang auf Marinellis Anliegen bringen könnte.
„Seid Ihr nur gekommen, um das herauszufinden, oder kann ich Euch bei etwas anderem behilflich sein?“ fragte Philipp, als hätte er ihr Dilemma geahnt.
Ana zögerte zum Schein einige Sekunden, bevor sie antwortete: „Ja, vielleicht... Wie zufrieden seid Ihr eigentlich mit Eurem derzeitigen Fechtmeister, mein König?“
Philipp ließ ein unwilliges Knurren hören. „Ich glaube, ganz Kastilien weiß, dass Don Pedro de Riveira ein Stümper ist, oder? Mein Vater hat ihn eingestellt, weil er ein Günstling Herzog Albas ist, und ich behalte ihn aus Pietät gegenüber dem verstorbenen Kaiser in meinen Diensten, aber er ist schlicht und einfach ein Haudegen, der von wirklicher Fechtkunst nichts versteht, wenn Ihr mich fragt. Kein Vergleich zu seinen Vorgängern!“
Ana beschloss, auf Philipps Stimmung einzugehen und einen direkten Angriff zu führen. „Habt Ihr jemals von Luigi di Marinelli gehört?“
„Nein, müsste ich?“
„Nun, erstens ist er Euch bei Eurem Besuch auf dem Schloss meiner Eltern damals vorgestellt worden, aber ich verzeihe Euch, dass Euer Namensgedächtnis mitunter an Überforderung leidet.“ Sie lächelte maliziös, als sie Philipps entnervten Blick sah, der so viel besagte wie „Doña Ana, ich regiere die halbe Welt, da kann ich mir nicht jeden einzelnen Namen merken, den ich höre“. Rasch fuhr sie fort: „Aber zweitens ist er auch der Fechtmeister meiner Familie, der sich überglücklich schätzen würde, seine bescheidenen Fähigkeiten – die meiner Meinung nach gar nicht so bescheiden sind – in die Dienste des Königs stellen zu dürfen.“
Philipp zögerte kurz. Dann fragte er: „Luigi di Marinelli – aus welcher Gegend Italiens stammt der Mann?“
„Er kommt aus Mondragone bei Neapel. Angeblich hat er schon mit fünfzehn Jahren die besten Fechter Italiens besiegt.“
„Neapel? Ihr empfehlt mir allen Ernstes einen Neapolitaner als Fechtmeister?“
„Warum nicht?“
„Habt Ihr vergessen, dass es noch vor wenigen Jahren in Neapel fast einen Aufstand gegen die spanische Herrschaft gegeben hätte? Wer garantiert mir, dass dieser Marinelli nicht eines Tages auf die Idee kommt, eine nicht abgestumpfte Waffe zu benutzen und mich aufzuspießen?“
Ana verschlug es vor Überraschung für einige Sekunden die Sprache. „Ihr... Das glaube ich einfach nicht! Luigi – ich meine, Signor di Marinelli hat jahrelang in unserem Haus gelebt und meinem Vater, einem der bedeutendsten Adligen Spaniens, Fechtunterricht erteilt. Er hätte tausendmal die Gelegenheit gehabt, meinen Vater umzubringen, wenn er wirklich einen solchen Hass auf die Spanier hätte, wie Ihr ihm unterstellt! Warum seid Ihr nur so misstrauisch?“
Philipps Züge wurden von einer Sekunde auf die andere hart. „Weil ich dieses Reich nicht als Toter regieren kann, Doña Ana. Und weil es zu viele Menschen auf dieser Welt gibt, die mir einen qualvollen Tod wünschen.“
Sie spürte, dass hier mit ihm nicht weiter zu reden war. In versöhnlichem Ton sagte sie deshalb: „Aber meint Ihr wirklich, ich würde Euch Marinelli empfehlen, wenn ich dächte, dass er eine Gefahr für Euch sein könnte? Gebt ihm eine Chance, mein König: Lasst ihn Euch in meinem Beisein eine Probestunde geben. Ich verbürge mich mit meinem Leben für seine Vertrauenswürdigkeit.“
Philipp dachte einige Zeit nach. Dann begann er zu lächeln, und Ana wusste, dass sie gewonnen hatte. „Ich nehme Euer Angebot an. Wenn ich Euch, der Frau meines besten Freundes, nicht vertrauen kann, wem dann?“ Er nahm ihre Hand und hauchte galant einen Kuss auf den Handrücken. „Ich stehe zu Eurer und zu Signor di Marinellis Verfügung. Morgen Nachmittag um diese Zeit?“
„Oh! Sagtet Ihr nicht vorhin, Ihr würdet unablässig arbeiten, mein König?“ stichelte sie.
„Morgen um diese Stunde, das ist ein königlicher Befehl!“ sagte er streng, ohne auf ihre Bemerkung einzugehen; doch in seinen Augenwinkeln versteckte sich ein Lächeln der Vorfreude.
Am folgenden Tag suchte Philipp fünfzehn Minuten vor der vereinbarten Zeit den Fechtsaal des Alcázar auf, da er ahnte, dass der potentielle königliche Fechtmeister nicht unvorbereitet zur Probestunde erscheinen würde. Er hatte sich nicht getäuscht: Marinelli übte – zu konzentriert, als dass er seinen hinter einer Säule auf der Empore verborgenen Beobachter bemerkt hätte – einige besonders trickreiche Angriffskombinationen, und Philipp stellte mit kundigem Blick fest, dass der Fechtmeister sich nach der italienischen Fechtschule richtete, die phantasievollere Angriffe und freiere Bewegungen erlaubte als die nüchterne französische oder die streng abgezirkelte spanische Schule. Marinelli war zwar recht klein und stämmig, doch er bewegte sich mit einer Behändigkeit, die sofort zeigte, dass er sein Handwerk verstand.
Philipp musste beim Anblick des Italieners unwillkürlich an seinen ersten Fechtmeister, Don Juan de Zuñiga y Requesens, zurückdenken. Der alte Mann war das Idealbild eines spanischen Granden gewesen: groß, schlank, mit exakt geschnittenem grauem Bart und einer Adlernase, die den stolzen Blick seiner grauen Augen noch unterstrichen hatte. Requesens hatte den jungen Infanten in der Kunst des Fechtens im spanischen Stil unterwiesen, der mathematisch berechenbare, systematische Angriffe, kontrollierte Beinarbeit und vor allem Kaltblütigkeit verlangte – man musste ruhig bleiben, um gut zu fechten. Wie oft hatte Philipp den strengen Lehrer zum Teufel gewünscht... Doch Requesens hatte eine besondere Eigenschaft besessen: Er hatte Philipp nie mit jener kriecherischen Schmeichelei behandelt, die so viele andere dem Sohn des Kaisers entgegengebracht hatten, sondern war ihm offen und stolz gegenübergetreten; und deswegen hatte sein Schüler ihn geliebt und wäre bereit gewesen, ihn bis zum Tod zu verteidigen.
Der König wischte diese Erinnerungen beiseite, als unten auf dem Fechtboden aus einem Nebenzimmer Ana auftauchte. „Seid Ihr bereit, Marinelli?“ fragte sie.
„Immer, Signora“, erwiderte der Fechtmeister. Trotz der körperlichen Anstrengung atmete er kaum schwerer als ein ausgeruhter Mann.
„Aufgeregt?“ Ana legte ihm mitfühlend die Hand auf die Schulter, und diese vertraute Geste unter Freunden gab Philipp einen unerwarteten Stich. Noch bevor Marinelli antworten konnte, machte er sich mit einem Räuspern bemerkbar und ging schnell die Treppe zum Fechtboden hinunter.
„Señor di Marinelli, ich freue mich, Euch am Hof begrüßen zu können.“ Sein Lächeln war eine Spur zu kalt, um zu seinen Worten zu passen, als er dem Italiener die Hand zum ehrerbietigen Kuss reichte. Mit einem leichten Kopfnicken begrüßte er dann Ana, die einen förmlichen Hofknicks andeutete. „Wollen wir gleich beginnen? Doña Ana hat mir von Euren Fähigkeiten in der Fechtkunst viel vorgeschwärmt, aber ich möchte dringend selbst sehen, was Ihr könnt.“ Er wusste selber nicht genau, warum er einen so bissig-herablassenden Ton anschlug, doch er hatte keine Zeit mehr, darüber nachzudenken: In Marinellis braunen Augen erschien ein Unheil verheißendes Glimmen, das seinem sonst eher sanften Gesichtsausdruck eine lauernde Gefährlichkeit verlieh, und Philipp wurde klar, dass er den Mann in seinem Berufsstolz getroffen hatte.
„Ich werde mein Bestes tun, um Euch nicht zu enttäuschen, Majestät – auch wenn meine italienische Herkunft mich wohl von vornherein benachteiligt“, erwiderte der Fechtmeister kühl, und Philipp fragte sich, ob die sonst so diskrete Ana ihm von den Vorbehalten des Königs gegenüber Neapolitanern im Hofdienst erzählt hatte. „Aber ich bitte mir die Möglichkeit aus, den Dienst bei Hofe abzulehnen, wenn ich hier keine Herausforderung finde, die es wert ist, dass ich die Familie Mendoza verlasse.“
Das war nun allerdings so frech, dass Philipp sich beherrschen musste, um nicht auf dem Absatz kehrtzumachen und wortlos den Fechtsaal zu verlassen. „Ihr seid frei, zu tun, was Euch beliebt“, presste er heraus.
„Dann darf ich Euch bitten, Eure Waffe zu wählen, Majestät.“
Philipp wandte sich zu dem Tisch, auf dem die abgestumpften Unterrichtswaffen lagen, die Marinelli mitgebracht hatte. Dort stand jedoch bereits Ana, die über die Richtung, welche das Gespräch genommen hatte, nicht erfreut war und hoffte, dass sich im Laufe des Übungsgefechts die Lage entspannen würde. Sie besah sich die verschiedenen Waffen und warf Philipp schließlich einen Degen zu. „Diese Waffe müsste Euch zusagen, mein König.“
Philipp machte probeweise einen Ausfall, wog die Waffe in der Hand und nickte. „Eine gute Wahl, Doña Ana.“ Dann stutzte er jedoch und besah sich die Klinge näher. „Oder vielleicht doch nicht... Diese Klinge ist schon einmal gebrochen, und sie wird bei einem heftigen Schlagabtausch sofort wieder brechen. Wolltet Ihr mich von vornherein benachteiligen?“ Vorwurfsvoll sah er Ana an.
Die lächelte schwach. „Nein, mein König, im Gegenteil – ich habe Euch einen Vorteil verschafft. Die Prüfung, der Maestro di Marinelli alle neuen Schüler unterzieht, habt Ihr nämlich soeben glanzvoll bestanden.“ Als Philipp nur verständnislos zwischen ihr und dem Italiener hin und her sah, fuhr sie fort: „Nur ein erfahrener Fechter sieht sich eine Klinge so genau an, wie Ihr es getan habt. Diese alte Bruchstelle bemerkt nur jemand, der sich mit Waffen auskennt. Ich habe bei dieser Aufgabe schimpflich versagt, bevor ich zum ersten Mal die Klingen mit dem Maestro kreuzte.“
Philipp begriff, dass Marinelli, den zu begutachten er hergekommen war, nun ihn selbst – mit Anas Hilfe – in die Position des Prüflings gezwungen hatte, und das behagte ihm überhaupt nicht. Er war zwar ein anerkannt guter Fechter und hatte einige seltene Male sogar Don Pedro de Riveira in Übungsgefechten besiegt, doch Marinelli schien sein Handwerk um etliches besser zu beherrschen, und wenn er für Philipps Unfreundlichkeit Rache nehmen wollte, würde er den König ohne weiteres vor Anas Augen blamieren können.
Vor Anas Augen? War das denn alles, was ihm zu schaffen machte? Du solltest dich nicht so sehr darum sorgen, was Ruys Frau von dir denkt oder gar ein dahergelaufener Italiener, der seinen Triumph über dich höchstens in der nächsten Kneipe herumerzählen kann, wies sich Philipp zurecht. Du hast ihn angegriffen, nur weil Ana freundschaftlich mit ihm umgeht – jetzt musst du auch den Preis für deine Unbeherrschtheit zahlen!
Philipp verdrängte die Frage an den Rand seines Bewusstseins, warum er so impulsiv auf Freundlichkeiten reagierte, die Ana anderen Männern erwies. Er zwang ein Lächeln auf sein Gesicht, das um einiges besser gelang als jenes bei der Begrüßung, und nahm Marinelli gegenüber die Mensur ein. „Ich bin bereit, Maestro.“
Der Gebrauch des ehrerbietigen Titels verunsicherte nun wiederum Marinelli, der sich schon darauf eingestellt hatte, dass der König seine Demonstration des Stolzes mit einem grußlosen Verlassen des Fechtsaals quittieren würde. Doch er fing sich rasch und begann nach einem flüchtigen Gruß mit den Klingen eine Serie kurzer, schneller Angriffe. Philipps Deckung hielt ihm – wenn auch mit einiger Mühe – stand, und mit jedem parierten Stoß wuchs Marinellis Hoffnung, dass der König ihm seine Frechheit verzeihen und ihm den Hofdienst anbieten würde.
Nach einigen Minuten hatte Philipp sich auf die Angriffe seines Gegners eingestellt und wagte nun seinerseits die ersten Ausfälle. Zwar kam er nicht einmal in die Nähe eines Treffers auf der gepolsterten schwarzen Weste des Fechtmeisters, aber Marinellis Gesichtsausdruck zeigte deutlich, wie sehr er sich auf seine Abwehr konzentrieren musste. Anas Augen verfolgten Philipps Angriffe genau, und sie ertappte sich dabei, dass sie ein Gefühl der Erregung empfand beim Anblick seiner kraftvollen Bewegungen und seiner Gesichtszüge, aus denen die unverhohlene Leidenschaft des Kampfes sprach. Ob er sich in den Armen einer Frau, beim Liebesakt, genauso bewegte wie jetzt, mit derselben Geschmeidigkeit, derselben Hingabe? Doch was dachte sie da nur? Er ist mit Elisabeth von Valois verlobt, rief Ana sich unwillig zur Ordnung; warum also hatte sie solche Gedanken wegen eines Mannes, den sie niemals würde besitzen können?
Auf dem Fechtboden machte Marinelli ein kurzes Handzeichen und senkte die Klinge. Auch Philipp richtete sich aus der Fechthaltung auf und zog verwundert die Augenbrauen hoch, als er Marinelli niederknien sah. „Ich bitte Eure Majestät um Entschuldigung für meine unbeherrschten Worte und für die Prüfung, der ich Euch unterzogen habe“, sagte der schwer atmende Italiener. „Ich möchte Euch untertänigst darum bitten, mich als Euren Fechtmeister in den Hofdienst aufzunehmen.“
Philipp streckte dem schweißüberströmten Marinelli die Hand hin und zog ihn auf die Füße. „Ich habe mich auch nicht gerade königlich verhalten. Lasst uns vergessen, wie unsere Bekanntschaft begonnen hat. Ich würde mich glücklich schätzen, Euch in meinen Diensten zu wissen und künftig von einem wahren Meister lernen zu können. Zu lange hat der spanische Hof einen Fechter wie Euch vermisst.“
Marinelli kniete abermals nieder und küsste Philipps Hand. „Ich werde Euch niemals enttäuschen, mein König.“
Von nun an verbrachte Philipp mehr Zeit als üblich auf dem Fechtboden, doch mit Ruys tatkräftiger Unterstützung schaffte er es, die Aktenberge in seinem Arbeitszimmer nicht zu vernachlässigen. An einem schon angenehm warmen Frühlingsmorgen jedoch schien Ruy seltsam abgelenkt zu sein. Als Philipp ihn zum dritten Mal angesprochen und immer noch keine Antwort bekommen hatte, beugte er sich zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter. „Ruy, was ist los mit dir?“
Ruy sah zu ihm auf und stieß einen abgrundtiefen Seufzer aus. „Dorotea kommt!“
„Wer ist...“ Er begriff. „Oh mein Gott, du Ärmster! Wann denn?“
„Morgen schon!“
„Morgen? Da muss ich dann wohl ganz dringend nach… Granada. Oder so.“
„Vielen Dank für deine tatkräftige Unterstützung, Philipp!“ Ruys Bemerkung triefte nur so vor Ironie.
Philipp versuchte sich zu verteidigen: „Aber diese Frau ist...“
„Fürch-ter-lich!“ Die Freunde sahen sich an und verstanden sich.
„Freut Ana sich denn wenigstens auf ihre Mutter?“ fragte Philipp.
„Na ja, immerhin haben sie sich einige Zeit nicht gesehen, aber sie freut sich wohl eher auf ihren Vater.“
„Don Diego wird auch kommen?“
„Gott sei Dank! Wenigstens ein Mendoza, der mich nicht für eine Schande der Familie hält.“ Ruy stützte den Kopf in die Hände. Er schien wirklich verzweifelt zu sein.
Philipp überlegte kurz. „Falls du es möchtest, könnte ich ja ganz zufällig genau dann in eurem Haus auftauchen, wenn Dorotea eingetroffen ist. Dann wird der Abend für dich vielleicht etwas erträglicher.“
„Oh ja, bitte!“ Ruys Gesicht hatte sich schlagartig aufgehellt. „Allein kann ich diesem Drachen nicht standhalten, fürchte ich.“
„Gut, abgemacht; dann gehst du jetzt am besten nach Hause und widmest dich den Vorbereitungen für Doroteas Besuch. Du kannst dich heute ohnehin nicht mehr konzentrieren.“
„Bis dann...“ Ruys Seufzer versprach nichts Gutes.
Am nächsten Tag traf gegen Mittag der Tross der Mendozas ein. Ana fiel – ein geschicktes Ablenkungsmanöver – zuerst ihrer Mutter um den Hals, während Diego seinen Schwiegersohn freundlich begrüßte, was Balsam für Ruys Selbstbewusstsein war. Dann musste auch er Dorotea gegenübertreten.
„Ich grüße Euch, Don Ruy“, sagte sie kalt, während sie ihren Blick über die Fassade des Eboli’schen Stadthauses schweifen ließ. „Das Haus ist kleiner, als ich erwartet hatte. Einem Günstling des Königs hätte etwas mehr Prunk doch wohl zugestanden.“
Mühsam beherrscht erwiderte Ruy: „Wie mein König schätze auch ich die Einfachheit, Doña Dorotea. Ich finde dieses Haus durchaus angemessen.“
„Ich denke, wir sollten erst einmal hineingehen“, lenkte Ana ab. Sie führte ihre Mutter ins Haus, während Don Diego und Ruy ihnen langsam folgten. Diego beugte sich zu seinem Schwiegersohn und sagte leise: „Ich wollte es in Gegenwart meiner Frau nicht so deutlich sagen, aber offensichtlich habt Ihr meine Tochter sehr glücklich gemacht. Ich hoffe, Ihr wisst, dass ich über die Angemessenheit dieser Heirat immer anders gedacht habe als Dorotea.“
„Wofür ich Euch sehr dankbar bin, Don Diego.“ Ruys Gesicht zeigte, wie ernst er seine Worte meinte.
„Meint Ihr nicht, dass es an der Zeit ist, die Förmlichkeiten aufzugeben?“ fragte der alte Edelmann. „Nenn mich Diego.“
„Gern – ich heiße Ruy.“ Das war natürlich die dümmste Antwort, die er geben konnte, doch Diego sah ihn nur lächelnd an und bemerkte: „Ich weiß.“
Nachdem Ana ihren Eltern das Haus gezeigt und Dorotea sämtliche Räume begutachtet und – meist nörgelnd – kommentiert hatte, begab sich die Familie in den Speisesaal. Kurz darauf wurde Ruy, der wie auf Kohlen saß, endlich erlöst: Ein Diener meldete den König, was hektische Betriebsamkeit bei Dorotea auslöste, die ihr Dekolleté auf ausreichende Tiefe kontrollierte. Ihr Mann quittierte ihre Bemühungen mit müdem Lächeln.
Als Philipp schließlich durch die Tür trat, verschlug es sogar Ana für einen Moment die Sprache. Der König trug zu seinem dunkelblauen Wams schwarze Stiefel und einen weiten schwarzen Umhang, was ihm etwas ungemein Verwegenes gab. Seine blauen Augen funkelten im Licht der Kerzen, die den Speisesaal erhellten, und auf seinem Gesicht stand ein jungenhaftes, breites Lächeln.
In etwas zu überschwänglichem Ton rief der König: „Doña Dorotea, wie ich mich freue, dass Ihr uns mit Eurem Besuch beehrt!“ Während die Angesprochene vor Begeisterung fast in Ohnmacht fiel, wandte Philipp sich Ana zu. „Doña Ana, Ihr wart nie schöner als an diesem Abend.“ Er reichte Diego die Hand. „Es ist immer eine Freude, Euch zu treffen, mein Freund.“
Ana war über das Kompliment, das er ihr gemacht hatte, gegen ihren Willen errötet, doch ehe sie oder Diego irgendetwas erwidern konnten, schrillte Doroteas Stimme durch den Raum. „Oh mein König, die Zeit ist schmeichelhafter mit Euch umgegangen als mit mir!“
Ana warf Philipp einen warnenden Blick zu, da sie genau wusste, welche Antwort ihm auf der Zunge lag, und ihr zuliebe beherrschte er sich. „Ihr übertreibt, meine Liebe! Eure Schönheit ist nach wie vor unübertroffen in Kastilien.“
„Dürfen wir den Grund Eures Kommens erfahren, mein König?“ fragte Ana und betonte „mein“ gerade so viel, dass Philipp verstand, was sie meinte.
Er setzte sich neben sie und warf dem immer noch hinter ihm stehenden Diener mit gekonntem Schwung seinen Umhang zu. „Was könnte ein triftigerer Grund sein als der Besuch Eurer Eltern?“
Ana unterdrückte ihrer Mutter zuliebe eine kokette Antwort. „Würdet Ihr uns dann die Freude machen, uns beim Abendessen Gesellschaft zu leisten?“
Dorotea beugte sich vertraulich zu ihm herüber. „Wir würden uns sehr geehrt fühlen, mein König.“
Philipp fühlte sich nicht geehrt, sondern etwas bedrängt und fürchtete schon, ein wenig zu viel Charme aufgewandt zu haben, doch um Ruys willen spielte er weiter und fand sogar Spaß daran, Dorotea mit gezielten Bemerkungen immer wieder an den Rand der Ekstase zu treiben. Ruy konnte aufatmen, denn für den Rest des Abends hatte seine Schwiegermutter nur noch Augen für den König. So blieb er von weiteren Spitzen verschont und konnte sich einer ungestörten Unterhaltung mit Don Diego widmen. Kurz vor Mitternacht verabschiedete Philipp sich schließlich, und Ruys Blick zeigte deutlich, dass sein Freund sich an diesem Abend seine ewige Dankbarkeit erworben hatte.
Einige Tage später saß Ruy wieder einmal in Philipps Arbeitszimmer, was ihm eine willkommene Gelegenheit lieferte, sich nicht in der Nähe seiner Schwiegermutter aufhalten zu müssen. Dorotea ihrerseits nutzte die Chance, ein „Gespräch unter Frauen“ mit ihrer Tochter zu führen. Sie klopfte einladend neben sich auf die Ottomane, auf der sie sich niedergelassen hatte. „Setz dich zu mir, Ana, ich möchte dich etwas fragen.“ Ana beschlich ein ungutes Gefühl, das sich sofort bestätigte, als Dorotea zur Sache kam. „Ich wollte gerne von dir wissen, wann du mir ein Enkelkind zu schenken gedenkst.“
Ihre Tochter schluckte und versuchte Zeit zu gewinnen. „Nun ja...“
Dorotea hörte ihr überhaupt nicht zu. „Es liegt bestimmt an deinem Ehemann, dass du noch nicht schwanger bist. Ich habe dir gleich gesagt: Heirate keinen Portugiesen!“
„Was hat denn das damit zu tun?“ fragte Ana gereizt.
„Gómez sollte sich ein Beispiel an seinem König nehmen“, kam die Antwort. „Philipp hat schon seit Jahren einen Thronfolger.“
„Erstens hat mein Mann auch einen Vornamen, zweitens weißt du genau, wie es um Don Carlos‘ geistige Gesundheit steht, und drittens – wenn ich dich darauf aufmerksam machen darf – ist der König ebenfalls Portugiese, jedenfalls mütterlicherseits!“ Ana spürte, wie die Wut in ihr hoch kochte.
Für einen Moment war Dorotea ausmanövriert, doch dann stellte sie unbeirrt fest: „Trotzdem möchte ich in absehbarer Zeit einen Enkel im Arm halten können!“
Anas Widerspruchsgeist war geweckt. „Und wenn nicht?“
„Was willst du damit sagen?“ fragte ihre Mutter mit schriller Stimme.
„Dass du dich nicht in unsere Familienplanung einmischen solltest, Mutter!“
„Ana, sei ehrlich zu mir.“ Doroteas dunkle Augen nahmen einen geradezu tückischen Ausdruck an. „Du sagst das alles doch hoffentlich nicht nur, um vor mir zu verbergen, dass Gómez, also Don Ruy, nicht... Du weißt, was ich meine.“
Ana begriff, und im selben Moment ging die Wut mit ihr durch. „Mein Mann ist nicht impotent!“ rief sie so laut, dass selbst Don Diego in der Bibliothek es hören konnte.
„Entschuldige. Das ging wohl zu weit.“ Dorotea senkte den Blick.
„In der Tat, Mutter!“ Langsam beruhigte sich Ana wieder. „Ich verstehe deine Besorgnis, aber dies ist eine Angelegenheit, die nur meinen Mann und mich etwas angeht.“
„Ich wollte auch nur...“
„Ich weiß“, unterbrach ihre Tochter sie, „und wenn ich deinen Rat brauche, werde ich dich auch darum bitten.“
Dorotea wirkte etwas zerknirscht. „Verzeih meine unangebrachte Neugier.“
Ana brachte ein angespanntes Lächeln zustande. „Dieses eine Mal noch. Abgesehen davon bin ich im vierten Monat schwanger.“ Sie hatte tagelang überlegt, wie sie es ihrer Mutter beibringen sollte, und nie damit gerechnet, dass sie es so kühl, fast unbeteiligt sagen würde, doch die Frechheit, die Dorotea sich herausgenommen hatte, machte sie immer noch wütend.
Dorotea wäre fast von der Ottomane aufgesprungen. „Was? Ist das wahr? Und das sagst du mir jetzt?“ rief sie entgeistert.
„Du hast mir während eures Besuchs bisher kaum eine Chance eingeräumt, es dir auf angemessenere Weise mitzuteilen“, sagte Ana trocken. „Und natürlich ist es wahr.“
Ihre Mutter schien zu begreifen, dass sie einen Fehler gemacht hatte. „Entschuldige bitte. Das war eine dumme Frage.“
„Ja.“
Einige Minuten sagten beide nichts. Dann ließ sich Dorotea kleinlaut vernehmen: „Wirst du ihn in unserer Schlosskapelle taufen lassen?“
Ana brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, von wem sie sprach. „Vielleicht wird es auch eine Tochter, hast du diese Möglichkeit in Betracht gezogen?“
„Auch dann würdest du uns eine Freude machen, wenn unser Kaplan sie taufen dürfte.“
Ana überlegte. „Ruy wird sicher nichts dagegen haben.“ Dessen war sie sich überhaupt nicht sicher, aber der bittende Gesichtsausdruck ihrer Mutter machte ihr klar, wie wichtig diese Angelegenheit für sie zu sein schien.
Dorotea atmete auf. „Wenn du während der Schwangerschaft einen Rat oder Hilfe brauchst, mein Kind, komm ruhig zu mir.“
„Sicher.“ Das Lächeln, das Ana aufsetzte, wirkte sogar echt.